Ja, richtig gelesen, dieser Text ist nicht von Malakai Delamare aka Marc, sondern von mir, aus der Feder des Chefredax. Damit ist es also eine Fanfic zu Marcs Original. Aber keine Sorge, ich poste das nicht eigenwillig, sondern nach Prüfung, Gegenlesen und Okay von Marc.
Here we go:
Im Bereitschaftsraum drei der Nationalgarde von Auriverde herrschte eine gewisse Unruhe. Die Soldaten, vor allem die Piloten und die Mannschaften der Evakuierungshubschrauber gingen seit einigen Stunden wie auf heißen, spitzen Nägeln. Es war jetzt etwa eine Stunde her, seit die Flotte der Solaren Planeten-Union ins System gekommen war. Exakterweise handelte es sich um neunzehn Fregatten, sieben Zerstörer und gleich dreiundzwanzig ihrer Kreuzer, verschiedene Klassen, aber kampfstark. Diese ungewöhnliche Zusammenstellung zeigte, dass die Flotte bereits einiges hatte ausstehen müssen, denn es fehlten die Korvetten und mindestens dreißig weitere Fregatten. Die Kennung der Einheit besagte, dass es die 9. Einsatzflotte war, was die Sache noch ungewöhnlicher machte, denn die hatte normalerweise eine Stärke von einhundertzwanzig Einheiten. Verifiziert waren aber nur neunzehn Abschüsse, also stand die Frage im Raum, ob sich die Terraner in Flottillen aufgespalten hatten. Oder ob die Verluste dieser Formation einfach noch nicht upgedated worden waren.
Jean-Michel Lacroix, Lieutenant seines Zeichens und Co-Pilot des Hubschraubers C-19, kratzte sich am unrasierten Kinn. Eigentlich war seine Wache vorbei, genau wie die von Capitaine Germaine Antoinette Müller, aber dank der Terraner war jeder Soldat auf dem Planeten in Bereitschaft gerufen worden. Noch schienen sich ihre Feinde nicht für den einzigen bewohnten Planeten des Systems zu interessieren und prügelten sich lieber mit der Heimatflotte am Systemrand – was eigentlich dafür sprach, dass die Einheit quasi nur auf der Durchreise war. Aber die Vorgesetzten der beiden waren auf Draht, auch wenn Auriverde und sein Sonnensystem abseits des eigentlichen Kriegsgeschehens gegen die Liga lag. Sie gingen nach dem Motto vor, lieber zehnmal zu viel zu alarmieren, als einmal zu wenig, und sowohl Jean-Michel als auch Germaine stimmten dem zu.
Der Co-Pilot fragte: „Was denkst du, Toni? Kommen die zu uns rein? Theoretisch sind die Kräfte ausgewogen, keiner kann gewinnen, und die 180. Verteidigungsflotte ist ihnen auf den Fersen, sodass ein solcher Abstecher das Todesurteil für jede Einheit bedeuten kann, die ins Systeminnere fliegt.“
„Und wir haben sowohl starke Orbitalforts als auch Abwehrgeschütze auf dem Planeten“, bestätigte Germaine. „Bedenke aber bitte, was es für einen psychologischen Effekt ausmachen würde, wenn auch nur ein terranisches Schiff in Kernschussweite auf Auriverde heran kommen würde. Außerdem könnten sie unsere Militäranlagen zu verwüsten versuchen.“
„Oder Schaden an den Städten anrichten, um uns einzuschüchtern und die Kriegsmüdigkeit voran zu treiben“, sagte Lieutenant Carlos Sharper von der C-21 in ihre Richtung.
Germaine runzelte die Stirn. Eine Augenbraue hob sich langsam Richtung Haaransatz. „Meinst du, Charlie? Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass die Terraner schlau genug sind, keine offensichtlichen Verbrechen zu begehen, sondern nur aus dem Geheimen heraus. Ein Angriff auf eine unserer Städte wäre ihnen unwillkommen. Das würde ein schlechtes Licht auf sie werfen und die Unterstützung der Ordo Solaris und der Sandan-Hegemonie in Frage stellen. Verstehe mich nicht falsch, weder wir noch die Terraner sind zimperlich, aber wenigstens wahren sie die Form und tun so, als wären sie zivilisiert, etwas, was ich bei unseren Leuten oftmals etwas vermisse.“
„Die Ordoer auf unserer Seite wäre natürlich schön“, sinnierte Carlos. „Dann würde ihr derzeitiger Kurs die Spusis nicht in Sicherheit bringen, sondern vor eine schöne Wand aus Verteidigungeinheiten der Ordo Solaris treiben, an der wir sie zerquetschen könnten.“ Er hob die Schultern. „Natürlich unter voller Wahrung des Kriegsrechts und dem Einhalten der uschandorischen Erklärung. Einen auf zu gut fürs Universum machen können wir auch.“
Jemand lachte, andere fielen ein. Die Solare Liga sicherte sich ihre Unterstützung in der näheren kosmischen Umgebung eben vor allem dadurch, dass sie sich moralischer gab, als sie eigentlich war. Allein die Existenz der „Institution“, eines brutalen Geheimdiensts und seinem langen, langen Killerarm, der Sternenhand, der hauptsächlich für politische Morde eingesetzt wurde und den die Terraner zwar nicht bestätigten, aber auch nicht leugneten, sprach da Bände.
Aber es stimmte schon. Ein Angriff auf zivile Ziele würde sie Sympathien kosten. Viele Sympathien. Weshalb auch die Kamerische Liga versuchte, sich offiziell an die Vorgaben der uschandorischen Erklärung zu halten. Dass es gegen Kriegsgefangene schon mal zu Übergriffen kam, bevor sie sicher in ihren Lagern waren, war ein offenes Geheimnis. Aber da es hieß, die Terraner wären da auch nicht besser, wurde dieses nicht gern gesehene Verhalten so weit es ging ignoriert. Dem Geist der Erklärung entsprach das natürlich nicht, aber Germaine war „nur weil Krieg ist, müssen wir nicht mit Giftpfeilen schießen“ von Gonzales lieber als „im Krieg schweigen die Gesetze“ von Cicero.
Sie wollte gerade etwas darauf erwidern, immerhin war sie hier ohnehin eher als „Taube“ denn als „Falkin“ bekannt, also Friedensbejahend und den Krieg ablehnend, als das große zentrale Holo zum Leben erwachte und das überlebensgroße Brustbild von Admiral Giraldini zeigte, dem derzeitigen Kommandeur der Heimatflotte und damit auch dem Vorsitzenden der Landesverteidigung und des Zivilschutz. Wie immer brauchte der alte Mann mit der archaischen Augenklappe über dem Loch in seinem Kopf, wo einst das rechte seiner Augen gewesen war, nichts zu tun, um augenblicklich alle zum Verstummen zu bringen und ihre sofortige, volle Aufmerksamkeit einzufordern. Immerhin eine großartige Leistung, wusste Germaine doch, dass das Holo in fast zweitausend ähnlichen Einrichtungen wie ihrem Fliegerhorst projiziert wurde. Der Admiral kam auch gleich zur Sache. „Giraldini hier. Die Kämpfe am Systemrand laufen gut, es schaut ganz so aus als wollten die Spusis nur passieren. Wir lassen sie auch sehr gerne durch, solange sie eine gewisse Grenze ins Systeminnere nicht überschreiten. Zwei ihrer Kreuzer aber, die SPUWS DEVIAN TRETTINO und die SPUWS GERALDINE FORD jedoch sind aus der Flotte ausgebrochen und gehen auf Sprunggeschwindigkeit. Wir nehmen an, dass sie quer durch das Systeminnere reisen werden, um den Absprungpunkt der 9. Einsatzflotte nach Kaltfeldt abzusichern. Im Kaltfeldt-System sind sie dann auf moranischem Gebiet und unserem Zugriff entkommen. Dies werden sie zweifellos mit einigen Kurzsprüngen zu erreichen versuchen. Unsere Einheiten werden die eventuellen Eintauchpunkte absichern und die beiden Kreuzer daran hindern, etwas anderes zu tun, als durch unser System zu reisen. Nichts ist uns lieber, als dass die Unionler wie ein Traum wieder verschwinden, genauso wie sie gekommen sind. Ich gebe deshalb ausdrücklich die Anweisung, die Sprungstörer nicht einzusetzen. Ich wiederhole, die Sprungstörer werden nicht eingesetzt. Ausschließlich ich gebe den Gegenbefehl, und niemand sonst.“ Sein Blick wurde hart, sehr hart. Der alte Knochen war bekannt dafür, dass er etwas dagegen hatte, jede Form von Verlusten hinzunehmen, die vermieden werden konnten. Und dafür liebten ihn seine Leute. Nun ja, fast alle seine Leute.
„Möge Gott mit uns sein“, beendete er seine Rede, und dann fügte er hinzu, wovor sich Germaine die ganze Zeit gefürchtet hatte: „Und pass auf dich auf, Toni. Admiral Giraldini Ende.“
Diese Worte lösten eine Welle von Bemerkungen und freundlicher und nicht so freundlicher Knuffe gegen die Capitaine aus. Natürlich war es kein Geheimnis, dass sie eine der Enkellinnen des alten Giraldini war, aber musste er es immer so hervorheben? Zugegeben, sie hatte die gleiche Angst um sein Leben wie er um ihrs. „Isjagutjetzt!“, rief sie schließlich, als es ihr zu bunt wurde. „Schaut lieber zu. Die beiden Kreuzer springen gerade!“ Dies brachte die erhoffte Erlösung und lenkte die allgemeine Aufmerksamkeit wieder auf die taktischen Holos.
„Du, da stimmt was nicht. Die haben Sprunggeschwindigkeit und gehen nicht in den Sprung“, raunte Jean-Michel.
Germaine kalkulierte das kurz im Kopf nach und bestätigte die Aussage als korrekt. „Merkwürdig. Dass eine Einheit vielleicht nicht springen kann, geschenkt, aber beide?“ Irgendwas in ihrem Kopf machte Klick. „Außer, ihr Sprung wird gestört.“
„Aber der Alte hat doch befohlen, dass die Sprungstörer nicht eingesetzt werden, damit die Spusis wieder abhauen können“, merkte Carlos an.
„Dann können sie aber immer noch springen, nämlich zu den Störprojektoren“, sagte Germaine und bereute die Worte sogleich wieder. Die einzigen Störprojektoren, die das vollbringen konnten, waren in Chateau Noeuf verbaut, dem neuesten und größten Orbitalkastell des Planeten. Es war so groß, dass es auf einen Lagrangepunkt ausgelagert werden musste, um das gravitatorische Feld von Auriverde nicht zu sehr zu stören.
Sie hob das Multiarmband an ihre Lippen und rief hinein: „Sofortkontakt zu General LaBoise!“
Der Computer, welcher die Kontakte verwaltete, erkannte ihre Stimme und ihre Berechtigungen und schaltete sie sofort auf.
„LaBoise.“
„Sir, Chateau Noeuf holt wahrscheinlich die beiden Kreuzer der Union nach Auriverde!“
„Da das Fort die einzigen Sprungstörer hat, die groß genug für diese Reichweite sind, und die Kreuzer immer noch nicht gesprungen sind, macht das Sinn. Wir gehen kein Risiko ein. Danke für die Meldung, Toni.“
Von einem Moment zum anderen ging der rote Alarm durch den Stützpunkt, und wie Germaine wusste, auch einmal um die ganze Welt. Die Situation wurde ab jetzt behandelt wie ein direkter Angriff auf den Planeten. Lieber die Leute einmal zu viel in die Bunker scheuchen, als ein paar Millionen Tote haben. Für Germaine, Jean-Michel und die anderen Piloten und Crews bedeutete dies, dass sie alles stehen und liegen ließen und sofort zu den Ausgängen stürmten. Germaine, die damit gerechnet hatte, war schon während ihres Gesprächs mit dem General zur Tür raus gelaufen, und ihr Co-Pilot war schlau genug gewesen, ihrer Crew zu winken und ihr zu folgen.
Noch während sie durch die Gänge in die Richtung der Hangars eilten, wurden die Armbandcomputer mit den anzuwendenden Katastrophenplänen geladen. Für ihre Hubschrauberklasstaffel war die Aufgabe ohnehin klar: Menschen evakuieren und in die Bunker schaffen. Der aktuelle Katastrophenplan gab ihnen lediglich die Sektoren vor, in denen sie eingesetzt wurden. Es war eine Tatsache, dass, wenn es wirklich hart auf hart ging, etliche hundert Zivilisten überall zu finden waren, aber nicht in der Nähe eines Bunkers. Das war in ihrem Einsatzgebiet, der Millionenmetropole Boavista Nova, nicht anders.
„Boavista Nova. Westlicher Stadtrand und Peripherie“, las Jean-Michel vor, während sie liefen. „Zeitfenster vier Stunden. Eventuell weniger.“
Germaine nickte. Sie blickte nach hinten, wo ihre Crew und die übrigen Einsatzkräfte liefen. „Bessi, du weißt, was ihr zu tun habt.“
Im Gegensatz zu ihr hatte Sergeant Brigitte Sarmotte nicht die Kondition der Pilotin, da sie, wie sie sagte, ja ohnehin immer geflogen wurde. „Hälst du … uns für … blöde?“, tadelte sie ihre Vorgesetzte und Freundin.
„Man kann nie vorsichtig genug sein!“ Sie liefen in den Hangar ein, der die Heimat ihrer Lancette war, dem modernsten paramilitärischen Hubschraubertypus des ganzen Planeten. Ihre C-19 drehte bereits die Triple-Rotorblätter, angeschaltet durch die ständig anwesende Hangarbereitschaft, denn Kriege und Katastrophen kannten keine Schlaf-, und Atempausen. Majeur Huub Decker, der Hangarchief, gab ihr einen erhobenen Daumen, als sie einlief. Die automatische Checkliste war also problemlos abgelaufen. Das war ermutigend. Nichts wäre schlimmer gewesen, als einen manuellen Check machen zu müssen, wenn jede Sekunde zählte.
„Nachricht von Central“, sagte Jean-Michel, während er sich auf seinem Platz im Cockpit festschnallte. „Evakuierung von Boavista Nova zu 0,001 Prozent abgeschlossen.“
Germaine, die kurz nach hinten in den Laderaum geschaut hatte, ob ihre vier Crewleute auf den Sitzen saßen und angeschnallt waren, pfiff anerkennend. „Nicht schlecht für die ersten dreißig Sekunden. Sehen wir zu, dass wir fertig sind, bevor die vier Stunden um sind.“
Jean-Michel wollte etwas sagen, aber Germaine verbot ihm den Mund. Doch der Mann fügte trotzig etwas hinzu. „WENN uns vier Stunden bleiben!“
„Oooooooooo, Jean! Du WEIßT, dass ich so was hasse! Wenn was schief gehen kann, dann wird es genau von solchen Worten herbeibeschworen, und das weißt du!“
„Nachricht von Central! Beide Kreuzer sind gesprungen und bei Chateau Noeuf wieder ausgetreten! Zeitfenster zur Evakuierung reduziert sich auf zwei Stunden, elf Minuten. Die Erfolgsquote wird auf 0,2 Prozent gesetzt.“
Noch böser als zuvor starrte sie Jean-Michel an, der sich schuldbewusst um die Instrumente kümmerte. Wenn 0,2% der Bevölkerung starben, war der Einsatz trotzdem ein Erfolg, weil die Zeit knapper geworden war. Die Pilotin schwor sich selbst, dass die Quote in ihrem Einsatzgebiet 0,0 sein würde.
***
Alles in allem sah es nicht so schlecht aus. Nach hundertzwei Minuten im Einsatz hatte die C-19 schon drei Einsätze absolviert und insgesamt dreihundertundsieben Menschen aus den Wandergebieten, von den Farmen und direkt von den Autostraßen gepflückt und zu den nahesten Bunkern gebracht. Es war die vierte Tour, die ihr den Nerv raubte, vor allem weil einer der Kreuzer von Chateau Noeuf beschädigt worden war, weshalb der andere erst dessen Flucht aus der Reichweite des Forts gedeckt hatte und dann den Kurs in Richtung Auriverde änderte, was ihr Zeitfenster um neun Minuten erhöht und die Evakuierung eventuell unnötig gemacht hatte. Aber das war kein Risiko, dass sie eingegangen wäre. So war sie nicht ausgebildet worden. Und dieses Risiko ging auch keiner ihrer Vorgesetzten ein. Immerhin, die Evakuierung war bei 99,93% angelangt. In der Stadt waren die meisten Menschen bereits in den Bunkern. Fünf von neunzehn hatten bereits das Maximum erreicht, und nun übernahmen die Hubschrauber der Bereitschaftsstaffel auch die Aufgabe, so lange sie konnten im Stadtgebiet abgewiesene Bürger zu anderen Bunkern zu bringen, die noch Kapazitäten hatten.
Für ihre Crew und sie änderte sich nichts. Der starke Schirm ihres Helis würde sie sogar vor direktem Beschuss durch den Kreuzer schützen, und, falls das Unglück geschah und das Monstrum auf ihrer Welt abstürzte, auch vor dem Impakt, solange sie nicht zu nahe dran waren, denn das entfaltete je nach Geschwindigkeit eines Unions-Kreuzers einen kleineren oder größeren Krater. Immerhin waren die Dinger fliegende Großstädte, nicht mehr und nicht weniger.
„SPUWS GERALDINE FORD ist jetzt über unserem Kontinent angekommen“, meldete ihr Co-Pilot. „Kurs auf Boavista Nova, Ankunftszeit etwa in tausenddreihundertelf Sekunden.“
„Über zwanzig Minuten. Falls das Ding nicht einfach schneller fliegt“, kommentierte Germaine.
„Hast du nicht gerade was darüber gesagt, dass man so etwas nicht ausspricht, und zwar zu mir?“, fragte Jean-Michel amüsiert.
„Du hast angefangen“, rechtfertigte sie sich. „Da ist der Wagen. Zweisitzer, Bodenwagen ohne Flugmodus. Beide Passagiere erwarten uns. BESSI!“
Die Unteroffizierin stand bereits neben der Tür und hatte sich mit Claude an den Sicherheitslaschen eingehakt. Theoretisch brauchten sie nur die kleine Seitenschiebetür öffnen und die beiden unverletzten, heftig winkenden Leute, einen Mann und eine Frau, an Bord zu lassen, zu den anderen dreißig Leuten zu setzen, die sie auf dieser Mission bereits aufgelesen hatten und zum nächsten Bunker fliegen – oder zumindest raus aus dem Kurs des Kreuzers. Aber wenn der den Kurs beibehielt, würden sie das Ding zwar prächtig sehen können, aber es würde etwa elf Kilometer an ihnen vorbei fliegen. Im Weltraum war das keine Entfernung, auf einem Planeten aber spielte das in ihre Hände. Hier gab es notfalls immer eine Form von Deckung vor irgendwelchem Beschuss. Obwohl der Terraner bisher nur zurückgeschossen hatte und nicht selbst angriff, solange sein havarierter Kollege noch nicht in Sicherheit war.
Der Heli setzte auf, das Schott flog auf, und Bessi und Claude reckten ihre hilfreichen Hände zu den beiden Ausflüglern. Der Mann kam zuerst an die Tür und ließ sich hoch ziehen. Als Claude das Gleiche für die Frau tun wollte, stieß er den Soldaten in die Seite. „Sie bleibt hier zurück!“, rief er mit lauter Stimme. „Ich bin Senator Montmartre! Wenn Sie nicht tun, was ich sage, hat morgen keiner mehr eine Karriere!“ Er sah zu den Zivilisten herüber. „Und ihnen werde ich die Leben so nachhaltig ruinieren, dass noch ihre Kinder Schulden haben werden!“
„So ein Quatsch!“, murrte Claude und streckte wieder die Hand aus. „Kommen Sie, Madame!“
„Die Frau ist meine Sekretärin! Ich kann nicht mit ihr privat gesehen werden!“ Wieder drängte er sich an den Ladesoldaten und versuchte ihn zu behindern.
„Gilbert, das kannst du nicht machen!“, rief die junge Frau, fast noch eine Jugendliche. „Das kannst du nicht tun!“
„Tut mir leid, keiner darf von dir erfahren. Und jetzt schließen Sie das Schott, und SIE ZWEI, Sie fliegen ab, und zwar sofort!“
Nun wurde es Germaine aber doch zu bunt. Sie schob ihr Blendvisier hoch und schaute in den Laderaum. „Hallo, Gilbert. Ich fürchte, du verstehst hier etwas falsch. Nachdem ich mit Grandpère geredet habe, wirst DU keine Karriere mehr haben! Also halt die Klappe, lass die Mademoiselle einsteigen und such dir einen Sitzplatz, klar?“
Ihre eindeutigen Worte lösten Zustimmung und Applaus aus. Doch so schnell gab der Senator noch nicht auf. Bleich, aber entschlossen versuchte er, nach Claudes Seitenwaffe zu greifen und sie aus dem Holster zu ziehen. Doch der kleine, drahtige Mann steckte nicht in einer Uniform, sondern in einer Rüstung. Einer Rüstung mit Kraftverstärkern, um genau zu sein. Und mit kraftverstärkten Handschuhen. Einer dieser Handschuhe erwischte die Hand des Senators und packte so hart zu, dass etwa darin brach. Laut und vernehmlich. Georgine, das dritte Crewmitglied, kam nun heran und drückte Montmartre ein Dosi-Spray an den Hals. Es zischte laut, und man konnte dabei zusehen, wie der Mann das Bewusstsein verlor. „Anstiftung zu einem Verbrechen, lebensbedrohende Drohungen, Mordversuch, versuchter Diebstahl einer Kriegswaffe, Junge, da kommt was zusammen.“ Sie fing den haltlos fallenden Körper auf und konnte nur knapp dem Drang widerstehen, diesen Widerling erst mal zu Boden stürzen zu lassen. Verdient hätte er es allemal. Derweil halfen Bessi und Claude der jungen Frau an Bord. „Setzen Sie sich möglichst weit weg von diesem Ekel. Keine Angst, der kann ihnen morgen nichts mehr tun. Und heute schon gar nicht.“
„Danke“, sagte das Mädchen, und dann noch einmal in Richtung des Cockpits: „Danke, Mademoiselle! Wer ist denn ihr Grandpère, wenn ich fragen darf?“
Die beiden Crewleute schmunzelten, während Jean-Michel die Maschine längst wieder von Boden abheben ließ.
„Admiral Giraldini. Ich bin seine Lieblingsenkelin!“ Sie lächelte der jungen blonden Frau zu. „Machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben alles im Griff. Setzen Sie sich und schnallen Sie sich an. Da sind noch ein paar Leute, die gerettet werden wollen.“
„Ja, Mademoiselle. Danke, Mademoiselle.“
Germaine konnte ein Schmunzeln nicht unterdrücken, wandte sich aber wieder um und senkte das Visier, um wieder Zugriff auf die taktischen Daten zu erhalten. „Hoo, vorsichtig, bleib in Bodennähe, Jean. Da kommt das Ding. Es fliegt direkt auf die Stadt zu!“, mahnte sie den Lieutenant an ihrer Seite.
„Schon gesehen. Ich nehme die Straße durch das Wäldchen in Bodennähe. Ich nehme an, wir fliegen nicht zum Bunker, sondern einfach nur weit weg.“
„Du hast es erfasst, mon Grand.“
„Wir sind übrigens bei 99,91% Evakuierungsrate. In der Stadt sind es sogar 99,998%.“
„Der Rest soll sich beeilen. Bei dem Tempo ist der Gigant in zwei Minuten über der Stadt, und …“
„Toni, ich kriege hier was rein. Drei Kommunikatoren, die auf der Liste als „Vermisst“ gemeldet wurden! Laut Computer wurden sie erst vor wenigen Minuten wieder mit dem Netz verbunden!“
„Wie weit entfernt?“
„Etwa elf Kilometer nach Norden.“
„Na, wenigstens weg vom Kurs dieses Riesenklotzes. Vergiss den Waldweg, flieg einfach hin. Ich habe ein Scheiß Gefühl gerade. Du weißt, Lagrangepunkt sechs, an dem Chateau Noeuf hängt, befindet sich jetzt gerade über dem westlichen Horizont.“
Jean-Michel führte den Befehl gehorsam aus, obwohl sie das Recht hatten, sich bei einer Evakuierungsrate von 99,8% abzusetzen; wer dann noch nicht in einem Bunker war, galt als selbst schuld. Etwas, was Germaine niemals hingenommen hätte, deshalb hatte Jean-Michel auch gar nicht versucht, mit ihr darüber zu diskutieren.
„Acht Kilometer“, zählte er herunter. „Das Ding ist jetzt über dem Stadtrand. Sieben Kilometer.“
„Ich sehe es. Und hast du das gesehen? Die Explosion auf der Oberseite des Kreuzers? Das war ein Gravotonbeschuss!“
„Ein Gravotonbeschuss? Über einer unserer Großstädte? Will Admiral Goose, dass das Ding abstürzt?“, rief er ungläubig.
Das machte Sinn. Sylvestre Goose war ein Hardliner, schon ein Adler und kein Falke mehr. Und nichts wäre ihm lieber gewesen, als den Hass auf die Terraner weiter zu schüren. Ohnehin bedeuteten ihm Opfer nicht sehr viel, weshalb er auch seine Flotte verloren hatte, und nun auf Chateau Noeuf sein Gnadenbrot fraß. „Sieht ganz so aus. Dann muss der Kreuzer sicher noch mehr einstecken. Vielleicht stürzt er auf die Stadt!“
„Das gibt dann aber einen sehr großen Rumms“, murmelte Jean-Michel. „Vier Kilometer.“
„Ich habe eine optische Erfassung. Drei Personen, etwa siebzehn Kilometer vom Stadtkern entfernt. Falls das Ding runterkommt, schaffen sie es definitiv nicht alleine.“
„Der Spusi steigt! Hat wohl genug Prügel bezogen!“, rief Jean-Michel. Tatsächlich versuchte das fliegende Monstrum, Höhe zu gewinnen und zu beschleunigen. Dadurch verursachte es aber am Boden einen mittleren Orkan. „DA FLIEGT WAS AB! Zwei Kilometer!“
Germaine nahm sich die Zeit, das „was da abflog“, heran zu zoomen. Es waren die Überreste eines Shuttles. Kein Personenshuttle, sondern ein großes, monströses Ding, von dem fast das ganze vorderste Drittel fehlte. Zudem hatte das Raumschiff auf der Seite eine riesige Schmarre erhalten, wahrscheinlich durch Photonenbeschuss.
„Ohneinohneinohnein“, murmelte Germaine. „Das ist ein Raketenshuttle! Wenn das in der Stadt runter kommt, dann ist sie tatsächlich platt!“ Noch während sie sprach, fiel das Ding tatsächlich zu Boden. Dann geschah bange Sekunden nichts, und dann … Dann gab es einen Blitz, und noch bevor der Donner der Explosion bis zu ihnen rollte, drückte sich eine gewaltige Feuerwelle durch die Stadt und beschädigte fast jedes höhere Gebäude.
„Zwei gute Nachrichten!“, sagte Jean-Michel. „Erstens, die Evakuierung ist bis auf drei Nachkommastellen erfolgreich abgeschlossen und war auch vollkommen nötig. Zweitens, die Stadt sollte einen eigenen Schutzschirm bekommen. Jetzt rate mal, welcher Senator das verhindert hat als „unnötige Geldausgabe und Verschwendung“, und jetzt da hinten bewusstlos angeschnallt sitzt!“
„Wie auch immer, wir sind da. Ich gehe runter und aktiviere den Schild, wenn die drei sich darunter befinden. Eventuell müssen wir der Feuerwalze einige Zeit standhalten. Aber hier draußen dürfte sie eh nicht mehr so stark sein!“
Jean-Michel übernahm die Landung und setzte den Heli wie versprochen in direkter Nähe zu den drei Zivilisten auf. „Das sind doch noch Kinder!“ Germaine rief: „BESSI! DIE SIND STARR VOR ANGST!“
„SEHE ICH AUCH!“ Sie riss die Tür auf, schnallte sich ab und sprang mit Claude und Thierry, dem vierten Crewmitglied, aus der C-19. Wie erwartet standen alle drei Kinder unter Schock, ein Junge, zwei Mädchen. Die drei Soldaten mussten sie mit Hilfe ihrer Kraftverstärker bergen, als schon die Feuerwalze grollend heraneilte. Noch bevor sich das Schott hinter Thierry und dem Jungen geschlossen hatte, ließ Jean-Michel die Maschine wieder steigen und übergab zurück an Germaine, die einen Fluchtkurs berechnet hatte, der ihr persönliches Risiko minimieren würde.
Unten im Laderaum wurden die drei auf freie Sitze verfrachtet und angeschnallt. Dann behandelte Georgine die beiden Mädchen und den Jungen auf Schock. Kurz darauf hörte Germaine eines der Mädchen weinen und nach ihrer Maman rufen. Der Junge rief nach einem Frauennamen, einer Shalia, vielleicht auch seine Mutter, seine Freundin, seine Schwester, wer wusste das schon? Nur das dritte Mädchen blieb ruhig. Um sie musste es besonders schlimm stehen.
„Rettung bestätigt von Lucien Carvalho, Anais Dubois und Océane Fairchild!“, meldete Bessi. „Hört mir zu, Kinder, hört mir genau zu! Die Stadt wurde vollständig evakuiert! Der Computer versichert mir, dass die Dubois im ihnen zugewiesenen Bunker registriert wurden! Auch die Fairchilds sind bis auf dich, Océane, alle da unten angekommen und registriert worden! Deine Schwester Shalia wurde zwar von deinen Eltern getrennt, aber sie wurde registriert, als sie von einem unserer Kollegen, der C-21, zu einem anderen Bunker gebracht und dort aufgenommen worden ist! Dafür sind wir schließlich da! Und alle Bunker haben standgehalten, hört ihr mich?“
Daraufhin folgte lange Zeit nichts, nur enthemmte Tränen. Die Mädchen und der Junge umarmten einander, soweit das mit den Gurten ging, während Germaine die Maschine aus der Feuerwalze rausflog. Junge, Junge, was immer in dem Shuttle gewesen war, wäre es noch an Bord des Kreuzers detoniert, hätte es eine richtig fette Explosion gegeben, und dann die fliegende Großstadt zu Boden gesemmelt, und das hätte einen Krater gegeben. Aber der Gigant hatte gerade die Mesopause hinter sich gelassen und flog seinem flügellahmen Kameraden hinterdrein, der gerade Sprunggeschwindigkeit erreichte. Also mussten die Sprungstörer auf Chateau Noeuf entweder zerstört oder abgeschaltet worden sein. Aber egal, hauptsache, die Ligisten verschwanden wieder aus ihrem Sonnensystem.
Als sich die Jugendlichen etwas beruhigt hatten, auch durch das gute Zureden der anderen Zivilisten, vor allem aber die junge Frau, welche Senator Montmartre hatte zurücklassen wollen, erlitt das Mädchen namens Anais einen Stimmungsumschwung. Die Verzweiflung, die Angst, die Erleichterung, all das mündete nun in Wut. „Diese verdammten Spusis hätten uns fast alle getötet und …“
„Übernimm, Jean.“ Germaine schnallte sich ab, jetzt wo sie sowohl vor dem Kreuzer als auch der Explosion sicher waren und kletterte in den Frachtraum. „Nein, das waren nicht die Spusis. Das war Sylvestre Goose, der Kommandeur von Chateau Noeuf! Er hat den Kreuzer beschossen, damit der über Buovistanova explodiert oder zumindest abstürzt. Die Terraner waren eigentlich schon so gut wie weg, ohne unserer Welt einen Grashalm zu krümmen. Abgesehen vom Sturm, den ihr Flug mit sich gebracht hat, natürlich. Der Beschuss hat einen Hangar zerstört und ein Shuttle herausfallen lassen. Leider war das Ding ein Nachschubshuttle, und vermutlich voller Sprit und Bomben und Raketen für die Begleitjäger des Giganten. Und auch wenn die Feuerwalze groß ausgesehen hat, es hat keine Delle in den Planeten geschlagen. Wir hatten hier wirklich Glück im Unglück. Und eure Familien sind in Sicherheit, den Rest bauen wir wieder auf. Versteht ihr das, ihr drei? Wir bringen euch jetzt nach Arnauld. Da wird jetzt gerade ein Evakuierungslager aufgemacht, in den wir nach und nach die Leute aus den Bunkern hinfliegen werden, sobald die wieder geöffnet werden können. Dort seid ihr in Sicherheit und könnt so normal leben, wie es unter diesen Umständen geht, aber vor allem mit euren Familien. Versteht ihr das?“
Der Junge, Lucien, hob misstrauisch die Augenbrauen. „Sie erzählen uns das doch nicht etwa nur mit unseren Familien, um uns ruhig zu halten?“
„Die drei Familien sind derzeit nicht zu erreichen. Zivile Kontaktnetze sind zerstört oder überlastet. Aber warte, wenn ich … Ja, ich kann Bunker Charlotte erreichen. Capitaine Müller, C-19. Sie haben eine außerreguläre Frau aufgenommen, Colonel Buchamps. Shalia Carvalho. Ich habe hier ihren Bruder direkt vor der Feuerwalze vom Boden aufgepickt. Können Sie Kontakt herstellen? Danke.
Ja, Capitaine Müller. Ihr Bruder ist hier, natürlich in Sicherheit. Ja? Die beiden Mädchen auch, natürlich. Was? In Ordnung. Ich stelle Sie auf Lautsprecher, natürlich.“ Sie hob ihr Armband in Richtung des Jungen. „Sprechen Sie.“
„Hallo, Luci? Bist du da?“
Der Junge machte ein Gesicht, als würde er einen Herzinfarkt bekommen. Dann aber brach es mit aller Erleichterung aus ihm heraus. „SHALIA! SHALIA, BIST DU DAS WIRKLICH?“
„Schrei nicht so, sonst deformieren meine Ohren, und Jaques will nichts mehr von mir, weil ich hässlich bin. Danke übrigens fürs Anschwärzen bei Maman. Hast dir ja einen wirklich tollen Tag für einen Ausritt mit deinen beiden Schätzchen ausgesucht, oder?“
Eines der Mädchen wurde puterrot, das andere brach in leises Kichern aus. „Hör mal, Luci, natürlich habe ich mir gewünscht, dass du für deinen eiskalten Verrat an mir einen reingedrückt bekommst, aber musste es gleich die ganze Stadt platt machen?“
„D-das war jetzt nicht meine Schuld!“, verteidigte sich der Junge.
„Ist ja nichts passiert, was man nicht wieder aufbauen kann“, wiegelte die weibliche Gesprächspartnerin nun wieder ab. Dankenswerterweise. Germaine registrierte das mit Wohlwollen. Sie musste selbst unter Schock stehen und kümmerte sich auch noch um ihren Bruder. Sie sollte sich ihren Namen wohl besser merken. „Und die Stadt wurde vollständig evakuiert, also ist bei uns auch niemand gestorben. Mit Maman und Papa habe ich sogar schon geschrieben, also alles gut. Wir sehen uns dann in den Evakuierungslagern. Kümmere dich um deine beiden Schätzchen, bis sie zu ihren Familien zurückkehren können, hast du gehört, Luci?“
„Ich habe dich lieb, Shalia“, platzte es leise aus dem Jungen heraus.
„Was? Habe ich einen Hörfehler? Oder hast du gerade wirklich gesagt, dass du mich lieb hast, Luci?“ Sie lachte. „Ich habe dich auch lieb. Und ich bin so froh, dass du und deine Mädchen gerettet wurdet. Wir sehen uns dann im Lager, Luci. Der Kanal muss wieder freigemacht werden. Wir sehen uns bald.“
„Wir sehen uns bald!“, rief Lucien Carvalho hastig in der Hoffnung, dass sie es noch hörte.
Das Mädchen Océane begann zu weinen. „Sie sind noch am Leben“, hauchte sie.
Der Junge drückte sie kräftig an sich, und auch das andere Mädchen, Anais, umarmte sie fest. „Wir sind bald wieder mit unseren Familien zusammen, das ist die Hauptsache. Und bis dahin kümmere ich mich um euch, versprochen.“
„Große Worte. Mal sehen, was dahintersteckt“, neckte Anais. „Du kannst uns im Lager gleich mal Eis besorgen. Vanille für mich und Oci nimmt wie immer Schoki.“
„Heyyyy!“, protestierte Lucien. Dann aber lächelte er und sagte: „Ich sehe mal zu, ob ich Eis für euch beide auftreiben kann. Aber ihr müsst nehmen, was ich kriegen kann.“
Germaine konnte nicht anders. Sie wuschelte allen drei durch die Haare. „Also, euch geht es gut. Das ist schön. Ich muss jetzt wieder fliegen, damit wir zeitig ankommen. Wir hatten alle einen schlechten Tag“, sagte sie mit einem Seitenblick auf den betäubten Senator, der noch mehr schlechte Tage vor sich haben würde, „aber ab hier wird es grundsätzlich besser. Das ist doch was, oder?“ Sie wuschelte noch einmal, was zumindest Océane leise protestieren ließ und ging wieder auf ihren Platz. Nicht aber ohne der jungen Frau, die sich vorher schon um die drei gekümmert hatte, einen eindeutigen Blick mit der Bitte zuzuwerfen, dass sie doch weitermachen solle.
Sie nickte, und Germaine beschloss, die Sekretärin unter ihre Fittiche zu nehmen in der Zeit, die noch kommen würde. Ja, in der Tat, es konnte für alle nur noch besser werden nach diesem Tag. Zumindest für die meisten. Nicht für einen gewissen Senator und einen gewissen Admiral.
Im Cockpit funkte Jean-Michel bereits mit der Lagerleitung und ließ sich einen Anflugvektor und einen Landeplatz zuweisen, denn alles, was fliegen konnte, brachte nun die ersten Menschen aus der Stadt hierher in Sicherheit. Und wenn sie aufs Radar sah, erkannte sie an den vielen Blips, dass es über fünfzig Flugeinheiten waren, die den gleichen Kurs hatten wie sie.
„Es freut dich vermutlich zu hören, dass unsere Staffel keine Verluste hat“, empfing sie Jean-Michel beinahe fröhlich.
„Das ist gut, denn wir werden noch eine Menge zu tun haben.“ In den nächsten Tagen, den nächsten Wochen, den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren. Aber hey, etwas zu tun war immer besser als langweiliges Warten.
***
„… begann heute der Prozess gegen Admiral a.D. Sylvestre Goose. Der unmittelbar nach der Boavista Nova-Katastrophe unehrenhaft entlassene Stabsoffizier und ehemaliger Kommandeur des Kastells Chateau Noeuf ist des versuchten millionenfachen Mordes angeklagt. In seiner ersten Zeugenaussage sprach er von „notwendigen Opfern, die das Volk zusammenschweißen und für den Krieg stählen würden“. Der Staatsanwalt beantragte daraufhin eine Untersuchung seines Geisteszustands, dem das Gericht mit allen fünf Stimmen stattgab.
Etwas aus den Schlagzeilen gerutscht ist dagegen der Prozess wegen versuchten Mordes an Senator Montmartre, der versucht hatte, seine Ex-Geliebte und Ex-Sekretärin im Explosionsradius der Feuerwalze zurückzulassen. Die Hauptzeugin der Anklage, Majeur Germaine Antoinette Müller, beschrieb ihn als skrupellosen Machtmenschen, der über Leichen zu gehen bereit sei, während er für die Medien ein Sonntagslächeln und ein Image als fürsorgender Vater pflegte. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu dreißig Jahre Gefängnis und anschließende Sicherheitsverwahrung, da er als Gefahr für alle Menschen in seiner Umgebung angesehen wird. Nach der Blitzscheidung und dem Entzug der Rechte an den eigenen Kindern die nächste schlechte Nachricht für den Politiker, der verzweifelt versucht hatte, die Besatzung des Rettungshubschraubers C-19 als Lügner und politisch motivierte Attentäter darzustellen, was ihm aber nicht gelang. Die Integrität von Majeur Müller und ihrer Crew wurde vor allem nach der Zeugenaussage von Annelie Norfolk, dem Opfer, vollständig bestätigt. Sie erhob noch im Gerichtssaal eine Anzeige gegen Montmartre, da sie dieser über Mittelsmänner, die bereits ermittelt und inhaftiert sind, zu erpressen versuchte, um in seinem Sinne auszusagen. Kommen wir zum Sport in der Channel-Liga. Dort eroberte Rotblauweiß Arnheim die Spitze zurück, indem sie beim Spiel …“



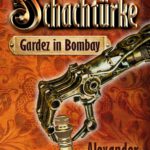

Seejay
7. August 2025 — 20:31
Ach Tiff. Nun hast du die schöne Apokalypse kaputt gemacht. (Aber trotzdem sehr professionell).
Danke 🙂
Tiff
7. August 2025 — 22:04
Habe ich. Danke sehr. xDDD