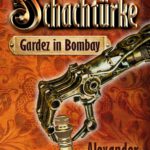April 1889
Wien
In der kaiserlich-königlichen Schatzkammer in Wien lagerten neben vielen anderen Kleinodien auch immer noch die alten Krönungsinsignien des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Die alte Kaiserkrone, der Reichsapfel, das Zepter, das Reichsschwert und natürlich auch die ‚heilige Lanze‘. Es handelte sich hierbei um eine karolingische Flügellanze, in welcher angeblich in einem Spalt in der Mitte ein Nagel von der Kreuzigung Jesu eingelassen und mit Draht befestigt war. Später wurde eine goldene Tülle über diesem Mittelteil befestigt, um die Reliquie vor Beschädigung und dem Verlust des Nagels zu schützen. Angeblich sollte sie bereits Heinrich dem Vogler im Jahre 933 bei seinem Kampf gegen die gefürchteten Magyaren zum Sieg verholfen haben, damals war diese Reliquie eine der wichtigsten Insignien der deutschen Kaiser. Dann war sie von Kaiser zu Kaiser weiter gereicht worden, bis sie schließlich im Schatzhaus der Habsburger landete und dort üblicherweise ein wenig beachtetes Dasein fristete.
Selbstverständlich gehörte normalerweise die gesamte Hofburg, also jener Gebäudekomplex, in welcher auch die Schatzkammer barg, zu den sichersten Orten Wiens. In den Keller, in welchem die wertvollsten Gegenstände lagerten, kam man nur durch eine einzige, gut gesicherte Tür mit zwei Wachposten davor, und auch dahinter sorgten einige gut durchdachte Konstruktionen für einen Alarm in der Wachstube und ebenso in einigen anderen Bureaus. Der Verschluss der eigentlichen Schatzkammer war seit einigen Jahren eine dicke Stahltür, für welche man drei Schlüssel und eine sechsstellige Zahl benötigte, überall standen Posten in den Fluren, welche nicht nur die Schatzkammer, sondern üblicherweise auch Leben und Privatsphäre der kaiserlich-königlichen Familie beschützen sollten, und ein Heer von Lakaien achtete auf jede Unregelmäßigkeit. Normalerweise, denn derzeit wohnte die Familie in Schönbrunn, und die Hofburg wurde renoviert und mit moderner Technik ausgestattet. Daher waren die Posten im Großteil des Gebäudes stark reduziert, und auch die Eingänge konnten verständlicherweise nicht so genau kontrolliert werden. Die Arbeiten hätten endlos gedauert. Also vertraute man den Posten vor der Schatzkammer und den Schlössern.
Es war ein ganz gewöhnlicher Tag in der Wiener Hofburg gewesen, die Renovierungsarbeiten schritten recht gut voran. Nur der Zugang zum Keller war stets abgesichert, überall anders hatten die Arbeiter notgedrungen freien Zutritt gehabt. Jetzt, um achtzehn Uhr, war bereits seit einiger Zeit Ruhe eingekehrt. Die Wachposten am Kellerabgang fanden nichts dabei, während ihrer Dienstzeit ein kleines Schwätzchen zu halten, während sie die Umgebung im Auge behielten. Irgendwie hatten sie sich aber von ihrem Gespräch wohl doch zu sehr ablenken lassen. Denn sonst hätten sie die Gestalten eigentlich bemerken müssen, welche sich näher an die Tür zu jenem Raum schlichen, in welcher der Kellerzugang lag. Zwei davon hoben mattschwarz lackierte Metallröhren, ein leises, unauffälliges Zischen ertönte, und die beiden Posten starben eines lautlosen Todes. Die von Dampfpatronen beschleunigten Pfeilsalven hatte wie unhörbare Schrotladungen ihre Hälse zerrissen. Rasch huschten fünf schwarz gekleidete Personen, ihre Mützen tief in die Gesichter gezogen, zur Tür und zogen die Leichen weg. Aus der Wachstube stürmten nun noch die anderen vier Wächter und wurden mit einem Pfeilhagel aus vier weiteren Dampfdruckpistolen empfangen, deren Besitzer noch vor dem Eingang versteckt gewartet hatte. Dann verbargen sich die Angreifer im Zimmer und behielten die Zugangsmöglichkeiten zu diesem Vorraum im Blick, lautlos, schweigend, absolut professionell. Einer jedoch glitt durch die Tür und ging über die Treppe eine Etage tiefer.
In der Wachstube der Alpinjäger, einer Eliteeinheit der österreichischen Armee, welche in diesem Jahr mit der Bewachung der kompletten Hofburg betraut war, rasselte ein elektrisch betriebener Klöppel gegen eine Glocke. Der Offizier vom Dienst, Leutnant Jablonski, sprang nach einer kurzen Schrecksekunde auf, setzte die Feldkappe mit dem Edelweißabzeichen der Einheit auf und lief in den Bereitschaftsraum, wo ein Zug der Gebirgsjäger in ihren dunkelblauen Wachuniformen bereits fertig angetreten waren, die Waffen in der Hand.
„Die erste Tür zur Schatzkammer wurde von einer oder mehreren Personen passiert“, informierte der Offizier seine Leute. Eigentlich überflüssig, denn wenn die Alarmglocke anschlug, konnten sich seine Männer schon denken, dass keine Einladung zum Tanzcafé anstand. Aber beim Militär wird eben alles fünfmal wiederholt, bis es auch der dümmste Rekrut mit mehr Muskeln als Hirn begriffen hatte.

„Vorsicht, vielleicht sind noch ein paar Männer als Posten zurück geblieben. Kampfbereitschaft herstellen!“ Die Männer kontrollierten ihre Revolver und luden ihre halbautomatischen kurzen Karabiner durch, dann entsicherten sie ihre Waffen. „Also, ohne Schritt, marsch!“
Die Soldaten hasteten wachsam durch den Gang, erst an der Tür zum Vorraum blieben sie kurz stehen, dann sprangen sie mit vorgestreckten Waffen in den Vorraum. Ein Pfeilhagel begrüßte sie, der Gefreite Friedrich Pospischil bekam die erste Ladung aus zwei Pfeilpistolen genau in die Brust, doch die restlichen Posten konnten mit ihren schnellen Bewegungen den Flechettes entkommen und eröffneten ihrerseits das Feuer aus ihren Dienstwaffen. Man konnte sich bei den druckbetriebenen Pfeilpistolen natürlich an keinem Mündungsfeuer orientieren, doch das starke elektrische Licht, welches man in dieser Sektion der Hofburg zuerst eingebaut hatte, löschte alle Schatten und viele Verstecke aus. Es gab nicht viele Möglichkeiten, sich zu verschanzen, und die die Jäger hatten den Heimvorteil auf ihrer Seite. Sie kannten alle Schwachpunkte. Und natürlich auch den getarnten Eingang zum Vorraum, der im Rücken der Angreifer lag. Diese Tür sprang auf, eine Kampfgruppe des Wachzuges beendete das Feuergefecht ohne langes Federlesen. Nachdem die Eindringlinge sich partout nicht ergeben wollten, eben final mit einigen Schüssen aus ihren Revolvern.
„Matzak, nehmen‘s ihre Grupp’n und gehen’s runter“, befahl Jablonski, und der Wachtmeister winkte seine Männer zu sich. Eilig, aber doch vorsichtig näherten sie sich der Schatzkammer, deren Tür immer noch sperrangelweit offen stand.
Es konnte nie ganz geklärt werden, wie der Dieb an alle drei Schlüssel und die Zahlenfolge des Nummernschlosses der letzten Sicherheitstüre gekommen war. Aber irgendwie musste er es geschafft haben, denn er war in die Schatzkammer eingedrungen. Von den verborgenen Alarmgeräten, welche ein Öffnen der Türen meldeten und den im Fußboden versteckten Trittschaltern hatte er aber scheinbar nichts gewusst. Er hatte wohl nicht mit dem schnellen Eintreffen der Truppe gerechnet, sonst hätte er sich mehr beeilt. Vorsichtig lugte der Wachtmeister in den Saal und sah dort die Gestalt eines Mannes, der die Lanze mit dem Nagel vom Kreuz Christi in der Hand hielt.
„Leg‘ die Lanz‘n vorsichtig wieder hin und heb‘ deine dreckig‘n Griffeln in’d Höh‘!“ Die Mündung des schweren Revolvers hielt Matzak genau auf den Eindringling gerichtet, als er die Kammer betrat. Der Dieb richtete die heilige Lanze auf den Wachtmeister, ein greller Blitz löste sich aus der Spitze der Waffe und sprang auf das Opfer über, welches sofort zu Asche verbrannt wurde. Die beiden nächsten dem Unteroffizier folgenden Gardisten bewiesen jetzt aber, dass sie ihre Waffen nicht nur als Schmuck trugen und sie hervorragend ausgebildet waren. Die beiden Revolver knallten in dem engen Raum ohrenbetäubend, die schweren Bleigeschosse aus den 11,2 Millimeter Waffen schlugen deutlich sichtbar in den Körper des Maskierten ein. Der schwankte seltsamerweise nur etwas und versuchte die Lanze trotzdem neu auszurichten, während die Wachsoldaten die Abzüge ihrer Dienstwaffen immer wieder durchrissen und weitere Schüsse seinen Körper trafen. Die kaiserlich-königlichen Soldaten konnten es nicht glauben, auf diese Entfernung von den Revolverkugeln getroffen KONNTE ein Mensch doch nicht mehr leben und sich bewegen. Und trotzdem, wenn auch mit unsicheren Bewegungen und immer wieder durch die Einschläge am genauen Zielen gehindert, versuchte er es immer wieder. Bis ein Treffer genau in die Stirn sein Leben endlich beendete.
„Da wird der Doktor Rauscher aber schön schau’n! Marandjosef! Des war’n gut acht, neun Treffer, des hat man ja gut g’sehen, nah‘ g’nug war’n ma ja d’ran! Und trotzdem hätt‘ des G’frast uns no fast erledigt!“
Der andere hatte die Lanze beiseite gestoßen und betrachtete sie jetzt genauer. „Ich könnt‘ schwören, dass der eing’setzte Nagel vorher g’leuchtet hat. Jetzt aber nimmer, kannst du mir des erklär’n?“
„No, bin i vielleicht der Tesla oder der Mach? I hab‘ ka Ahnung. I was nur, wann i den Schalter umdrah, wird’s hell. Des reicht ma! Völlig!“
=◇=
Von zwei Klemmen gehalten hing die heilige Lanze im neu eingerichteten Labor der kaiserlich-königlichen Akademie. Die klügsten Physiker Kakaniens hatten sich hier eingefunden und betrachteten eingehend die alte Waffe aus der k.u.k. Schatzkammer.
„Und sie sind sicher, dass aus der Spitze ein Blitz getreten ist?“, fragte Gottlieb Adler, der jüngste in der Gruppe, zweifelnd und ging um diese Anordnung herum. „Ich kann mir nicht im Geringsten vorstellen, wie das funktionieren sollte!“
„Herr Professor, der Wachtmeister Matzak ist aber tot, und was von ihm no übrig blieb‘n ist, passt in a Konservenbüchs‘n“, rapportierte der Uniformierte. „In a ganz kleine Büchs’n. Das war ka Einbildung, wirklich net. Und dass der Verbrecher no mit neun Kugeln im Oberkörper versucht hat, uns Andere a no über’n Jordan zu schicken, hab’m wir a net nur tramt. Ganz bestimmt net!“ Zugsführer Müller F. blieb bei seiner Schilderung der Ereignisse, trotz des Zweifels, der ihm von Adler und Boltzmann entgegen schlug.
„Also, Kollegen!“, intervenierte Ernst Waldfried von Mach. „Hacken’s doch nicht dauernd auf dem jungen Mann herum. Es gibt den Aschenhaufen, der exakt der Menge entspricht, die bei der Kremierung eines Menschen übrig bleibt. Mitsamt der völlig zerschmolzenen Dienstwaff‘n. Und der Hofarzt Doktor Rauscher hat festg‘stellt, dass die Kugeln von den Posten sehr viel weniger Schad‘n im Körper von dem Einbrecher hinterlass‘n hab‘n, als zu erwart‘n gewesen wär.“
„Ich versteh’s nicht! Wie soll das denn eigentlich funktionieren? Es gibt keine Batterie oder andere Energiequelle. Wo soll denn da ein Blitz bitte schön her kommen?“ Die Finger Ludwig Boltzmanns strichen über den Schaft. „Ich weiß doch gar nicht, wo ich anfangen und wie ich da etwas untersuchen sollt‘.“
„Versuchen wir einmal etwas, Zugführer.“ Mach drängte den Zugführer Frank Müller zur Lanze. „Sie haben doch g’sehen, was passiert ist. Versuchen sie sich zu erinnern. Nehmen sie die Waffe, richten sie die jetzt auf die Wand dort und versuchen’s so einen Blitz … Aua!“ Er bedeckte seine Augen mit beiden Händen. Ein kräftiger, greller Funken war, gefolgt von donnerndem Krachen, aus der Spitze der Lanze auf die Wand übergeschlagen und hatte dort ein etwa zwei Meter großes und ein Meter tiefes Loch hinterlassen.
„Das glaub‘ ich jetzt aber net, des kann’s ja gar net geb’n“, erstaunte sich Adler. „Geben’s das Ding einmal her, was haben‘s denn jetzt g’macht?“
„Melde, ich hab nur d‘ran `dacht“, salutierte der völlig überraschte Müller.
„Na kolossal! Also, bei mir spielt sich gar nichts ab, es tut sich gar nichts!“ Gottlieb Adler drehte die Lanze in seinen Händen. „Nur eine Flügellanz’n mit Draht und an Någel d’rin. Wie der Kollege Boltzmann schon g’sagt hat, was in drei Teufels Nam‘ kann da schon so an Blitz hervorbringen?“
„Und trotzdem hab’n wir ein Loch in der Mauer“, stellte Viktor von Lang fest und griff nach der Waffe, ein leichtes Leuchten umspielte den Nagel. Er richtete die Spitze an eine Stelle neben dem Loch und konzentrierte sich. Ein Funke sprang über und beschädigte die Farbe der Wand an einer drei Millimeter durchmessende Stelle. „Nun, da ist etwas, aber wohl doch net so stark, wie ich dacht hab‘.“ Lang besah sich die Spitze. „Die naheliegendste Erklärung ist ja, dass wir’s mit einem Wunder zu tun haben. Also müssen wir halt ein Wunder untersuchen und erklär‘n. Fesch, aber na gut, probier’n wir’s halt. Zugsführer, bleiben’s in Nähe, ab jetzt sind’s unser Versuchskarnickel.“
=◇=
In seinem Bureau im Gebäude des Auswärtigen Amtes im Bezirk Landstraße marschierte der Leiter der geheimen Evidenzabteilung Heinrich Fürst zu Hametten unruhig auf und ab.
„Meine Herren, wie hat das gescheh‘n können?“ fragte er mit mühsam beherrschter Stimme. „Neun bewaffnete Männer dring‘n in die Hofburg ein, ermord‘n sechs Männer vom Wachpersonal und liefern sich mit den Alpinjägern ein veritables Feuergefecht, bei dem einer der Unteroffiziere durch – ja, durch was eigentlich? Auf jeden Fall völlig verbrannt word’n ist? Woher haben die Hallodris die Schlüssel und die richtigen Zahlen für das Schloss in der Schatzkammer her g’habt?“
„Das fragen wir uns auch!“ Hugo Fürst von und zu Oderburg, der kaiserlich-königliche Polizeigeneralkommissär, saß auf einem der Stühle und hatte die Hände über dem Stockknauf gefaltet. „Wer hat denn überhaupt die Schlüssel normalerweise?“
„Der Oberschatzmeister hat einen, der Kommandant des Wachzuges trägt einen immer in seiner Gürteltasche, und der dritte ist beim obersten Kammerherren“, zählte der Fürst zu Hametten an den Fingern seiner rechten Hand ab. „Die Zahlenkombination – ja da bin ich mir nicht sicher!“
Oberst Franz Freiherr von der Trankh, der Kommandant der Alpinjäger hatte die Hände auf dem Rücken verschränkt. „Fesch! Und was machen wir jetzt?“
„Die Schlösser sind umgetauscht und die Zahlenkombination geändert! Nicht, dass es auf Dauer viel brächt‘!“ Der oberste Polizist der Vereinigten Donaumonarchien zuckte dich Schultern. „Haben die’s einmal rauskriegt, kriegen sie’s wohl auch ein zweites Mal raus. Aber – wir ermitteln selbstverständlich. Nach allen Richtungen.“
„Haben’s den Hagenbach darauf ang’setzt“, fragte der Leiter des geheimen Abteilung.
„Nein, den Brunner, Sie kennen ihn ja schon, Fürst. Aber jetzt halt noch mit ein paar Leuten mehr. Die Abteilung hat da g’rad einen ganz seltsamen Fall, wo es um den Anschlag auf unsere Prinzessin geht. Und irgendwie – es ist jetzt nur so ein G’fühl, dass das zamhängt, aber ein sehr starkes. Der Brunner glaubt’s auch, und der Mann ist gut! Wirklich gut. Der hat mit seine Instinkt‘ schon mehr als einmal recht g’habt!“
Der besagte Kommissär Brunner war eben mit dem Zivilinspektor Heinz Navratil in der Prosektur des Landesgerichtes in der Sensengasse. Die Leichen aus dem Überfall auf die Hofburg lagen mit Tüchern zugedeckt auf Rollbahren im Kühlraum des gerichtsmedizinischen Instituts der Universität Wien. Johann Auwald, der junge Assistent des Professors Theodor Billroth, deckte ihre Gesichter der Reihe nach ab, und Navratil betrachtete alle genau.
„Also, das ist der Alex, der Alexander Meister“, bekundete er. „
Ich hab‘ ihnen von dem schon erzählt, Herr Kommissär. Das ist einer von denen, die nach dem Petschieren noch so komisch g’redt haben, so von Blitz und Feuer und freies Jerusalem. Heiliger Krieg, Königreich der Auserwählten und so was! Das da ist der Ludwig Dostal, der hat eigentlich nie viel g’sagt, aber der war schon immer ein bisserl unheimlich. Also mir zumindest, aber einige der Frau‘n sind halt auf seine düstere Art und sein komisch’n Blick so richtig abg’fahr’n. Wie ein Zapferl! Aber das der bei sowas mitmacht, das hätt‘ ich mir jetzt nicht unbedingt gedacht. Man lernt halt nie aus. Die andern kenn ich nicht, was aber nichts heißen muss, Herr Kommissär. So lang bin ich ja auch noch nicht dabei, und nicht jeden Abend! Es hat auch schon Veranstaltungen geb’n, da warn nur ganz enge Haberer von der Hintwitz dabei!“
„Schon recht, Heinzi! Hast es bis jetzt eh gut g’macht.“ Brunner legte Navratil die Hand auf die Schulter. „Durch dich hab’n wir schon eine Menge erfahren. Aber ein Glück, dass der Joschi sich doch noch weiter auf dem Herdermarkt herumtrieb‘n hat, ich glaub‘, jetzt hab’n wir einen Grund, das Haus zum Durchsuchen. Du weißt ja, vor Gericht zählt deine Aussage genau elfe. Weil du involviert bist.“
„Ja, mir könnten’s Befangenheit vorwerf‘n. Weil ich die Hintwitz g’vögelt hab!“ Heinz untermalte seine Aussage mit einer obszönen Geste. „Und wegen einer Vorteilsnahme, weil ich dafür im Dienst ein Gerst’l kriegt hab, könnten’s mich auch drankriegen!“
„Und sie könnten dich einnah’n wegen Prostitution ohne Deckel“ ergänzte Brunner. „Oder warst `leicht bei einer Untersuchung, während du dort warst?“
„Beim Polizeiarzt, drei Tag vorher. Jährliche Routine.“
„Der hat aber nicht nach an Kavaliersschnupfen g‘schaut“, wies Brunner auf Navratils Leibesmitte. „Hast noch was wichtig’s bei der Hintwitz herum liegen?“
„Nur die g’fälschten Papierl!“ Heinz Navratil steckte seine Hände tief in die Taschen seines neuen Überziehers. „Arschkalt ist da herin‘. Wie die Leut‘ da arbeiten können!“
„Die Papierl sind wurscht, weil der Heinrich Felber bist ja eh nicht wirklich! Da kannst dich also einfach so von dort über die Häuser hau’n?“
„Schon, aber dann erfahr’n wir ja gar nicht mehr, was da drin vorgeht“, gab Heinz Navratil zu bedenken.
„Egal. Wir werden die Spreu schon noch vom Weiz‘n trennen.“ Auch Brunner versteckte seine Hände jrtzt in den Manteltaschen. „Komm, geh’n wir! Wenn die Adlerstein nicht eine gute Schauspielerin ist und die wirklich nur zum hobeln kommen ist, dann kann uns die vielleicht weiterhelf‘n.“
„Also, ich glaub‘ schon, die ist wirklich nur kommen, dass kräftig herg’nommen wird“, schniefte Navratil. „Aber die Leithfurt, das ist eine von den ganz fanatischen! Wenn wir die brechen könnten, dann hätten wir viel gewonnen.“
„Nicht wir, Heinz“, wehrte Brunner ab. „Du lasst dir jetzt die Haar färben und ondulieren, dazu noch einen veritablen Bart stehen. Bis der lang g’nug ist, darfst Akten schupfen, oder dir Häuser in der Brigittenau anschauen. Aber in die Nähe von Simmering und der Hintwitz-Bande kommst mir nicht mehr. Für die bist weg!“
Das Bureau von Kommissär Brunner in der Kriminalkommission, in welches Arthur Graf Lichtenbach von Bruno Köberl geführt wurde, war nicht eben klein zu nennen, aber eher spartanisch eingerichtet. Sein eigener Drehsessel von Thonet war zwar recht angenehm gepolstert, aber der Schreibtisch und die Aktenablagen waren von der billigen Sorte, und Walter Brunner hatte auch auf einen der schönen Art Deco – Luster verzichtet, welche seit Neuestem so en vogue waren. Er hatte nur eine einfache Kugel aus Mattglas gegen die Blendung über der Göbelbirne.
„Der Herr Graf von Lichtenbach ist da, Herr Kommissär“, rapportierte der Polizeibeamte, während Arthur das Bureau betrat.
„Herr Graf, ich bin hocherfreut, dass Sie gekommen sind“, streckte Walter dem Graf die Rechte entgegen. „Ich bitte, Platz zu nehmen!“
„Ich wüsst‘ nicht, dass ich eine Wahl g’habt hätte“, merkte Lichtenbach an, während er die Hand des Kommissärs schüttelte. „Nicht, wenn mir ihr Unterkommissär eine Vorladung, die vom Polizeigeneralkommissär und einem Richter unterschrieb‘n ist, unter die Nas’n halt‘!“ Köberl half dem Grafen beim Ablegen seines Mantels, dann setzte sich dieser auf den angebotenen Sessel, zog seine Handschuhe von den Fingern und warf sie in seinen Zylinder, den er gemeinsam mit seinem Gehstock dem Beamten Bruno Köberl reichte. „Danke, guter Mann. Also, was kann ich für die Polizei tun?“
„Herr Graf waren vor kurzem bei der Baronesse Klederwald“, begann Brunner mit der Befragung.
„Ja, war ich. Ich hab‘ erfahren, dass meine Tochter in Kairo…“ Die Stimme des Grafen brach, er hob die Hand. „Kleinen Moment bitte, aber es druckt mich noch immer sehr!“
„Bitte Herr Graf. Wir haben Zeit“, beschwichtigte Brunner.
„Geht schon wieder“, fing sich der Graf. „Also, Sabine ist in Kairo erschoss’n worden, und sie hat, bevor sie aus Wien verschwunden ist, immer wieder von der Klederwald g‘sprochen. Und d‘rum wollt‘ ich wiss‘n, was mir die sag‘n kann. Aber die rollerte Häuselkatz‘ hat nur herumg’eiert und kein klares Wort rauslassen. Zu einer Seance sollt‘ ich kommen, um mit dem Geist meiner Tochter zu sprechen! Ich bitt‘ sie, die ist eine Taschlzieherin, aber kein Medium! Und schon gar keine Baronesse. Ich mein‘, mir ist bewusst, dass mit all unserer Technik nicht alles zu erklären ist, und dass es Medien gibt, die wirklich echt sind, ich hab‘ da schon Sachen erlebt…, egal! Sagen wir einfach mit Hamlet, dass es mehr Ding zwischen Himmel und Erd‘ gibt, als die Schulweisheit träumen kann. Aber diesem Weib glaubert ich nicht einmal, wenn sie ihren heiligsten Eid schwört, dass morgen in der Früh‘ die Sonn‘ aufgeht! Erst, wenn ich’s g’sehen hab‘!“
„Und sonst haben Herr Graf nichts mit ihr besprochen?“, vergewisserte sich der füllige Kommissär.
„Sonst gab es nichts zu besprechen, Herr Kommissär“, betonte Graf Lichtenbach. „Ich war weder an einer falschen Seance noch am ausschweifenden Hedonismus dieser Person interessiert.“
Brunner nickte. „Ich hab’s mir fast gedacht. Trotzdem muss ich sie bitten, noch ein wenig zu warten. Soeben ist bei der Baronesse Klederwald eine Hausdurchsuchung im Gange. Vielleicht finden wir etwas vom Fräulein Tochter, und Herr Graf können es identifizieren.“
Graf Lichtenbach nickte ebenfalls. „Ich glaube zwar nicht, dass… nun gut, ich warte! Vielleicht gibt es ja doch eine Spur von meiner Tochter. Oder ein Andenken!“
=◇=
Eine harte Faust donnerte gegen die Tür des kleinen Rokoko – Schlösschens am Herderpark in Simmering.
„Polizei, im Namen ihrer kaiserlich-königlichen Majestät, aufmachen!“
„Was wollen’s denn?“ Adolf Wondraschek, der Diener und Vertraute der Hausherrin öffnete die Tür.
„Hausdurchsuchung!“ Pospischil hielt dem Mann ein Formular vor die Nase.
„Ich frage einmal das gnädigste Fräulein, ob es ihr konveniert!“ Der Mann wollte die Tür wieder schließen, doch ein Stoß des Unterkommissärs ließ ihn zurück taumeln.
„Was soll das heißen, du willst frag‘n, ob’s der Gnädigst’n recht ist, du blöder Hund. Gusch, jetzt red‘ ich!“ Pospischil und sechs uniformierte Polizisten vom Mistelbacher Einsatzkommando hatten sich durch die Tür gedrängt. „Wenn du nicht zu deppert bist, dass’t es kapierst, das da ist ein richterlicher Beschluss, und da hat auch eine falsche Baronesse zu parieren, ohne dass man’s vorher erst fragen muss!“
„Was woll’n sie denn damit sagen, mit dem ‚falsche Baronesse‘?“ Die Hausherrin kam die Treppe herabgeschwebt, gehüllt in duftige, leichte Stoffe, die ihre gute Figur eher betonten als verbargen.
„Guten Morgen, Fräulein Hintwitz!“ Joschi Pospischil lüftete kurz den Hut. „Endlich seh‘ ich sie einmal. Ich mein‘ ohne Verkleidung. Fesches Pupperl, kein Wunder, dass die Kieberer vom Grätzl alle Hühneraugen zudrücken. Aber – wir von der Kommission sind da halt ein klein wengerl anders. Besonders, wenn’s um die Sicherheit der kaiserliche Familie und um die der Donaumonarchien geht.“
Josefine Hintwitz hob lächelnd die linke Augenbraue. „Schau an. Wegen so einer Bagatell‘ machen’s so einen Aufstand? Ich hab‘ mir halt einen Künstlernamen zug’legt? Was geht da gegen die Donaumonarchien? Oder gegen die hohe Familie!“
„Deswegen sind wir nicht da, sondern wegen der ander’n Aktivitäten,“ beschied Joschi Pospischil, während die Polizisten ausschwärmten.
„Ach, sind Seancen und spiritistische Veranstaltungen leicht verboten?“ Fini stemmte ihre Fäuste in die Hüften, das Gewand klaffte auf und zeigte nicht weniger als alles, sogar das sorgfältig enthaarte Venusdelta.
„Nicht unbedingt“, gab Joschi zu. „Das ist auch nicht unser Metier, dafür sind wir nicht zuständig.“
„Dann ist das Rudelpudern vielleicht plötzlich ein Verbrechen g’worden?“, fragte die Dame des Hauses und ging langsam die letzten Stufen der Treppe hinunter.
„Wiederum, nicht unbedingt, und nicht unser Metier. Wir sind nicht vom Strichreferat!“ Joschi musste schlucken, die Josefine war schon ein verdammt appetitlicher Anblick.
„Warum in Dreiteufelsnamen seid’s ihr Kieberer dann da“ schrie die Hintwitz unvermittelt los.
„Weil zwei von deine Wapler heut‘ Nacht in der Hofburg ein’gstiegen sind und ein paar Wachposten umbracht hab’n“, gab Joschi kontra.
„Was heißt, von meine Wapler?“ brüllte Fini Hintwitz. „Wenn zwei von meine Gäst‘…“
„Sei stad! Du hast nicht mit mir zu schrei‘n, klar, du Strichkatz‘!“ Joschi Pospischil hatte plötzlich einen kurzen Schlagstock in der Hand und schlug damit auf ein Tischchen. „Und jetzt darfst reden, aber nicht laut brüllen. Also, wenn zwei von deine Gäst…?“
„Na ja“, die Stimme der Puffmutter klang plötzlich viel ruhiger. „Ich bin doch nicht verantwortlich, was die mach’n, wenn’s bei mir raus sind!“
„Siehst, genau das woll’n wir feststellen“, erklärte der Fesche Joschi. „Wennst nichts damit z‘tun hast, brauchst dich auch nicht aufregen.“
„Und das soll ich dir glaub’n?“ Fini verschränkte die Arme unter der Brust. „Das wär‘ das erste Mal, dass ihr Herrn Kieberer nichts findet’s, wenn’s was finden wollt’s!“
Sie ließ das Gewand von der Schulter gleiten und griff dem Joschi in den Schritt. „Na, was soll’s, einer mehr oder weniger… Was darf’s denn für sie sein, Kommissär? Französisch? Griechisch? Englisch?“
„Gar nichts“, wehrte Joschi ab. „Zieh‘ dir wieder dein Zeug an und mach’s zu. Ich bin nicht wegen einer schnellen Gratisnummer kommen!“
„Aber geh? Ein Kieberer, der eine schnelle Gratisbedienung ablehnt, das hab‘ ich auch noch nie erlebt!“ Sie warf sich in einen bequemen Sessel und spreizte provokant die Beine. „Ganz sicher, Herr Kommissär?“
„Ganz sicher.“ Joschi blieb zurückhaltend und ruhig. „Sagt dir der Name Lichtenbach etwas? Gräfin Lichtenbach?“
„Was? Wieso…“ Die Fini Hintwitz schloss ihre Beine und saß mit einem Mal ganz gerade. „Wie kommst denn jetzt auf die?“
„Also du kennst sie. Das steht schon mal fest!“
„Na ja, ja“, gab die Frau zu. „Sie war ein paar mal bei uns, dann hat’s g’sagt, sie will ins gelobte Land. Ich hab‘ glaubt, damit meint’s die Gegend um Jerusalem, also das Jordanland. Sie hat immer von Messias hier und Erlöser dort g’redt.“ Fini zuckte mit den Schultern, eine Bewegung, die sich durch ihren Busen fortsetzte. „Ich hab‘ da nicht so genau zu’ghört, meine Religion ist eine ganz eine Andere.“ Sie legte die Hand auf ihren Schoß. „Also, wenn’s um Steuerhinterziehung wegen meinem kleinen Freudentempel geht, bin ich voll geständig. Auch wenn’s eigentlich für uns eine Art Gottesdienst ist, und nicht der Bereicherung dient. Aber sonst können’s mir nichts vorwerfen. Was andere tun, dafür bin ich nicht verantwortlich!“
„Aber das Fräulein Lichtenbach war da?“
„Und wie die da war“, bestätigte Fini. „Gar nicht genug hat’s kriegen können von die Männer! Ein Durchhaltevermögen hat’s g’habt, das Madl. Die wär‘ da vielleicht eine stinkreiche Hur‘ g’worden, wenn’s Geld dafür g’nommen hätt. Hat’s aber gar nicht. Und dann war’s auf einmal weg. Tragisch, dass sie dann so einfach in Kairo…, also, was hat’s denn dort überhaupt g’sucht?“
„Wir hab’n uns dacht, das kannst du uns sag’n“, Joschi fixierte das Gesicht der Pepi mit den Augen, keine Muskelzuckung entging seinem Auge. Aber die Hintwitz hatte eine eiserne Disziplin entwickelt, nach dem ersten Schreck hatte sie sich vollständig unter Kontrolle.
„Herr Unterkommissär?“ Der Wachtmeister der Mistelbacher war dazu gekommen, man sah ihm an, wie schwer es ihm fiel, die nackte, jetzt wieder spöttisch lächelnde Frau zu ignorieren, deren Hand im eigenen Schritt spielte. Trotzdem blieb er standhaft und sah Joschi Pospischil gerade an, während er salutierte. „Melde gehorsamst, nichts von Belang gefunden!“
„Danke, Wachtmeister!“ Joschi grüßte zurück. „Gehen wir!“ Dann wandte er sich noch einmal um. „Wir behalten dich im Auge, Pupperl. Bleib‘ brav!“ Fini Hintwitz wartete, bis sich die Türe hinter ihrem Besuch geschlossen hatte, ehe sie aufsprang und die Vase vom Tisch neben sich gegen die Wand schmetterte. Dann brüllte sie unartikuliert ihre Wut heraus!
Die Mistelbacher in ihrer grünen Uniform stiegen vor dem Haus in ihren Dampfbus.
„Soll’n wir sie noch mitnehmen, Herr Unterkommissär?“ fragte der Unteroffizier der Truppe, Joschi Pospischil nickte erfreut.
„Gerne, Wachtmeister. Habt’s ihr auch eine schöne Unordnung hinterlass’n?“
„Schaut aus, als hätt‘ eine mittlere Artilleriegranat’n eing’schlagen“, grinste der Unteroffizier. „Ganz so, als hätt’n wir wirklich was g’sucht.“
„Ja, aber so blöd wird’s ja auch nicht sein, die Pepi. Belastendes Glumpert hat’s sicher nicht so herumliegen lassen!“
Der Wachtmeister lachte. „Eher außehängen und hergezeigt. Mir wären wirklich fast die Augen außeg’fallen. Sitzt de Katz splitterfasernackert mit breit g’spreizten Hax‘n im Zimmer herum, zeigt wirklich alles mit ihrem rasierten Spalterl, spielt an sich herum und grinst noch dazu. Ich bewunder‘ ihr‘ Beherrschung, Kamerad!“
„Brom, mein lieber Wachtmeister“, gestand der Joschi. „Schlappofix in den Tee, und der Has‘ kann mach’n, was er will, es rührt sich nichts in der Hos’n! Alter Trick vom Strichreferat, der Unterkommissär Bauer von dort hat mir ein paar heiße Etses g‘steckt. Hat auch ganz gut klappt!“
„WONDRASCHEK!“ Fini Hintwitz stampfte immer noch wütend mit dem Fuß auf. „Wo bleibst denn, du Trottel!“
„Frau Baronesse?“
„Es hat sich ausbaronesst, Wondraschek“, schimpfte die Prostituierte laut. „Die G’schmiert’n sind hinter den Schmäh‘ g’stiegen! Jetzt werden mir die Arschlöcher bestimmt auch noch die Finanz auf den Hals schicken, und das Strichreferat vielleicht auch noch. Na, gut. Die Sitzungen geh’n weiter, die Rudelbumserei‘n auch, aber der Leithfurt und dem Wölbling müss’n wir sag’n, dass sie sich zurückhalt’n müssen mit ihrer Agitation. Bis die Sach‘ sich wieder beruhigt hat! Ist der Heinzi derweil z’rück kommen?“
„Nein, Gnädigste, der Felber ist nicht mehr Heim gekommen.“
„War der Arsch vielleicht doch ein Kieberer?“, keppelte die Hintwitz. „Wenn mir der noch einmal in die Händ‘ kommt! Dem dreh‘ ich den Hals auf Kragenweite null!“
=◇=
Seit Jahren war Ludwig Liberkowski bei der Polizei von Wien als Kanzlist, also als Kanzleischreiber, angestellt. Der Vickerl war ursprünglich aus Berlin, und daraus machte er auch kein Geheimnis. Dass er die Vertrauensstellung erhalten hatte, grenzte schon an ein Wunder, aber Ludwig hatte es verstanden, durch Fleiß und Einsatz das Vertrauen seiner Vorgesetzten zu erhalten. Jeden Tag gingen dutzende Akten über seinen Schreibtisch, um kopiert oder auf der Maschine ins Reine getippt zu werden. Einige Worte hatten in aufmerksam werden lassen. Ein Giftanschlag auf die Prinzessin, ein Mord in Kairo an einer jungen Adeligen, im Zusammenhang mit einem Ahmed alMasr, verdächtig auch ein Goldener Frühling. In Triest auch ein Verbrechen, das neueste Flugschiff, höchste Beamte involviert und Hinweise auf eine Art Bordellbetrieb, der von höchsten Kreisen besucht wurde und irgendwie verdächtig war. Auch er trug den Namen Goldener Frühling. Er beschloss, seinem Vorgesetzten davon Meldung zu machen. Zuerst natürlich dem Polizeigeneralkommissär Fürst von zu Oderburg. Und dann auch noch per codierten Brief nach Berlin an seinen zweiten Chef. Adressiert an den Oberst von Donnersmark .
=◇=
„Äxtrablaaatt! Raubüberfall in der Hofburg! Äxtrablaaatt! Des Neuestää in da Årbeidazeidung! Das neue Äxtrablaaatt!“ Die Zeitungskolporteure machten gut bezahlte Überstunden!
„Eeeextrablått, meine Herrschåften. Dreister Ånschlåg auf dås Ållerheiligste der Monårchie. Lesen’s in der Reichspost auch eine Stellungsnåme des Kardinalerzbischofs! Eeeextrablått!“
„Sonderrrausgabe derrr Neuen frrreien Prrresse! Spiritistischerrr Zirrrkel im Verrrdacht, in den bewaffneten Überrrfall in derrr Hofburrrg beteiligt zu sein! Die Neue frrreie Prrresse!“ Die zumeist minderjährigen Zeitungsbuben auf dem Michaeler Platz und dem vom Graben dorthin führenden Kohlmarkt überschrien sich förmlich. Der beleibte Mann mit dem langen, dünnen Schnurrbart und dem vor der Brust spitz zugeschnittenen Kinnbart winkte einen von ihnen zu sich.
„Ein Extrablåt der Reichspost, der Herr? Måchert dann vier Kreuzer!“
„Passt schon!“ Der Arzt und bekannte Wiener Dramatiker Arthur Schnitzler gab dem Jungen eine Fünf-Kreuzermünze.
„Dånk‘ auch schön, Herr von Schnitzler! Eeeextrablått! Eeeextrablått! Die Reichspost erklärt! Eeeextrblått!“
„Na fesch“, murmelte Arthur vor sich hin. „Jetzt wird schon in die Hofburg und die kaiserliche Schatzkammer ein’brochen. Die Welt wird immer verrückter! Ah, Siegmund, hast es schon g’lesen? Die Kammer mit den Reichsinsignien.“
Freud wedelte mit einem Exemplar der Neuen freien Presse und der Arbeiterzeitung! „Selbstverständlich, Arthur. Sogar die Rot’n sind ganz aufgeregt über das kapitale Verbrech‘n. Sie setzen ‚vorderhand jede Kampfmaßnahme aus, welche die Kräfte der Polizei binden und so die Aufklärung des Verbrechens verzögern könnte‘, Originalton der Arbeiterzeitung. Weil’s in letzter Zeit so viele Kampfmaßnahmen geb’n hat, seit der Franz Karl die Reformen ang’fangt hat. Und seit der Adler Bürgermeister word’n ist schon gleich gar nicht mehr. Nicht einmal den kleinsten Streik! Ich mein‘, ja, wir sind vom Ideal noch weit entfernt, aber auf einem guten Weg. Das seh’n sogar die Damen und Herren Sozialdemokraten ein, darum sind’s ja jetzt so Kaisertreu g’worden!“ Beide Herren gingen gemeinsam weiter, in stillschweigender Vereinbarung hatten sie das gleiche Ziel. Das Griensteidl selbstverständlich, Treffpunkt der Kunst- und Kulturszene Wiens.
Die Einrichtung des Griensteidls war eine für die damalige Zeit in Wien durchaus übliche für ‚Das zweite Wohnzimmer‘ der Wiener. Kleine, runde Tische und mit Samt überzogene gepolsterte Sessel, im Griensteidl ganz im Stil der Bugholzmöbel Michael Thonets. Nicht ganz so üblich waren die alten Deckengewölbe und der Wandschmuck. Die Bilder an der Wand waren durchwegs Originale, denn selbst bereits renommierte Maler zahlten ihre Zeche gerne mit einem Gemälde. Auch Gustav Klimt, der die Neugestaltung der Deckengemälde in der kaiserlichen Hermesvilla in Lainz übertragen bekam. Der Preis seiner Bilder war, typisch österreichisch, auf ein vielfaches gestiegen, als der Auftrag von allerhöchster Stelle bekannt wurde und würde wohl in astronomische Höhen steigen, wenn er starb. Etwas derb vom Volksmund ausgedrückt: wenn du in Österreich berühmt und erfolgreich werden willst, dann musst am Zentralfriedhof liegen. Susanna, die Witwe des 1888 verstorbenen Gründers Heinrich Griensteidl, hatte wohl ein gutes Geschäft mit Klimts Bildern gemacht. Auch im Café waren die Herren bereits eifrig mit dem Studium der verschiedensten Extrablätter beschäftigt, und es war nicht weiter verwunderlich, dass Felix Salten die Arbeiterzeitung las.
„Grüß dich Gott, Sziga“, warf sich Arthur Schnitzler auf seinen Stammplatz, und auch Sigmund Freud nahm am üblichen Tisch Platz.
„Nix mähr Szigå“, Salten holte einen amtlichen Zettel aus der Tasche. „Bittä sähr, bin ich seit heite gånzä Ästärreicher! Mit Brief und Siegel ist mein Namä seit heutä Felix Salten und ich bin kein Ungår mähr, sondärn Gäsamtösterreichär!“
„Gut g’macht, Felix!“ Arthur reichte dem Jüngeren die Hand. „Freut mich für dich, jetzt wirst du es viel leichter haben mit der Schriftstellerei. Wie weit bist denn?“
„Na, von där Mutzänbachär sind die ärstän Kapitäl schon färtig und värkaufän sich, wie du gäsagt hast, untär däm Tisch schnällär als warmä Sämmeln! Und bei dir, Arthur?“
„Ach, ich schreibe g‘rade auch an einem kritisch’n Stück, das ‚Märchen‘. Ein Mädel, dass von ihrem Verlobten verstoß‘n wird, weil’s schon einmal eine Beziehung g’habt hat.“
„Ja, da sind’s schnell bei der Hand‘ mit den Verurteilungen, die Herr‘n, aber selber gehen’s mit den Mädels aus, auch wenn’s schon verheirat‘ sind! Bei den Herr’n alles in Ordnung? Der Franz kommt gleich, gell!“ Die Chefin des Hauses machte seit vorigem Jahr die Honneurs bei den Gästen, und der Ober Franz stand bereits hinter ihr.
„Einen schwarzen für den Herrn Schnitzler, einen Cognac für den Herrn Freud und einen G’seichten mit Trebernem für den Herrn…“
„Saltän, Härr Franz. Seit heutä offiziäll!“
„Alsdann, für’n Herrn Salten. G’schamsta, die Herren! Piccolo, wie immer an Tisch fünf!“ Der Oberkellner verbeugte sich noch einmal und entfernte sich dann.
„Habt‘s ihr schon gäläsen, was in där Prässä stäht?“ Felix Salten hatte die Arbeiterzeitung zur Seite gelegt.
„Irgend so ein spiritistischer Zirkel soll bei dem Überfall auf die Hofburg involviert gewesen sein. Seancen als Tarnung für Spionage“, erzählte Freud.
„Nur für wen sie spioniert haben sollen, verschweigt uns die Presse“, ergänzte Schnitzler. „Trotzdem, ich erinnere mich an eine kurze Meldung im Reichsblatt, dass auch in Triest eine ähnliche Organisation in Verbindung mit einem versuchten Diebstahl des neuesten Flugschiffes der kakanischen Flotte genannt wurde. Hallo, Gustav. Verschlägt es dich aus den deutschen Landen wieder einmal in deine Heimat?“ Der Mann mit dem wirren Wuschelkopf und der schmalen Brille winkte Arthur zu. „Meine Freunde, ich darf euch Gustav Mahler vorstellen, ein Dirigent und Komponist, der seinesgleichen sucht. Gustav, das ist Siegmund Freud, und Felix Salten, von seinen Büchern wird noch die Welt sprechen!“
„So schlüpfrig“, wandte sich Mahler an den Autor, der ein wenig rote Ohren bekam, während Freud laut auflachte.
„Der Mann g’fallt mir, Humor, gepaart mit der Einsicht, dass Sexualität die absolut antriebsstärkste Kraft im Universum ist. Wenn der Tesla die anzapfen könnt‘, würden wir locker zu die Stern‘ reisen können!“
„Ich stell’s mir g’rad vor“, Schnitzler schloss die Augen. „Eine Horde Männer sitzt in einer Art Theater, ein paar Kabel um den kleinen Prinzen gewickelt, auf der Bühne ein paar heiße Hasen, die alles zeigen, und dann aus dem Sprachrohr der Kapitän ‚Strengt’s euch mehr an, Mädels. Der Thommy setzt zum Überholen an, wir brauch’n mehr Kraft! Weg mit den Rockerln, dass man eure Busch’n und Hintern richtig gut sehen kann!‘ Ob Jules Verne auch einmal so etwas geträumt hat?“
„Vielleicht solltäst du einä Novällä darübär schreibän, Arthur. Ich sähä schon das Titälbild. Die Säxnovällä, und auf däm Bild nackte Damän vom Parisär Moulin Rouge beim Cancan“, lachte Salten, und auch Sigmund Freud schmunzelte.
„Ja, schon recht, lacht’s nur, ihr werdet’s schon noch seh’n, dass ich recht hab!“
=◇=
„Warum soll’n wir jetzt eigentlich die Gosch’n halten? Für was mach’n wir denn das ganze Rudelbumsen eigentlich noch, wenn wir eh keine Leut‘ mehr für den Messias und die Befreiung von Jerusalem anwerben dürfen?“ Susanne Baronin Leithfurt war gar nicht erfreut, plötzlich während der Runden des Goldenen Frühlings nicht mehr über ihr Lieblingsthema sprechen zu dürfen.
„Auf einmal wirst‘ prüde, Susi?“ Maximilian, der Ritter zu Wölbling grinste Susanne an, die ihm die Zunge herausstreckte.
„Wir machen damit weiter, weil wir einen ordentlichen Batzen Gerst’l brauchen, Susi!“ Pepi Hintwitz seufzte. „Unsere Unternehmungen da in Wien, ein paar Leute, die die wirkliche Dreckshacken für uns, also die vom Frühling, machen sollen, unsere Soldaten müssen ausgerüstet werden, damit’s in Jerusalem net mit Stana schmeißen müssen, Munition für die Krach’n muss auch finanziert werden… Glaub’s mir, so a wirklich veritable Revolution verschlingt Unsummen, damit’s richtig gelingt und am Schluss net wieder andere, falsche Habschis ganz oben sitzen. Ja, wenn wir ehrlich sein wollen, wir alle da in dem Haus geh’n für unsere Überzeugungen auf‘n Strich, und wir lassen die ander’n zum Bezahlen von die Rechnungen der Revolte blech’n. Aber bis jetzt hab‘ ich nicht den Eindruck g’habt, dass dich stark zum vögeln hast überwinden müssen, Susi!“
„Na ja, es hat schon auch ein ganze Menge Spaß g’macht“, gab Susanne zu. „Irgendwie ist der Sex mit meinem Baron nicht wirklich das Gelbe vom Ei, der kleine Patschachter bringt mich einfach net und net richtig zum jodeln! Und abknicken tut er ihm auch dauernd viel zu früh.“

„Na dann!“ Pepi hob die Augenbraue und nippte übertrieben geziert an ihrer Kaffeetasse, den kleinen Finger abgestreckt. „Dann ist ja eh gut, wenn wir weiter die Haxen breit machen, damit kommen alle auf ihr‘ Rechnung, sogar du! Und wenn sich der Staub wieder g’legt hat, können wir ja auch wieder rekrutieren.“
„Ich fürcht‘, des können wir uns nicht nur in der nächst‘n Zeit aufmalen!“ Der Diener Adolf Wondratschek legte einen Stapel Zeitungen auf den Tisch. „Die Neue freie Presse nennt uns beim Namen und bezichtigt uns, am Schlamassel in der Hofburg beteiligt zu sein.“
„Verdammter Scheißdreck“, fluchte Pepi los. „Das hat‘ uns noch g’fehlt! Ob der depperte g’hazte Kieberer dem Shmir an Zund geb’n hat!“
„Wie komms’t drauf, dass er Arsch mit Ohren mit den Fingern Stahl kochen kann“, fragte Susanne nach.
„Weil er mi ang’schaut und kan hochkriegt hat! So was geht nur bei an Thermofratenser!“
„Trotzdem können wir jetzt einpack’n“, folgerte Maximilian.
„Gar nix müss’n wir“, Pepi Hintwitz beruhigte sich wieder. „Es wird‘ nur länger dauern. In der nächst’n Zeit werd’n uns die Kunden die Tür einrennen, weil’s aus erster Hand wissen wollen, was bei uns los ist. Bei den Seancen werd‘ ich vorsichtiger mit meinen Aussagen sein, und sonst liegt‘s an uns, dass die Leut‘ glauben, dass wir zwar ein seltsames, aber nur ein Puff sind. Ein Puff, wo halt auch Damen einen Herren buchen können! Also dann, macht’s mir keine Schand‘, bis auf weiteres ist halt des G’schäft im Vordergrund! Des Geld können wir und der Frühling ganz gut brauch’n!“
=◇=
Walter Brunner, seines Zeichens Kommissär bei der Kriminalkommission in Wien und derzeit Leiter bei einer wirklich großen Sache, hatte trotzdem auch eine zweite Seite, welche manchmal ihr Recht forderte. Also, eigentlich jeden Tag. Walter Brunner war nämlich ein ausgesprochener Genussmensch. Derzeit kochten auf seinem Herd ein paar Erdäpfel und in einem zweiten Topf eine gehörige Portion Sauerkraut. Brunner selbst hatte ein langes, scharfes Messer in der Hand und würfelte durchzogenen Bauchspeck, ein Häufchen Zwiebeln lag bereits frisch geschnitten auf dem Brett. Fritzi Haber, die dünne Angestellte der ÖDLAG, öffnete eine Flasche blauer Portugieser und goss zwei Gläser ein, von denen sie eines dem Kommissär reichte.
„Prost, Walter!“ Der legte das Messer beiseite und nahm das Glas entgegen.
„Danke, Fritzi, dir auch.“ Er küsste sie rasch, aber intensiv, daran hatte sie durchaus Gefallen gefunden und erwiderte den tiefen Kuss sogar, und das gerne und mit Hingabe. Das Fräulein Haberl war schon ein wenig angetaut, dem dicken Brunner mit den riesigen Pranken hätte man so viel Zartheit gar nicht zugetraut. Jetzt war der Speck fertig geschnitten, und Walter Brunner holte aus dem Kühlschrank eine Schüssel mit Grammeln, die er am Vortag aus einem schönen Stück Bauchfilz ausgelassen hatte, das frische Schmalz stand gleich daneben. Er griff in die Grammeln und nahm ein Stückerl heraus, hielt es der Fritzi hin, die es vorsichtig mit den Lippen nahm.
„Das war sicher eine gut g’fütterte Sau, des schmeckt ja hervorragend!“
Der Kommissär naschte rasch auch noch eine Grammel. „Der Seiler hat seine Schweindln auf der Simmeringer Had steh’n und schlagt’s noch selber ab. Da kommt eben eine gute War‘ zu stand‘.“ Er stellte eine Pfanne auf den Herd und gab einen guten Esslöffel Schmalz dazu, wartete, bis das Fett heiß war und warf die Zwiebeln hinein. Die glasigen Zwiebelstückchen kamen zu den Grammeln, und Brunner stellte das Gemenge vorderhand beiseite. Dann stach der die Erdäpfel, um ihre Weichheit zu prüfen.
„Die sind soweit!“ Er schützte seine Hände mit dicken Lappen, nahm den Topf vom ganz modernden Teslaherd, kippte das Wasser ab und ließ kaltes Wasser über die Kartoffeln fließen.
„Also, diese neue Technik und die neu gebauten Wohnungen haben schon ihre Meriten“, philosophierte er. „Gehst einfach zum Waschbecken, drehst das Wasser auf und schon kommt’s kalt oder warm in die Küch‘ oder ins Bad. Keine Bassena mehr am Gang, kein langes anfeuern von einem Holzherd.“ Rasch und mit flinken Fingern schälte er die goldgelben Erdäpfel, schnitt sie klein und legte sie für’s erste in eine Schüssel, während er weiter sprach. „Auch wenn mir ein paar von den alten Weibern schon ein bisserl leid tun, mit wem solln’s denn jetzt ohne die Bassena die Nachbarn ausrichten?“ Dann holte er die Presse hervor, zerquetschte die Kartoffelstücke und vermengte sie mit Salz, Mehl, Grieß, ein wenig Fett und einem Ei zu einem geschmeidigen Erdäpfelteig, den er mit nassen Händen portionsweise aus der Schüssel holte und damit die Grammelmasse umgab. Die so entstehenden Knödeln warf er nachher in kochendes Wasser, nahm rasch zwischendurch noch einen Schluck von dem guten Rotwein aus Grinzing. Er zog die Haberl Fritzi kurz an sich und küsste sie noch einmal, dann briet der die Speckwürfel scharf an, warf sie zum Sauerkraut und warf in das gleiche Fett mit Mehl panierte Zwiebelstreifen, bis sie braun und knusprig waren. Die Knödel schwammen auf, als sie fertig waren, und Walter Brunner holte sie mit einem Stielsieb aus dem Wasser. Er ließ sie kurz abtropfen und legte sie auf zwei Teller, oben auf die Knödel kamen die gebratenen Zwiebeln. Dann häufte der Kommissär Sauerkraut dazu und brachte beide Teller zum Tisch.
„Einen guten Appetit, lass es dir schmecken“, wünschte er.
Nach dem schon ein wenig üppigen Essen kredenzte der Kieberer noch einen guten Slivovitz für die Verdauung.
„Walter, sag‘ einmal – wir kennen uns jetzt schon ein Monat.“ Fritzi zeichnete mit ihrem Glas Muster auf dem Tisch. „Du kochst für mich, wir schmus‘n ziemlich viel, aber sonst hast mich noch nicht angriffen. Net einmal die.. na, da oben halt. Jetzt weiß ich net so richtig, reicht dir das wirklich? Ich mein‘, du bist so lieb zu mir, aber ich – ich will, dass du auch ein bisserl auf deine Kosten kommst.“
„Traust dir das denn wirklich schon zu, dass du dort hin greifen willst?“ Walter Brunner fragte ganz vorsichtig und leise, Fritzi senkte den Blick.
„Mit die Händ‘? Schon. Mich begrapschen lassen, ich weiß nicht wirklich, aber – woll’n wir’s probieren? Vorsichtig?“ Sie knöpfte ihre Bluse auf und zog sie aus. „Vielleicht einmal darauf beschränkt? Für heut‘ einmal?“
Brunner nickte. „Ich werd‘ mich bemühen. Sag’st es halt gleich, wenn’s zu viel wird!“ Die Pranken des Kommissär wölbten sich überraschend zart um die Oberweite der Fritzi und spielten mit den Knospen, während sie zögernd seine Hose öffnete und ihre Hände nach seiner Anleitung einsetzte.
„Na bumm, jetzt müssen wir aber einen ordentlichen Waschtag einlegen. Mit der Hos’n und dem Hemd kannst nicht mehr zum Dienst geh’n, so viel steht schon einmal fest. Und ich mit dem Rockerl auch nicht!“ Sie küsste ihn noch einmal innig, ehe sie sich von seinen Knien erhob. „Zieh’s aus, dann wasch’n wir’s gleich und sie sind bis morgen trocken, dann können wir’s bügeln. Und ich glaub fast, ich muss bei dir übernachten, weil in der Unterwäsch‘ kann ich ja doch schwer heimfahr’n. Net einmal in einer Droschk’n!“
Er schüttelte noch schwer atmend den Kopf. „Tut mir leid, da hat sich halt ganz schön was ang’sammelt.“
„Komm jetzt, geh’n wir unter die Dusch, dann wasch’n wir das G’wand aus. Aber nächst‘s Mal sollt‘n wir uns vorher auszieh‘n.“
„Du meinst, es gibt für uns wirklich ein nächstes Mal?“
„Ganz bestimmt, Walter, ganz bestimmt. Und wir werd‘n uns langsam weiter vortast‘n. So zart, wie du warst, bin ich zuversichtlich, dass wir’s irgendwann auch einmal richtig miteinander mach’n können.“
=◇=
Lalibela
Die Kathedralen von Lalibela in Abessinien waren wirklich einzigartig auf der ganzen Erde. Die Bewohner der Stadt hatten diese Kirchen, welche von der Größe und Ausstattung kaum den Vergleich zu europäischen Gotteshäusern scheuen mussten, nicht wie üblich von unten nach oben in die Höhe gebaut, sondern von oben nach unten in den felsigen Boden gegraben und ausgehöhlt. Die meisten dieser Felsenkirchen besaßen einen kreuzförmigen Grundriss, den eines Kreuzes mit vier gleichen Armen, welches nicht an die Hinrichtung Jesus erinnern sollte, sondern das Treffen des himmlischen mit dem irdischen symbolisierte. Der größte Schatz der Stadt, eines der Zentren der abessinisch-orthodoxen Religionen, waren die vielen Schriftrollen, unter anderem das Evangelium der Salome, welches vom Verrat des inneren Kreises der Schüler und der Flucht der Familie des Messias, des Gesalbten Lehrers Jeshua – Jesus – erzählte. Er war mit seiner Frau Mirjam aus Magdala – Maria Magdalena – nach Alexandria geflohen, wo sein Sohn Joseph wiederum eine Maria heiratete, welche ihm in dieser einige Kinder schenkte, während der Lehrer mit Maria Magdalena und einigen Getreuen weiter zog.
Henrietta Jones hatte sich in einer Studierstube in einem der Klöster in ihre Arbeit vergraben, um eine akkurate Übersetzung herzustellen. In diesem Zweig der Orthodoxen Kirche war die Enthaltsamkeit eine freiwillige, und die Nonnen lebten mit den Mönchen unter einem Dach. In getrennten Zimmern natürlich, aber die allgemeinen Räume wurden von beiden Geschlechtern benutzt. Maria Sophia begab sich in die Telegraphenstation, welche von der k.u.k. Post und Telegraphenverwaltung des Grafen Wilczek auch hier in Äthiopien betrieben wurde. Abessiniens Negus Negest Yohannis IV war alles andere als ein rückständiger Fürst, er hatte alles daran gesetzt, seinem Land die Segnungen des Dampfzeitalters sowie des elektrischen Stroms zuteil werden zu lassen. Dazu gehörte auch ein ausgedehntes Netz aus Telegraphenstationen, welches allerdings nicht von Äthiopien selbst betrieben wurde, sondern vorderhand noch im Besitz der k.u.k. PTV unter dem Grafen Wilhelm Xaver Wilczek blieb. Der kakanische Staat hatte von Abessinien für den Ausbau des Netzes nur wenig Geld verlangt, dafür wollte er jetzt noch am Nachrichtenverkehr ein wenig verdienen. In der Zwischenzeit bildete die kaiserlich-königliche Post abessinisches Personal für den späteren Betrieb aus, insgesamt ein für beide Seiten einigermaßen vorteilhaftes Geschäft.
Wie alle erwachsenen Mitglieder der kaiserlich-königlichen Familie beherrschte natürlich auch Maria Sophia das Familienalphabet über die Morsetaste mit den verschiedenen internen Codierungen, so dass sie sich im Telegraphenbureau leicht über die neuesten Entwicklungen informieren und auch noch ein paar private Signale mit ihrer Mutter wechseln konnte. Der Obertelegraphenwart Oskar Höbsch bekam glühende Ohren, als er den lauten Fluch der Prinzessin während des Empfangs einer bestimmten Nachricht mit anhören musste. Nicht, dass der Wart sonderlich zart besaitet war, aber eine solch derbe Ausdrucksweise aus einem derart hochwohlgeborenem und zudem weiblichen Mund zu hören, das überraschte ihn allerdings sehr. Dass die höchste, von einem gewissen Nimbus und einer Glorie umgebene Familie derart ausfällige Ausdrücke kannte und in den Mund nahm, zerstörte sein Weltbild zwar nicht völlig, beschädigte es aber doch ziemlich stark. Er beschloss jedoch bei sich, niemandem etwas davon zu erzählen. Niemand, wirklich niemand würde ihm das glauben! Dass eine Prinzessin, und sei sie noch so volksnahe, derartige Ausdrücke überhaupt kannte, geschweige denn benutzte, war schlichtweg unmöglich. Undenkbar. Und das noch dazu in fünf verschiedenen Sprachen.
=◇=
„Auf ein Wort unter Männern, Herr Maerz!“ Oberst Wilhelm Graf von Inzersmarkt war an den Tisch des im Vorgarten eines Lokals sitzenden und müßig die Straße betrachtenden Carl Friedrich Maerz getreten.
„Aber gerne. Nehmen sie doch Platz, Herr Oberst!“ Maerz winkte der Bedienung. „Noch einen Tee mit Minze für mich, und für sie?“
„Schrecklich‘s picksüßes Zeug‘s!“ Inzersmarkt schüttelte sich. „Einen doppelten Kaffee für mich, bitte! Schwarz, kein Zucker.“
„Also, Herr Oberst, in einer Hinsicht muss ich sie sofort und auf der Stelle enttäuschen. Auch wenn es in meinen Büchern so manches Mal vielleicht anders erscheinen mag, ich bin nicht an Männern interessiert, sondern ausschließlich an Frauen. Zumindest, was diese eine ganz spezielle Sache angeht.“
„Das hab‘ ich schon befürchtet!“ Der Oberst hob abwehrend die Hand. „Nein, nicht was sie jetzt vielleicht denk‘n, das war missverständlich und unglücklich aus‘drückt. Herr Maerz, sie haben eine sehr – sagen wir einmal, eine sehr lockere Umgangsform, was die Beziehung zur Erzherzogin angeht. Sie ruf‘n die Prinzessin Mary und duzen sie!“
„Das ist richtig, Oberst.“ Maerz nahm einen Schluck von seinem Tee. „Auf direkten Wunsch der Dame, muss ich hinzufügen.“
„Darf ich frag‘n, woher sie ihre Hoheit eigentlich kennen? Ich hab‘ da was von Neu Mexiko g‘hört.“ Gespannt zuhörend schwenkte der Oberst endlos seinen noch zu heißen Kaffee.
„Auch das stimmt“, bestätigte Maerz. „Sie war damals ein liebeskranker Teenager, ein richtiger Backfisch, der sich mir im Luftschiff RMS NIAGARA nach Dallas in Texas als Maria Burger vorgestellt hat. Als ich von ihrer wahren Identität erfahren habe, ritten wir bereits durch die Wüste, und sowohl das Du als auch der Rufname sind damals eben geblieben. Bei unserem Wiedersehen in Ägypten, welches übrigens auf Einladung und Wunsch der Regentin der Vereinigten Donaumonarchien stattfand, habe ich sie zuerst geziemend angesprochen. Aber sie bestand darauf, die alten Formen wieder aufzunehmen.“
„Ich verstehe. Herr Maerz, hab‘n sie eigentlich – ich meine, damals, war da…, also, ist da etwas irgendwas b’sonderes vorg‘fallen!“
Maerz lachte laut auf. „Entschuldigen sie, dass ich jetzt gelacht habe. Es ist sogar eine ganze Menge damals vorgefallen, Herr Oberst, ich könnte tagelang erzählen. In meinem Werk habe ich einiges stark kürzen und umschreiben müssen. Aber wenn sie mich fragen wollen, ob ich damals mit der Prinzessin etwas intimes, etwas sexuelles hatte, kann ich mit Fug und Recht nein sagen. Es lief nicht das Geringste zwischen uns in dieser Richtung.“
„Das beruhigt mich jetzt etwas, Herr Maerz.“ Inzersmarkt holte eine Zigarre aus der Tasche und suchte nach Streichhölzern.
„Wie gesagt, die Prinzessin war damals noch ein ganz junges Mädchen, und wenn ich ehrlich sein soll, hatte sie zu dieser Zeit auch weit mehr Interesse an meinem Blutsbruder K’ááTo.“ Maerz holte sein Präriefeuerzeug heraus und hielt dem Oberst die Flamme entgegen. „Sie müssen jetzt nicht gleich so erschrecken, Herr Oberst. K’ááTo war zu jener Zeit selber ganz schwer verliebt – in Tłéé’nł-ch’i, seine spätere Frau, und er ist für die Reize jeder anderen Frau, und sei sie noch so schön gewesen, völlig unempfänglich gewesen. Und außerdem war und ist K’ááTo kein dummer Wilder, sondern ein Ehrenmann durch und durch, wie ich ihn unter meinen eigenen Landsleuten nur sehr, sehr selten getroffen habe. Er hätte die seelische Ausnahmesituation eines jungen Mädchens niemals unfair ausgenützt.“
„Aber wenn ihre Hoheit damals nicht in ihr‘n Freund verliebt g‘wesen wär‘? Hätten‘s dann… nun, wären‘s dann bereit g’wesen, mit ihr… Sie wiss‘n schon!?“
Maerz lehnte sich zurück und schloss die Augen. „Herr Oberst, das ist eine verdammt leicht gestellte, aber schwer zu beantwortende Frage. Einerseits war sie zu dieser Zeit ein emotionell noch nicht ganz erwachsenes Mädchen, andererseits aber körperlich eine voll erblühte und noch dazu sehr schöne Frau. Ich will jetzt ganz ehrlich sein, ich weiß es nicht. Es hat sich damals ab und zu schon etwas in meiner Hose gerührt, wenn ich sie angesehen habe, das muss ich offen zugeben. Und nachdem wir damals kaum einmal ein Badezimmer zu Verfügung hatten, sondern mit Flüssen und Seen vorlieb nehmen mussten, habe ich sie auch schon einige Male ohne Gewand gesehen.“ Oberst von Inzersmarkt bekam plötzlich einen Hustanfall. „Sie hat sich nicht versteckt, Herr Oberst, niemals. Und ich habe sie zwar nie heimlich beim Baden beobachtet, aber ich war auch nicht blind. Tut mir leid. Aber um auf ihre Frage zurück zu kommen, ob ich meinem Drängen wirklich nachgegeben hätte? Ich kann es nicht ausschließen, ich war damals auch noch ein relativ junger Mann. Also, ja, es ist durchaus möglich, dass ich schwach geworden wäre, hätte ich damals von der Prinzessin ein Angebot erhalten. Ein unmissverständliches und eindeutiges Angebot, wohlgemerkt!“
„Und jetzt – entschuldigen sie, wenn ich frag‘, aber ich fühle mich schon ein wenig für ihre Hoheit verantwortlich – haben‘s jetzt etwas in der Richtung vor?“
Maerz legte seine Unterarme auf den Tisch und zeigte seine leeren Handflächen. „Herr Oberst, sie meinen, weil die Prinzessin mir dieses Mal immer wieder ziemlich deutliche Avancen macht? Ich habe eigentlich nichts dergleichen geplant, und ich habe auch nichts vor. Ich bin dieser Frau von ganzem Herzen zugetan und möchte nichts machen, das ihrem Ruf schaden könnte! Immerhin – und das habe ich auch zu ihr bereits gesagt – bin ich ein Bürgerlicher!“
„Das ist recht ehrenhaft gedacht, Herr Maerz…“
„Aber“, fragte Maerz lächelnd. „So wie ihre Stimme klingt, haben sie noch eine Frage auf der Zunge.“
„Aber jetzt stellt sich mir doch die Frage, warum sie so zurückhaltend sind. Sie haben’s selbst gesagt, die Erzherzogin ist eine schöne Frau, die tatsächlich ziemlich deutliche Signale in ihre Richtung sendet. Wenn es auf dieser Reise geschehen würd‘, tät’s doch kaum jemand erfahr’n, und das wiss‘n auch sie ganz genau. Fräulein von Oberwinden lassert sich lieber den Kopf abhack’n, als irgendwem etwas zu sag‘n, das der Prinzessin schadet. Die würd‘ eher den Wachpost’n vor der Tür spielen und die Affaire im Notfall auf sich nehmen. Ich für meine Person tät natürlich auch schweig’n, und auch das müsste ihnen klar sein. Immerhin, ein wenig sind wir ja schon gemeinsam unterwegs. Eine Zofe und ein Kammerdiener wissen ohnehin mehr als je in die Öffentlichkeit kommen dürft‘, verrat‘n aber bestimmt nichts. Zumindest, was unsere Begleiter angeht, können wir ziemlich sicher sein. Und wenn ich hören sollt‘, dass mein Pfeifendeckel zu dem Thema den Mund aufmacht…“ Der Graf von Inzersmarkt machte eine beredte Geste.
„Wie schon gesagt, Oberst.“ Auch Maerz hatte eine Zigarre entzündet und blies den Rauch nun von sich. „Ich bin ein Bürgerlicher, es wäre also in gewisser Weise immer eine Mesalliance.“
„Nur, wenn’s die Prinzessin heiraten wollt’n“, entfuhr es Inzersmarkt. „Was sie ja hoffentlich nicht wirklich vorhab’n, weil sonst kriegen’s wirkliche Zores mit mir! Also, Brösel – na, Probleme halt! Da müsst‘ ich wirklich etwas unternehm‘n. Und das würd‘ ihnen dann sicher nicht g’fallen. Sind’s eigentlich schon verheirat‘ oder sonstwie verbandelt?“
„Nein, Oberst, bin ich nicht.“ Der Schriftsteller schüttelte den Kopf. „Es war… es hat sich irgendwie noch nie so ergeben.“

„Na, auf was warten’s denn dann noch? Auf eine schriftliche Einla…“ Der Oberst kam nicht dazu, seine Frage zu vollenden.
„Dieser scheiß Schneckenschlachter! Dieser Froschfresser kann mich einmal am Arsch lecken, aber fest und kreuzweis‘, der depperte Schleimscheißer, der verruckte Hund!“ Laut schimpfend eilte Maria Sophia herbei. „Das kann‘ sich nur ein total wahnsinniger Volltrottel ausdenk’n, ein halbwegs normaler Mensch kommt doch gar nicht auf so eine hirnverbrannte Idee!“ Sie ließ sich schwer auf einen Sessel sinken. „Einen großen Schwarzen mit Zucker und einen doppelten – Moment, ihr trinkt doch Alkohol, oder? Ihr seid ja keine Moslem, ihr dürft doch!“
„Ja, selbstverständlich trinken wir wieder Alkohol, Hoheit. Es gab zwar `82, als die Mahdisten kurz die Stadt erobert und besetzt hatten, eine kurze Zeit für uns nichts zu trinken in Lalibela. Diese Gotteskrieger haben vielleicht eine Menge gesoffen, schlimmer als jeder Nichtmoslem, den ich kenne. Und damals war ja kein Nachschub zu bekommen, da gab es nur Hirsebier. Aber schon wenige Monate später war alles wieder in Ordnung, die Fanatiker waren wieder weg, und der gute Stoff ist wieder nachgekommen. Es treiben sich in der Gegend zwar immer noch einige Banden herum, aber das sind nur Versprengte, die sich jetzt als Räuber versuchen. Auf die Dauer werden sie sich nicht halten können, mit Hilfe von deutschen Söldnern, die zu Siedlern geworden sind, haben wir die Grenze und das meiste Land ganz gut beschützen können. Bis auf diese eine Horde, und oben in Gonder waren auch einige Kämpfe. Es weiß bis heute niemand, wo diese Banden herkamen, zum Glück war es nur leicht bewaffnete Kavallerie. Auf Pferden natürlich! Aber wie auch immer, wir haben hier Alkohol, einen recht guten Brand aus der Kaktusfeige, oder, sollte es etwas süßer sein, Yelomi Arak’e, ein Likör, dem italienischen Limoncello sehr ähnlich. Und natürlich französi…“
„Nichts französisches heute, danke, davon habe ich im Moment den Kanal gestrichen voll. Aber so etwas von komplett und absolut. Ich versuche den Kaktusfeigenschnaps, wenn er nur ordentlich scharf ist.“
„Gerne, Hoheit!“
„Was ist denn los, Hoheit?“ Der Oberst konnte seine Sorge nicht verbergen.
„Was los ist? Dieser Oberaff‘ von den Krotenfressern ist hinter mir her, weil er sich einbild’t, dass er mich heirat’n will!“
„François Louis? Der Sohn des Kaisers“, fragte der Graf ungläubig.
„No na, der Herzog von Reichstadt wird’s sein!“ Sophia schlug mit der Faust auf den Tisch, und Oberst von Inzersmarkt prallte überrascht zurück. „Entschuldigen’s, Oberst, aber grad sind bei mir ein paar Gäule ein bisserl durchgangen. Sehen’s mir die Erregung doch bitte nach, ja?“
„Selbstverständlich, Hoheit!“ Schon war der ältere Offizier wieder besänftigt.
„Dabei hab‘ ich grad jetzt so gar keine Zeit, mich mit so einem blöden Schmarr’n herum zu schlagen. Na, zum Glück sucht er einstweil’n einmal den falschen Nil ab, in Kharthoum haben’s gesehen, wie er mit dem Luftschiff AIGLE südwärts den weißen Nil hinauf dampft ist! Aber wenn er in Fort Dinka erfahrt, wo ich bin, braucht er mit der AIGLE nur neun, mit Glück vielleicht acht Stund.“
„Er wird nicht aufgeben, Mary, nicht solange sich seine Mutter dadurch Chancen für ihn, für Frankreich und vor allem für sich selbst auf Kakaniens Thron ausrechnet!“ Maerz sah ostentativ in weite Ferne.
„Witzig, dass du die Sprach‘ darauf bringst!“ Maria Sophia stürzte den Schnaps hinunter und nickte beifällig. „One more“, bestellte sie. „Meine Mutter hat meinen Bruder Franz Rudolf und meine nächstältere Schwester Elisabeth Anna, die gerade mit ihrem Mann und Sohn auf Besuch in Wien ist, auch schon unter dreifachen Schutz g’stellt. Und alle Wach‘n in Schönbrunn sind ab jetzt auch schon doppelt besetzt. Neue Codeworte, neue Procedere, massiv verstärkte Sicherheit, der Hametten hat sich austob‘n dürfen, wie er wollt‘. Ein Überfall auf die Schatzkammer in der Hofburg vor zwei Tag‘ liefert dafür sogar noch eine zusätzliche ganz glaubwürdige Erklärung!“
„Ein Überfall auf die Hofburg?“ Dem Oberst brach die Stimme. „Auf eines der erhabensten…“ Die Stimme versagte ihm.
„Auf die Schatzkammer“, nickte die Erzherzogin. „Es ist zwar nichts abhanden gekommen, Oberst.“ Maria Sophia legte ihm die Hand auf den Arm. „Leider hat es aber ein Feuergefecht gegeben, und dabei sind unglücklicherweis‘ auch ein paar von den Alpinjägern g’storben, die unsere Schätze bewacht hab’n. Aber jetzt noch einmal zurück zur aktuellen Situation am Hof. Die Elisabeth Anna ist als Mamas Nachfolgerin als Regentin und Vormund für ihr‘n Bruder eingesetzt worden, falls Mama etwas passiert. Wenn dem Franzl auch etwas geschehen sollte, dann ist nach der jetzigen Regelung sie Kaiserin und ihr Mann Pawel Alexandrowitsch Kaiser von Kakanien!“
„Wie? Der Bruder des russischen Zaren“, wunderte sich Maerz.
„Aber ja, der Bruder vom Zaren Wladimir Alexandrowitsch. Ich geb’s zu, der Wladimir ist mir auch weit lieber als Zar, als es sein Bruder Alexander als der dritte mit dem Namen g’wesen wär‘. Der junge Alexander war aber auch vielleicht eine ganz miese Krätz’n, mich würd’s gar nicht wundern, wenn der das eigentliche Ziel von dem Attentat damals war und dass es sein‘ armen Vater nur so nebenbei erwischt hat. Egal, für’s erste bin ich jedenfalls aus der Reihenfolge draußen, ich hab‘ sicherheitshalber gleich auf die Nachfolge verzichtet! Weil ich derzeit ja auch ohne ausreichende Garde und Schutz unterwegs bin, und vielleicht reicht das ja aus, damit Roxane Solange ihr‘n verwöhnten Fratz François wieder z‘rück pfeift.“
„Das heißt, ihr seid jetzt…?“ Inzersmarkt machte eine fragende Geste.
„Ach, eigentlich immer noch Erzherzogin und Prinzessin, aber im Moment halt die letzte in der Thronfolge. Die allerletzte von allen meinen Geschwistern. Vielleicht möcht‘ ja der Prinz von Frankreich jetzt lieber um Valerie Theresias Hand anhalt‘n. Oder er versucht sein Glück bei Helene Antonia. Beide sind jetzt immerhin lang vor mir an der Reih‘.“
„Das kann sich aber auch ganz schnell wieder ändern“, stellte Maerz fest. „Das ist doch jetzt ein reines Spiel auf Zeit, dein eigenes Volk könnte dem Franzosen ungewollt in die Hände spielen. Vielleicht nimmt es deine Rückstufung nicht so einfach hin, immerhin verehrt es dich abgöttisch und möchte dich sicher nicht zurück gesetzt sehen.“
Sophia Maria kippte ihren zweiten Schnaps hinunter. „Besser ein bisserl Zeit g’wonnen als das ganze Spiel gleich verlor’n. Meine Mutter ist ja auch nicht dumm, der fallt hoffentlich in der Zwischenzeit was ein. Außerdem ist’s nicht mein Volk, Scharly, sondern wenn schon, dann bitte schön Völker. Und es sind immer noch die vom Franz Rudolph, der ist der erste in der Thronfolge. Und er bleibt’s hoffentlich auch. Und wenn das geklärt ist, dann geh‘ ich jetzt ganz allein auf mein einsames Zimmerchen und leg‘ mich traurig in mein leeres Bett! Oder möcht‘ vielleicht wer mitkommen?“
Maerz sah zu Boden. „Ähhh…“
Unter dem Tisch trat Inzersmarkt kräftig zu und wedelte Carl Friedrich zu. „Na los schon“, formten seine Lippen eine tonlose Aufforderung.
„Wenn ich wirklich…“
„Ja Herrgott im Himmel!“ Maria Sophia hob die Arme empor und beschwor das höchste Wesen. „Wie viele Hölzeln muss ich dem Deppen denn noch schmeißen? Muss ich ihm zuerst ohne Hemd und Hos’n einen Csárdás auf’m Tisch vorhupf’n, dass er mich einmal anspringt? Jetzt lupf endlich dein‘ Arsch vom Sessel, Scharly, und komm mit, Kruzitürken, Domino und verdammt noch einmal! Stell‘ dich deinem Schicksal wie ein Mann, Himmel, Arsch und Wolkenbruch, ist das Mandl vielleicht begriffsstutzig! Muss ich dir `leicht auch noch einen Lageplan zum Allerheiligsten zeichnen oder find‘st den Weg nachher schon noch selber?“
„Hat da nicht jemand von einem Csárdás ohne Gewand auf einem Tisch gesprochen“, beklagte sich Maerz im Zimmer der Prinzessin. „Hier ist doch weit und breit kein Tisch.“

„Ja und? Du kannst doch eh keinen Csárdás, also brauch’n wir auch keinen Tisch!“ Maria öffnete ihre Bluse. „Aber vielleicht könntest mir schon einmal zeigen, auf was ich mich freu’n kann. Abe mit der Panier, Scharly.“ Sie lehnte sich auf dem Bett zurück und beobachtete voll Vorfreude die Entkleidung des Schriftstellers. „Na, da hab’n wir ja einen hübschen Füller! Mit dem hättest sicher auch eine Menge Gerst’l machen können, wenn’s mit dem Schreib’n nicht geklappt hätt‘. Komm‘ doch einmal näher!“ Sie öffnete ihren Hosengürtel und drehte sich um. „Zieh‘ einmal an!“ Der Jäger befreite die hinteren Rundungen Marias aus ihrer Umhüllung. „G’fallt er dir?“ Sie wackelte mit den Bäckchen.
„Sehr“, schluckte Maerz trocken.
„Dann greif doch jetzt endlich einmal zu, aber ordentlich. Ich mein‘, wie ein Mann, nicht wie ein Freund und Bruder!“
=◇=
„Na, muss sich der Hotelbetreiber jetzt vielleicht ganz neue Möbel für dein Zimmer anschaffen, Mitzi?“ Elisabeth von Oberwinden verbarg ihr Schmunzeln hinter einer großen Kaffeetasse.
„Halt dein frechen Schlapfen, Lisi“, grinste Maria Sophia zurück. „Nur ein neues Bett. Was glaubst du eigentlich, wie wir einen Kasten zusammen reiten könnt‘n? Deine blühende Phantasie möcht‘ ich auch einmal haben.“
„Na, man könnt‘ doch…“, überlegte die Baronesse.
„Danke, wir hab‘n den größt’n Teil der Einrichtung und unsere alten Baner g’schont“, wehrte Maria Sophia ab.
„Ang’hört hat sich’s aber anders!“ Elisabeth von Oberwinden fächelte sich geziert mit der Hand Luft zu. „Puh! Da ist jemand gestern ganz schön zur Sach‘ gegangen.“
„Ja was hat’s denn auch für einen Sinn, wenn man nicht auch ordentlich die Sau `rausläßt und sich zurück hält? Wenn man den Mann endlich dort hat, wo er hing’hört und es richtig treibt? Guten Morgen, Henny! Hast gut geschlafen?“
„Äh, ja, scho! Nachher!“ Henriettas Gesicht überzog eine leichte Röte.
„War’s denn gar so laut“, erkundigte sich Maria Sophia, die Augenbrauen hebend.
„Nun, ganz ehrlich gesagt, es war – erstaunlisch. Überraschend. Und so lang anhaltend! Es war abe auch irgendwie – inspirierend. Durchaus inspirierend. Drei Mal, um ganz genau zu sein.“
„Sag bloß, Orville wacht langsam auf! Ein großes Frühstück bitte. Speck, Eier, Feigen, Joghurt und eine Menge Kaffee“, wandte sich die Prinzessin an den Ober.
„Für mich bitte auch. Danke“, bestellte, Henrietta, dann beugte sie sich vor. „Diese Reise ist nicht nur wissenschaftlich gesehe voller Überraschunge und Höhepunkte.“
„Wie erfreulich! Wo ist denn der Henry jetzt?“
„Im Moment fragt er wahrscheinlich dem Wachtmeister Pospischil Löche in de Bauch, wege der Technik von die Husare. Ode er lernt bei dem Pope ein wenig Amharisch. Der Junge ist so etwas von neugierig.“
„Vielleicht überrascht er uns alle noch.“ Maria Sophia brach ein Stück Brot ab und stippte es in ihr Ei. „Bist du schon etwas tiefer in die Evangelien und so vor‘drungen?“
„Im Moment sind es eher Alltagschilderunge aus Alexandria. Der Lehrer ist mit seine Frau weiter gezoge, aber Salome erzählt nicht, wohin er wollte. Und sie haben die Schleuder Davids, die Hörne, die sie vor Jericho geblase habe und den Mantel, der Joseph die Gabe der Vorhersagung beschert habe soll, gut versteckt. Einige wenige aus der engere Familie habe sie sich anvertraut, immerhin ware Maria Magdalena und Rahel Schwestern.“
„Irgendwie haben die damals schon genau so wenig Phantasie bei den Namen g’habt wie unser Familie. Die ganz’n Marias geh’n mir schon schön langsam auf’n Geist. Aber nein, zumindest bei der Ältesten muss bei den Habsburgern ein Maria rein, und bei den Buben ein Franz.“
„Wie möchtest du denn deine Kinder einmal nennen?“ Lisi beugte sich interessiert vor. „Irgendwann wird’s ja wohl auch bei dir einschlag‘n, ich mein‘, rein statistisch bist schon mehr als überfällig.“
„Elisabeth, wenn’s ein Mädel wird, und entweder Leopold oder Lukas, wenn’s ein Bub wird.“
„Leopold?“ Unglauben schwang in Elisabeths Stimme, Maria Sophia legte verträumt lächelnd ihr Kinn auf die verschränkten schlanken Hände.
„Oh ja, Leopold! Der erste, der mich wirklich in den siebenten Himmel g‘vö… ah – g’segelt hat. Und er war auch ein bürgerlicher Hengst. Was mich jetzt zu der Frage bringt, wo sind denn unsere Männer eigentlich!“
„Auf der Terrass‘n, eine Zigarre rauch‘n. Später wollen‘s dann auf Bärenjagd geh‘n! Ohne uns“, empörte sich Elisabeth von Oberwinden. „Für uns Frau’n ist so eine Jagd auf ein g’fährliches Raubzeug ja nicht das Richtige!“
„Sollen’s das ruhig glaub’n, Lisi. Hast Lust, geh’n wir auch auf’d Jagd?“
=◇=
„Also, das letzte Abendmahl hat es aber schon gegeben, oder Kahini Yuda?“ Henry Jones saß bei dem Priester in einer der Kirchen, der Beth Maryam, welcher ihm nicht nur die Amharische Sprache, sondern auch die Unterschiede zwischen der Anglikanischen und der Äthiopisch-orthodoxen Kirche erklärte.
„Wir nehmen es an, Henry. Aber es wird wohl nicht im üblichen Rahmen statt gefunden haben, denn die Frauen waren seit einiger Zeit an einem anderen Ort. Wir wissen, dass Judas der Iskarier Maria Magdalena, die Frau des Lehrers, seinen Sohn und einige andere Frauen aus dem Gefolge des Meisters einen Tag vor des Meisters Verhaftung unter einem Vorwand weg und in Sicherheit gebracht hat. Noch rechtzeitig, ehe er am Tag der Gefangennahme von Simon und dessen Anhängern ermordet wurde. Salome hat es ganz dezidiert geschrieben, sie hat es aus der Entfernung mitansehen müssen, ohne ihn retten zu können.“
„Aber können wir dieser Salome glauben? Alle anderen Evangelien sagen doch etwas ganz anderes!“ Henry war nicht überzeugt. „Da hat der Judas den Jesus verraten und dann Selbstmord begangen.“
„Zum ersten, kein anderer Evangelist hat zu Lebzeiten des Lehrers gelebt. Alle haben immer nur angeschrieben, was Simon Petrus und seine Gefolgschaft erzählt haben. Es gab auch noch andere Evangelien, die der Kirche bekannt waren, welche aber während des Konzils von Laocidea nicht anerkannt wurden. Man hat damals, etwa 350 Jahre nach dem Meister, einfach die vier herausgesucht, die am besten zu den Ansichten der Kleriker gepasst haben. Es gibt ein Thomas-Evangelium, in dem er seine Zweifel an der offiziellen Lesart ausdrückt. Er verließ später auch die Gruppe des Simons und ging nach Ägypten, hatte aber keinen nachweisbaren Kontakt zu der Gruppe von Josef und Maria.“ Yuda goss seinem jungen Gast und sich selber noch etwas Tee nach. „Und zum Zweiten, ist es denn wirklich wahrscheinlich, dass ein schlechtes Gewissen so schnell zuschlägt und sich Judas noch am gleichen Tag von des Meisters Verhaftung tötet? Das wäre doch sehr ungewöhnlich.“
An seinem Tee nippend überlegte Henry. „Vielleicht wollte er gar nicht, dass Jesus von den Römern verhaftet wird, als er zu den jüdischen Hohepriestern ging. Und als es dann geschah…“ Henry zog eine imaginäre Schlinge über seinem Kopf zu, verdrehte die Augen und ließ die Zunge heraushängen.
„Was hätte der Iskarier denn den Priestern verraten sollen? Jesus hat mit und zu allen gesprochen, die Predigt vom Berg erwähnt auch Salome. Seine Ansichten, seine Absichten und seine Pläne waren nie ein Geheimnis, und jeder wusste, wer er war und wo er war. Was hätte also Judas den Priestern verraten sollen? Und hätte er Spitzeldienste für die Römer geleistet, hätte er mit dem Ergebnis rechnen müssen. Judas war kein dummer und ungebildeter Mann, Henry. Er war nach Jesus der klügste und gebildetste unter den männlichen Jüngern.“ Der Priester wies auf die Schriftrollen. „Ich weiß, ihr habt zu wenig Zeit! Aber in diesen Schriften sind so viele Geheimnisse verborgen!“
„Auch das Geheimnis des heiligen Gral, den die Tafelrunde des König Artus gesucht hat?“ Der Junge zog ein imaginäres Schwert und führte einige Fechthiebe gegen einen imaginären Feind.
„Es gab einen Becher, in dem das Blut des Lehrers aufgefangen wurde“, bestätigte Yuda. „Der Kaufmann Jakobus, der von keiner der beiden Seiten eingeweiht war, schreibt darüber in seinen Briefen. Er wollte dieses Blut des Meisters bei einem Ritus dem GOTT seiner Vätern opfern und den Becher danach in oder an das Grab stellen. Was danach damit geschah, das wissen wir auch nicht so genau. Jakobus berichtet nachher nichts mehr darüber.“
„Aber es wird doch erzählt, dass Josef vom Ami… von Anti…“
„Von Arimathäa?“
„Ja, danke, genau der!“ Henry schnippte mit den Fingern. „Also, dass dieser Josef mit dem Becher bis England gekommen ist.“
„Das müsste kein Widerspruch sein“ erklärte der Priester. „Immerhin lag ja der Lehrer zumindest offiziell im Grab des Joseph, warum sollte der nicht den Opferkelch später mitgenommen haben. Immerhin war es eine Weihegabe von Jakobus, und ab und zu muss man solche Gaben auch wegräumen. Später sind dann vielleicht die beiden Kaufleute Jakobus und Joseph zu einer Person verschmolzen.“
„Aber sie wissen es nicht“, insistierte Henry, der Kahini lächelte.
„Leider haben uns weder Jakobus noch Joseph einen Brief mit diesem Inhalt hinterlassen. Aber natürlich könnte das Gefäß wirklich in Glastonbury in England sein. Oder auf Avalon. Genau so, wie in Rom, London, Madrid oder im heiligen Land.“
„Aber hat der Gral auch alle die Fähigkeiten, ist er so wundertätig, wie in der Sage?“
„Mein junger Freund, ich bin von meinem Beruf her verpflichtet, an Wunder zu glauben.“ Der Priester strich sich lachend über Bart. „Also, warum sollte der Gral keine Wunder vollbringen. Andererseits – warum sollte er es tun? Da müssen wir uns die Frage stellen, wie heilig, wie göttlich war der Lehrer wirklich? Wir hier sind überzeugt, dass er einfach das war, was er sagte. Ein Lehrer, der uns sagt, dass wir alle Kinder vom Geiste GOTTES sind. Ein Gesandter, ein Vordenker. Aber auch, dass er als Mensch geboren wurde, als Mensch lebte und als Mensch starb. Ein Heiliger? Das kommt ganz darauf an, was für dich heilig bedeutet. War er keusch? Nein, er war verheiratet und ein Vater. Treu? Niemand hat etwas anderes behauptet, also gehen auch wir davon aus. Ein sozialer Reformator? Ziemlich sicher. Ein religiöser Erneuerer? Nun, wenn, dann wollte er den mosaischen Glauben erneuern, sicher keinen neuen gründen.“
„Aber euer Glaube ist nicht mosaisch, sondern christlich! Orthodox, aber christlich“, argumentierte Henry Jones wie ein Erwachsener, obwohl er erst zehn Jahre alt war. Oder vielleicht fiel es ihm gerade deshalb auf, dass hier in Lalibela keine reformierte jüdische Religion praktiziert wurde.
„Ja, wir sind christlich, aber nicht im Sinne der anderen christlichen Religionen. Nicht ganz, aber auch nicht ganz mosaisch. Es ist kompliziert, für uns ist Jesus ein Prophet, ein Messias im wahrsten Wortsinn. Ein Mensch, der ein Befreier sein wollte und gescheitert ist, den man aber dennoch für seine Lehren und seinen guten Willen ehren und achten sollte.“
=◇=
Im Galopp preschten Maria Sophia und Elisabeth von Oberwinden durch die enge Schlucht, immer ihrem Führer hinterdrein, zwei Dragoner hinter sich. Auf diese Begleitung hatte Vizeleutnant Smetana, der Kommandant der Dragoner bestanden, als die Prinzessin ihn von ihrem Vorhaben in Kenntnis setzte. Also hatte die Erzherzogin vier Pferde gemietet und einen Führer angeheuert, der sie zum Versteck der Bären führen sollte. Zuerst aber genossen die Damen den wilden Ritt auf den trittsicheren, kleinen Pferden des abessinischen Berglandes durch die Schluchten desselben. Der Führer zügelte sein Pferd, vor ihnen war der dunkle Knall des schweren Gewehres von Carl Friedrich Maerz erklungen, gefolgt vom Bellen kleinerer Kaliber.
„Das war die Sechsundsechziger vom Maerz und der Karabiner vom Oberst“, bemerkte Elisabeth.
„Haben die Herren einige Führer mitgenommen“, wandte sich Maria Sophia an ihren Führer, doch der verneinte.
„Nur einen, so wie sie!“
„Das sind aber eine Menge mehr Gewehre, die wir hören“, überlegte Maria und musterte die Wände. „Hm, kommen wir irgendwie hier die Wand hinauf und oben weiter, ich würde mir gerne einen Überblick verschaffen?“
„Nur zu Fuß, Hoheit. Aber dort oben gibt es einen Sims, auf welchem wir weiter gehen können.“
„Also, los. Samuel, sie gehen voraus, danach…“
„Hoheit gestatten, dass ich den zweiten Mann mache!“ Der Dragoner stand stramm und salutierte.
„Na schön, Gefreiter Pollaček!“ Die Prinzessin hatte sich etwas vorgebeugt und das Namensschild auf seiner Brust gelesen. „Gehen sie voran. Dann übernimmt Gefreiter Sauer unsere Rückendeckung! Gefechtsbereitschaft herstellen!“
„Zu Befehl, Hoheit!“ Sauer und Pollaček salutierten und machten ihre Gewehre und Pistolen schussbereit. Auch die Frauen kontrollierten den Zustand ihrer Waffen noch einmal, dann machten sie sich an den Aufstieg. Für diesen Weg brauchte man wirklich keine Alpinausbildung, sobald man den Weg erkannt hatte, ging es ganz gemütlich. Jenseits der Biegung waren immer noch die Gewehre der Reisenden zu hören, und immer noch bellten dazwischen fremde Waffen.
„Die klingen fast wie unsere alten 8,67 Millimeter Repetiergewehre“, stellte Pollaçek fest, während er bereits unterwegs war.
„Mahdistische Räuber!“ Samuel, der Führer, hatte um die Ecke geblickt. „Diese Bande hat Lalibela überfallen und eingenommen, und nach ihrer Vertreibung macht sie immer noch diese Gegend unsicher. Und irgendwie bekommen sie Nachschub und können sogar ihre Leute ergänzen. Es ist uns ein Rätsel, wie sie das schaffen, aber seit sieben Jahren stellen sie eine gewisse Gefahr in dieser Gegend dar. Wir haben damit zu leben gelernt.“
„Davon habe ich gehört“, nickte die Erzherzogin. „Unser Wirt hat etwas in dieser Richtung erwähnt. Haben wir Deckung und freies Schussfeld?“
„Hoheit erlauben, dass ich nachsehe?“
„Machen‘s nur, Gefreiter Pollaček.“
Der Dragoner blickte um die Ecke. „Ein paar Felsen, und die Banditen sind ganz auf die Herren unten in der Schlucht fixiert. Ich laufe jetzt los. Wenn ich dann die Stellung wechsle, können Hoheit nachkommen. Der Gefreite Sauer und die Baronesse sollten hier bleiben, da haben sie für den Notfall auch unsere Pferde im Blick. Nicht, dass die noch gestohlen werden.“
„Sehr gute Idee, Gefreiter“, lobte die Generaloberst. „Machen wir’s so. Und vorwärts.“ Geduckt hastete der Gefreite zur ersten Deckung, lief aber sofort weiter, als er nicht bemerkt wurde. Maria Sophia rückte sofort nach und machte sich selbst ein Bild von der Lage. Der Führer der Jagdgesellschaft lag scheinbar tot auf dem Boden der Schlucht, Orville Jones lag zwischen einigen Steinen, sein Haar war rot von Blut, hinter anderen Steinen schossen Maerz und Inzersmarkt hervor. In den Schluchtwänden über ihnen kletterten die Mahdisten in ihren weißen Mänteln herum und versuchten, eine Position zu finden, aus welcher sie die Männer treffen konnten oder behielten die Steine unter Feuer. Mafia Sophia legte den Lauf ihres Karabiners auf dem Felsen auf und sah sich nach Pollaček um. Der hatte das selbe getan und nickte der Prinzessin zu. Die nickte zurück, nahm den ersten Mahdisten ins Visier und krümmte den Zeigefinger, bis der Schuss brach und das Projektil den Räuber traf und von der Felswand fallen ließ. Auch der Gefreite der Dragoner traf sein Ziel, der Lauf schwenkte herum, die beiden halbautomatischen Gewehre der Prinzessin und des Gefreiten Pollaček forderten weitere Opfer. Das Feuer auf die Deckung von Maerz und Inzersmarkt wurde schwächer, die Schützen suchten den neuen Feind. Die beiden Männer nützten sofort ihre Chance, wieder effektiver in den Kampf einzugreifen. Besonders das schwere Gewehr des Deutschen überschüttete einige der in Deckung liegenden Feinde mit heißen, scharfen Gesteinssplittern, wenn die großen Kugeln in die Felswand hinter ihnen schlugen. Die erhöhte, strategisch vorteilhafte Lage der Erzherzogin und des Dragoners sorgten für wachsende Verluste unter den Banditen, welche endlich den Kampf aufgaben und flohen.
„Gefreiter Pollaček, sie übernehmen hier noch den Wachposten, bis wir fertig zum Aufbruch sind“, teilte Maria Sophia den Posten ein und erhob sich nach einiger Zeit vorsichtig. „Gefreiter Sauer wird sie unterstützen.“
„Zu Befehl, Hoheit!“ Die Erzherzogin warf sich ihr Gewehr am Riemen über die Schulter.
„Gehen wir hinunter“, wandte sie sich an den Führer und Elisabeth, gemeinsam kletterten sie die Wand wieder hinab. „Scharly?“ rief Maria vorsichtshalber schon von einer Stelle vor der Biegung.
„Was machst du denn da, Mary?“ schallte es zurück, und sie schritt weiter. Oberst Inzersmarkt lag noch mit angeschlagener Wache in Deckung, während sich Maerz um Orville Jones kümmerte.
„Ist er…?“
„Ein harter Streifschuss, er wird noch einige Zeit abwesend sein, denke ich“, berichtete Maerz. „Aber er wird es überstehen. Siehst du einmal nach dem Führer?“ Maria nickte und begann ihre Untersuchung.
„Er lebt noch! Aber er hat einen gemeinen Steckschuss abbekommen, man kann ihn eigentlich nicht transportier’n. Die Kugel könnt‘ wandern, und dann – exitus.“ Sie stand auf und überlegte kurz. „Samuel“, rief sie dann. „Reite nach Lalibela zurück und besorge uns noch ein paar Leute mit Pferden, lange Stangen und Decken. So schnell es geht. Lisi, du hast doch so einen langen, dünnen Dolch!“
„Den da?“ Niemand hatte gesehen, woher die Baronesse plötzlich die beinahe nadelförmige Klinge genommen hatte.
„Genau die! Ein Feuer, zieht’s ihm des G‘wand am Oberkörper vorsichtig aus und haltet’s ihn dann wirklich gut fest. Alles in Ordnung, Pollaček?“
Aus der Höhe kam die Stimme des Gefreiten. „Melde gehorsamst, das ja, Frau General!“
„Gut so. Weitermachen!“ Die Erzherzogin schloss noch einmal die Augen und atmete tief durch, dann nahm sie den über den Flammen sterilisierten und danach mit einem Schuss Schnaps aus Flasche des Fremdenführers gereinigten Dolch zwischen Daumen und Zeigefinger und begann vorsichtig, den Wundkanal freizulegen, danach führte sie die Pinzette aus ihrem Notfalltäschchen in die Wunde ein.
„Ein Massel, dass der noch so wegtreten ist“, murmelte sie, während sie die Kugel mit den Backen der Pinzette ergriff und langsam hervorzog. „Hier ist sie ja!“ Maerz hatte unterdessen rasch eine Patrone geöffnet. Während die Männer und Elisabeth sich auf den Führer knieten, schüttete Maria ein wenig von dem Schießpulver in die Wunde und entzündete es. Die Schreie des Verletzten, den die Schmerzen der Verbrennung jetzt doch kurz aus der Ohnmacht rissen, hallten laut und schrill durch die Schlucht.
„Wenigstens werd’n die Gefäße gleich ordentlich kauterisiert und desinfiziert“, erklärte sie. „Und jetzt – entschuldigt’s mich bitte ganz kurz!“ Sie ging hinter einen großen Stein, von wo aus Lisi und die Männer kurze Zeit später die eindeutigen würgenden Geräusche einer oralen Magenentleerung vernahmen.
„Hier!“ Als sie wieder zurück kehrte, hielt ihr Elisabeth einen Flachmann entgegen. „Dreifach gebrannter Obstler vom Papa!“
„Danke!“ Maria nahm einen großen Schluck. „Wie geht es Orville?“
„Er ist zu sich gekommen und hat des gleiche g’macht wie du“, erzählte Elisabeth. „G’spieben wie ein Reiher hat er! Ich denk‘, er wird eine saftige Gehirnerschütterung ausg’fasst haben. Ruhe und ein finsterer Raum, dann das wird schon wieder. Besser jedenfalls, als wenn die Kugel ein paar Millimeter weiter links g’flogen wär.“
„Na gut. Also mit einem Bärenfell kommen wir heut‘ jedenfalls nimmer nach Haus. Hoffentlich packt der Führer meine Amateuroperation.“
„Du hast mir immer noch nicht gesagt, warum du hier bist“, stellte Carl Friedrich Maerz fest. Auf dem Rückweg, welcher wegen der Verletzten nur langsam vonstatten gehen konnte, ritt er neben der Erzherzogin.
„Ich wollt‘ halt auch mit auf Bärenjagd. G’fragt hast mich nicht, also hab‘ ich mich aufg’macht und bin losg’ritten. Mit einer veritablen Schießerei mit ein paar Bandit’n hab‘ ich allerdings nicht g’rechnet.“
„Unser Führer offensichtlich auch nicht“, erzählte Maerz. „Er hat uns gesagt, das einzig gefährliche hier sind ein paar Bären. Als ich die Gestalten bemerkte, die in den Felsen ihre Gewehre in den Anschlag brachten, habe ich gleich alle gewarnt. Aber nur der Oberst hat schnell genug reagiert. Er ist wirklich ein guter Soldat, mit schnellen Reaktionen und trotzdem richtigen Handlungen. Absolut fit ist er außerdem auch noch. Wenn ich mit sechsundfünfzig Jahren noch so gut erhalten bin, möchte ich Gott dafür danken! Orville ist noch vom Pferd gesprungen, der hat die Wunde während des Sprunges erhalten, aber den Guide hat schon die Kugel vom Pferd geworfen. Die erste, auf ihn hatten sie es wohl zuerst abgesehen.“
„Na, für‘d Europäer hätten’s ja vielleicht Lösegeld erpressen können, bevor sie’s umzubringen“, spekulierte Maria. „Beim Geld hört sich doch jede Religion auf.“
„Jede Religion vielleicht“, verteidigte Maerz die wirklich gläubigen Menschen. „Aber nicht bei jedem Menschen!“
„Hast recht“, gab die Prinzessin zu. „Aber je höher die Leut‘ aufg’stiegen sind in der jeweiligen Hierarchie, desto öfters sind’s korrumpiert. Wie war denn das mit dem Ablass? ‚Die Seele aus dem Feuer springt, wenn’s Goldstück in der Kassa klingt!‘ Also sündig‘ ruhig und kauf‘ dich dann los, in der Bibel steht’s sicher nicht so!“
„Du wirst doch nicht noch Protestantin werden“, lächelte Carl Friedrich.
„Ganz sicher nicht“, protestierte Maria Sophia. „Diese ganzen, total freudlosen Statuten!“
„Du hältst den Protestantismus also für freudlos“, erkundigte sich Maerz.
„Schon“, bekräftigte die Österreicherin. „Nur dauernd in schwarze Fetz’n herumrennen, keinen Schmuck, eigentlich gar kein Genießen, wenn man alle Regeln einhaltet! Nichts für mich, erstens mag ich gutes Essen und Trinken viel zu sehr, zweitens hast letzte Nacht selbst erlebt, was ich von Enthaltsamkeit und Keuschheit halt‘ und drittens passt mir Schwarz überhaupt nicht. Da schau ich aus wie eine alte Vogelscheuch‘n!“
„Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen“, lächelte der Deutsche versonnen.
„In Ordnung. Wie eine gut gebaute Vogelscheuche halt“, lachte Maria Sophia. „Eigentlich g’fallt mir der Glauben von den Leuten in Lalibela bis jetzt am Besten. Jesus als Mensch, als liebender Ehemann und Vater, und gleichzeitig auch als ge-, aber nicht übermäßig verehrter Lehrer und Bote Gottes, als Prophet, aber nicht als Gott.“
„Was wird denn dein Volk dazu sagen, wenn es das erfährt?“ Maerz machte ein besorgtes Gesicht. „Obwohl Religionsfreiheit in Kakanien herrscht, ist das Land doch noch immer erzkatholisch und sehr konservativ!“
„Mein lieber Scharly! Ich erklär’s dir noch einmal. Erstens!“ Die Prinzessin hielt einen Zeigefinger hoch. „Es ist nicht mein Volk, sondern wenn schon, dann Völker. Plural, bitte schön, wir sind ein Vielvölkerstaat. Zweitens!“ Sie zeigte Zeige- und Mittelfinger. „Sind‘s nicht meine Völker, sondern die vom Franz Rudolph. Ich hoff’s zumindest ganz stark. Und drittens!“ Sie hielt dem Jäger und Abenteurer drei Finger entgegen. „Ich hoff‘ doch ganz stark, dass ich mich einem Freund anvertrau‘n kann, ohne dass es gleich die ganze Welt erfahrt! Auch wenn der Freund Autor mit einer respektablen Leserzahl ist. Sogar im britischen Empire lesen’s dich ja schon.“
Maerz lachte. „Wenn ich unser Abenteuer bis jetzt komplett niederschriebe, es glaubte mir ohnehin kein Mensch. Per Du mit einer Prinzessin, mit der ich auch noch mein Bett teile.“
„Genau genommen, mein Bett!“ Ihre Hoheit konnte manchmal auch ganz schön penibel werden. „Aber sonst hast recht. Werd‘n die Lisi und ich eigentlich wieder Männer in deinem Büch’l?“
„Wahrscheinlich. Ich möchte ja glaubwürdig schreiben und den Roman verkaufen! Ich schreibe Abenteuergeschichten, keine Utopien wie Jules Verne“, beschied der Autor.
„Da schau her!“ beklagte sich Maria Sophia. „Jetzt bin ich auch noch ein utopischer und unglaubwürdiger Mensch!“
„Utopisch – ganz bestimmt“, bemerkte Maerz. „Ansonsten würde ich eher unglaublich vorziehen. Unglaublich toll nämlich!“
„Na, das ja noch `mal die Kurv’n kriegt, mein Lieber. Aber schau’n wir jetzt zu, dass wir wieder aufholen. Sonst kommen’s noch z’rück und schau’n nach, was wir treib’n.“ Maria Sophia trieb ihr Pferd an.

„Im Moment – leider nichts verfängliches“, lachte Maerz und ritt jetzt auch schneller.
„Das könnt‘ sich irgendwann heut‘ noch ändern“, rief die Prinzessin über die Schulter zurück, und der Mund des Autoren wurde trocken.
„Teufelsweib“, brummte er noch in seinen vollen, dunkelblonden Bart, der weitere Ritt zurück nach Lalibela erfolgte ohne besondere Vorkommnisse.
=◇=
Eritrea
Die Soldaten der italienischen Invasionsstreitkräfte in Eritrea Leonardo Sabonotti und Francesco Bellucetti stapften durch den tiefen Sand und trugen schwere Wasserkanister vom Meer ins Zeltlager. Nur wenige Stunden nach der missglückten Landung war bereits ein erstes österreichisches Lazarettschiff mit medizinischem Personal und Vorräten aus Josephshafen eingetroffen, ein in Port Helene stationiertes Werftschiff mit österreichischen Hilfstruppen war am nächsten Tag vor Ort gewesen. Die kakanischen Pioniertruppen hatten mit schwerem Gerät begonnen, die havarierten Landkreuzer zu öffnen und Lebende wie Tote daraus zu bergen, die schwerer Verletzten waren auf die KKS PARACELSUS gebracht und dort ordentlich verarztet worden. Für die weniger schwer Verwundeten wurde am Strand ein Feldlazarett errichtet und für die halbwegs Gesunden Zelte ausgegeben. Auch der Colonello Conte Jacopo di Maranio als ranghöchster überlebender Offizier musste mit einem solchen Vorlieb nehmen. Die Kakanier hatten wirklich nur Kranke und Schwerverletzte an Bord der PARACELSUS gelassen, keine Gesunde. Nicht einmal Offiziere. Dafür hatten sie im Wasser vor der Küste einen großen Tank mit Trinkwasser im Meer versenkt, mit einer Schlauchleitung an Land. Normalerweise mündete in dem Gebiet ein Flüsschen in das Meer, derzeit war es aber mit Sand bedeckt und versiegt. Nur langsam bahnte sich ein schmutziges Rinnsal seinen neuen Weg zum Meer. Ein österreichischer Pioniertrupp hatte sich in das Hinterland aufgemacht, um die Wasserversorgung wieder in Gang zu bringen, irgendwo musste der Oberlauf und die Quelle ja noch zu finden sein. Hoffentlich. Aber vorderhand blieb nur der große Tank im Meer, durch das ständig sich bewegende Meerwasser blieb der Inhalt des Tanks gekühlt und frisch.
„Was glaubst du, wie geht es wohl weiter?“ Leonardo setzte den Kanister kurz ab und drückte das Kreuz durch.“
„Ach, der Re Umberto wird uns schon nicht im Stich lassen! Ich wette, dass in den nächsten Tagen eine Flotte kommt, um uns abzuholen. Oder noch besser, uns neu ausrüstet, damit wir unsere Aufgabe in Abessinien doch noch erfüllen können. Wer soll uns aufhalten? Die Kakanier?“ Francesco spuckte aus. „Die sind doch froh, wenn sie nicht gegen uns kämpfen müssen!“
„Immerhin haben sie uns hier sehr schnell geholfen“, wandte Leonardo ein.
„Der Re wird es ihnen befohlen haben, damit sie keine Probleme mit unserer restlichen Armee bekommen!“
„Denkst du? Warum haben sie dann dem Colonello keine Unterkunft auf ihrem Schiff gewährt?“
„Eine Trotzreaktion, nichts weiter. Du wirst sehen, schon bald wird hier wieder il Tricolore von der Forza Italia künden und wir werden ganz sicher allen Widerständen zum Trotz doch noch nach Abessinien marschieren. Unser altes Reich unter der Regierung Roms wird wieder auferstehen, glanzvoller und größer denn je zuvor. Rom hat die Gallier und die Briten schon einmal besiegt, dieses Mal werden auch die Tedesci nicht mehr standhalten können! Die damaligen Grenzen am Rhein und an der Donau werden dieses Mal nicht reichen, unsere Legionen werden weiter und immer weiter marschieren. Bis Russland, bis Moskau, bis Sibirien. Roma! Roma eterna!“
Unter den Unverletzten befanden sich auch die Offiziere Maggiore Giancarlo di Fuoccini, ein fanatischer italienischer Nationalist, und sein Bruder, Capitano Michele di Fouccini, der ebenso bedingungslos und überzeugt an die Überlegenheit Italiens und Roms glaubte.
„Signori, ich habe sie zu mir bestellt, weil ich große Sorgen habe.“ Conte di Maranio hätte gerne Wein angeboten, doch seine Vorräte lagen wie vieles andere auf dem Grund des roten Meeres. „Was auch immer unsere Schiffe versenkt hat, es muss in den Besitz der italienischen Armee kommen. Nehmen sie ein paar vertrauenswürdige Leute und machen sie sich auf den Weg, ehe die Spuren komplett verschwunden sind. Ich verlasse mich auf sie. Gehen sie so bald wie möglich los, unsere Armee wird ihnen ganz bestimmt bereits in wenigen Tagen folgen können.“ Und so hatten sich die beiden Brüder fünf ebenso fanatische Soldaten ausgewählt und waren aufgebrochen.
„Wir sollten dort oben an der Felskante nachsehen!“ Michele zeigte nach oben. „Irgendwo da oben muss das Ding, was auch immer es war, gestanden haben.“
„Da kannst du durchaus recht haben“, brummte Giancarlo. „Klettern wir los.“ Von oben sahen sie sich den Strand noch einmal an.
„Maggiore, Meldung!“ Der Caporale Riccardo Mentettri salutierte.
„Was ist, Caporale?“
„Melde ein seltsames Muster, Signor Maggiore!“
„Ach!“ Der Offizier beschattete seine Augen.
„Signor Maggiore möchten bitte bemerken, dass der Sand hier anders zu sein scheint als dort drüben“, beharrte Mentretti. „Er – er sieht einfach anders aus!“
Michele ging in Hocke, dann sah er sich um, kniete dann ganz nieder und betrachtete den Boden ganz genau. Dann sprang er auch und wiederholte das Ganze etwas weiter entfernt, kam wieder zurück.
„Gut beobachtet, Caporale. Er hat richtig gesehen, Giancarlo. Von hier aus, schau einmal, jetzt kann man es deutlich erkennen! Das ist ein Dreieck, ein Delta, das hier seine Spitze hat.“
„Reifenspuren, Capitano!“ Lugotenente Luigi Palamazzo hob die Hand. „Zwei Fahrzeuge, und auch jede Menge Fußspuren!“
„Sehr gut! Dann haben wir eine Richtung. Kommst du, Giancarlo?“
„Sofort! Sieh einmal auf das Meer, Michele! Unsere Flotte kommt!“ Giancarlo hob sein Glas und suchte damit die Schiffe.
„Ich hoffe, du hast Recht, Bruder!“ Auch der Capitano nahm seinen Feldstecher.
„Wer sollte es denn sonst sein?“, fragte der Maggiore wegwerfend. Einige Zeit beobachteten die Brüder die sich nähernde Flotte, Michele ließ als erster enttäuscht sein Glas sinken.
„Ich fürchte, unsere Armee geht in nächster Zeit nirgends hin, Giancarlo. Der vorderste Kreuzer ist eine britische Bombay-Klasse!“
„Was? Wie können die so schnell hier sein?“ Giancarlo schrie seine Wut heraus.
„Von Aden, nehme ich an.“ Michele zuckte die Schultern.
„Die haben aber hier nichts zu sagen, das ist kein britisches Gebiet“, tobte Giancarlo.
„Wenn sie es so hindrehen, dass die Flotte auf die Bitte des Khediven von Kairo hier ist…“, überlegte der Capitano.
„Mierda!“ Giancarlo nahm das Glas von den Augen. „In diesem Fall brechen wir sofort auf. Rasch! Wir sind die letzten in Freiheit befindlichen Männer unserer Truppe, und wir haben einen Auftrag. Gehen wir, ehe unser Fehlen entdeckt wird! Wir benötigen Kamele, Pferde oder einen Dampfwagen!“
Nach einigen Stunden über das Hochland erreichte die italienische Truppe einen Talkessel, in welchem eine Quelle für einen kleinen Teich, ein paar fruchtbare Felder, grüne Wiesen und sogar einige Bäume sorgte. Zehn Pferde und einige Ziegen weideten friedlich das Gras ab, am Ufer lagen einige kleine Häuser in der typischen runden Bauweise dieser Gegend, doppelte Holzwände, deren Zwischenräume mit Bruchsteinen aufgefüllt und danach mit Lehm, vermischt mit dem Dung der Haustiere, verfugt wurden. Stroh oder, wie in diesem Falle Schilf bildete, zu dicken Garben gebunden und von weiteren Steinen beschwert, das kegelförmige Dach der Hütten.
Capitano Michele di Fouccini strich über seinen Dreitagesbart. „Zehn Pferde, damit hätten wir drei Packpferde. Da könnten wir doch einige Ziegen schlachten und mitnehmen.“
„Signore Capitano, entschuldigen sie, aber das Fleisch verdürbe in dieser Hitze doch zu schnell.“ Lugotenente Palamazzos Eltern waren Bauern, er kannte sich mit Fleisch aus. „Um das Fleisch haltbar zu machen, bräuchten wir zu viel Zeit. Wir sollten eher in den Häusern nach gepökeltem oder anderweitig haltbar gemachtem Proviant suchen.“
„Und nach einer Frau! Gott, es ist eine Ewigkeit her, dass wir eine Frau hatten“, meinte Sergente Antonio Frasmino.
„Keine Vergewaltigung“, warnte der Major di Fouccini schneidend. „Ich schneide jedem persönlich seine Makkaroni ab, der es wagt, sie auch nur aus der Hose zu holen. Zumindest so lange wir uns dort auf dem Hof befinden. Wir sind Soldaten, keine Marodeure. Wenn diese Menschen sich wehren sollten, werden wir unsere Waffen einsetzen, unser Auftrag muss durchgeführt werden. Aber weder Folter noch der Missbrauch von Frauen sind erlaubt!“
„Aber, Giancarlo…“
„Auch dir, Michele“, fuhr der Maggiore seinen Bruder an. „Ihr werdet doch warten können, bis wir wieder ein Bordell erreichen! Ich wiederhole mich ungern, also – keine Vergewaltigung, keine Folter! Wir sind italienische Soldaten, und wir haben einen Ehrencodex, dem wir folgen. Basta! Und jetzt requirieren wir uns die Pferde und die Vorräte, die wir zur Ausführung unseres Auftrages benötigen. Avanti!“
Omar ben Faisal lebte mit seinen beiden Frauen und einigen Kindern auf einem kleinen Hof am Seeufer. Die kleine Oase gab genug für ein halbwegs gutes Leben her, es gab zwar genug schwere Arbeit, aber sie hatten auch nie unter Hunger und Durst zu leiden. Seine erste Frau Khadija war eine große Frau mit einem netten, mütterlichen Wesen, aber sie war im Laufe der Zeit dünn und hager geworden. Ameena, seine jüngere Ehefrau, hatte er erst vor kurzem geheiratet. Sie hatte jene Sanduhrfigur mit langen Beinen, welche Männer so oft zum Träumen bringt. Ameena war ein guter Erwerb gewesen, denn auch wenn man ihr die harte Arbeit auf dem Bauernhof erst beibringen musste, so war sie durchaus lernwillig. Vorerst lagen ihre Vorzüge allerdings eher darin, ihm den Tag zu versüßen und die Kinder zu beaufsichtigen. Aber Khadija mit ihrer netten Art hatte schon erste Erfolge erzielt, und so war Ameena bereits zeitig unterwegs gewesen und hatte die Ziegen auf die Weide gebracht, und Nachmittags wieder geholt und danach gemolken. Jetzt saß die Familie bei einem gemütlichen Abendessen, als zur Tür und den Fenstern die Mündungen italienischer Gewehre in den Raum gehalten wurden.
„Die Hände hoch und an die Rückwand!“ bellte eine befehlsgewohnte Stimme in gebrochenem, aber verständlichem Arabisch. „Rasch, rasch, dann geschieht euch nichts!“ Maggiore di Fouccini und Lugotenente Plamazzo drängten in den Raum.
„Wir brauchen einige Vorräte, also, wo sind sie?“
„Wir besitzen aber selbst nicht sehr viel, Alsyd. Bitte, wovon sollen wir denn leben?“
Der Major breitete seine Arme aus. „Wenn ihr euch nicht wehrt, könnt ihr es herausfinden. Wenn ihr euch zum Widerstand entschließen solltet, braucht ihr keine Vorräte mehr. Also, entscheidet euch!“
Khadija trat nach vorn. „Ich zeige euch, wo alles ist.“
Major Giancarlo di Fouccini nickte zufrieden. „Lugotenente, gehen sie mit und sorgen sie dafür, dass alles in Ordnung abläuft! Sie wissen, was ich befohlen habe.“
„Ich finde trotzdem, es war nicht gerecht, ihr habt doch dieses eine tolle Weib gesehen, das der Kerl hatte“, räsonierte Sergente Frasmino. „Dieser schwarze Kerl hat so eine heiße Frau doch gar nicht verdient. Aber nein, für den Maggiore sind das ja auch so etwas wie Menschen, und wir gehen leer aus! Was dem wohl sonst noch alles einfällt! Verdammt, wie lange hatte ich schon keine Feige mehr vor der Flinte!“
„Immerhin müssen wir nicht mehr zu Fuß gehen“, bemerkte Corporale Mentretti. „Und wir haben auch einiges zu essen mit!“
„Aber keinen Wein, zum Teufel“, schimpfte der Sergente. „Schwarz und Moslem war der Kerl, keinen Wein für uns und keine Weiber. Das wird ein trauriger Feldzug, sag ich dir. Ein ganz ein trauriger. Gar kein Spaß wird für uns dabei sein, nur Pflicht, Pflicht und noch einmal Pflicht!“
=◇=
Noch nicht weit von den Italienern entfernt steuerte Corporal Finn O’Monnebran den dreiachsigen Rover des britischen Corps of Engineers in Richtung Abessinien.
„Was wollen sie machen, wenn wir diesen Wagen mit der Riesentrommel wirklich einholen, Captain?“
John McIvor zuckte mit den Schultern. „Ich habe keine Idee, Corporal. Wirklich nicht! Finden und bringen sie uns dieses Ding, der Colonel hat leicht reden. Freiwillig werden uns die Äthiopier diese Trommel kaum geben. Und selbst wenn wir die Begleitung niederkämpfen können, wie wir das Ding irgendwo hin bringen sollen, wenn uns das halbe Land jagt, da habe ich noch überhaupt keinen Plan. Aber erst einmal finden, dann weiter überlegen!“
„Aber Captain…“
„Hören sie auf zu fragen, O’Monnebran!“ Die Stimme McIvors deutete die Möglichkeit eines Ende der Karriere des Fahrers als Corporal und eine Menge Ärger an, wenn er weiterhin so neugierig blieb. „Immer den Spuren nach, Corporal, solange die Äthiopier auf Sand geblieben sind, können sie diese Fährte doch gar nicht verfehlen!“
Der Trupp hatte in Josephshafen den Untergang der italienischen Flotte geschildert, und sich über das Tempo der Rettungsvorbereitung gewundert. Über den Linienkapitän Eugen Popescu, Herzog von Bistritz, hatte man mit ihm verständlicherweise nicht gesprochen, der Weradler hatte die Stadt auch schon längst wieder verlassen. Nur wenige Stunden später war ein chiffriertes Telegramm des Sirdar aus Kairo eingetroffen, neue Befehle für den Captain und seinen Trupp. Also hatte der Captain seine Vorräte ergänzt und war danach wieder aufgebrochen. Kitcheners Befehl war denkbar ziemlich einfach gewesen. ‚Finden sie heraus, was die Italiener besiegt hat und besorgen sie es mir!‘ Und da ein Colonel nun einmal mehr Sterne auf der Schulter als ein Captain hatte und der Sirdar zudem auch der militärische Befehlshaber im Gebiet des Khedive von Ägypten war, machte sich McIvor mit seinem Leuten und dem Dampfrover eben wieder auf den Weg! Aus ihren Beobachtungen war es für sie nicht schwer gewesen, den Punkt zu finden, an welchem diese Trommel gestanden hatte, und von hier war es auch kein Problem, die Radspuren Richtung Westen zu finden. Noch nicht, aber zumindest hatten sie eine grobe Richtung. Für das zerklüftete, vulkanische Gebiet war der Rover ein gutes Fortbewegungsmittel, die 10 Räder auf drei Achsen sanken in der Mischung von Sand und Vulkanstaub nicht allzu tief ein und erlaubten immerhin eine Geschwindigkeit von etwa 30 Kilometer pro Stunde.
„Wir sind jetzt in der Mallahle Vulkangruppe, Sir“, meldete der Fahrer wenig später. „Im Norden, das ist der große Krater Aruku, und im Süden liegt Sork Ale. Wenn wir weiter in diese Richtung fahren, kommen wir zum Afrera-See.“
„Sehr gut, Corporal!“
„Und dann fangen die Probleme erst an, Sir“, jammerte der Corporal. „Am See wird Salz gewonnen, und zu Tonnen auf das abessinische Hochland transportiert. Von dort die Spur weiter zu verfolgen, das wird nicht leicht!“
„Folgen sie einstweilen der Spur, Corporal“, befahl der Captain. „Wecken sie mich, wenn eine Entscheidung ansteht!“
Darauf konnte O’Monnebran nur eine Antwort geben, und er gab sie natürlich. „Aye, Sir!“
„Na also“, brummte Captain McIvor, lehnte sich bequem zurück und zog sich die Uniformmütze ins Gesicht, während Corporal O’Monnebran die Spur genau im Auge behielt.
=◇=
London, 221 Baker Street
Wie beinahe jede Stadt den ausgehenden 19. Jahrhunderts zeigte London viele verschiedene Gesichter. Vorwiegend aber das des alten London mit seinen engen Gassen, noch mit altem, buckeligem Kopfsteinpflaster belegt, den Malls, den Subterrainwohnungen, deren Bewohner aus den für sie hochliegenden Fenstern die Beine der vorübereilenden Passanten sahen. Die endlosen gleichen Häuser mit den außen liegenden Feuertreppen, wie man sie fast nur in Britannien und den britischen Kolonien findet. Für viele dieser Viertel schien ein Maler ausschließlich die Braun- und Grautöne seiner Palette zu benötigen, denn auch die Kleidung der Menschen, ja selbst ihre Haut schien ausschließlich diese Farbe aufzuweisen. Die ganz wenigen Farbakzente setzten einige Ladenschilder, die dunkelblauen Uniformen der Peeler und die etwas helleren der Heilsarmee. Besonders Whitechapel und Cannary Wharf, der Dockbereich des Hafens der gigantischen Stadt an der Themse, gehörten zu diesen Bezirken. Seit dem letzten großen Brand 1666, der London zum größten Teil dem Erdboden gleichgemacht gemacht hatte, durchzogen allerdings auch einige breite Straßen als Sichtachsen die Stadt. Sir Christopher Wren, der königliche Hofarchitekt, hatte ja eine beinahe komplett eingeebnete Stadt vorgefunden, am Themseufer hatten das Feuer gerade noch der Tower und einige wenige Gebäude überstanden. Damals entstand auch die berühmte Saint Paul’s Cathedral, der Palast zu Winchester und der Kensington Palace, sowie wunderbare Gärten und Parks. Und am Rand der Stadt die Herrenhäuser der begüterten Schichten.
Obwohl nach dem ‚Great stink‘ im Sommer 1858, als die Themse mehr aus Fäkalien als aus Wasser zu bestehen schien, kontinuierlich an einem Kanalsystem gearbeitet wurde, gab es nur ganz wenige Stellen in London, in denen es nicht ganz erbärmlich stank. Dieser unangenehme Geruch war nicht wirklich definierbar, es roch nach scharfen Chemikalien, nach organischen, verbrannten und verfaulenden Stoffen, vor allem aber nach dem Rauch von Kohle und Torf. Außerdem war zu dieser Zeit London noch in weiten Teilen eine extrem schmutzige Stadt, deren Bewohner weiterhin allen möglichen Unrat einfach auf die Straßen warfen. Es gab zwar bereits seit einiger Zeit so etwas wie eine Müllabfuhr, genau genommen länger als in den anderen europäischen Städten. Gleich drei Unternehmen sollten die Straßen von Abfall und Schmutz freihalten und auch die Hinterlassenschaften der Verdauung von vier- und zweibeinigen Londonern von den öffentlichen Flächen entsorgen. Es funktionierte allerdings mehr schlecht als recht, die Unternehmer kassierten zwar von den Kommunen hohe Beträge, leisteten jedoch kaum nennenswerte Gegenleistung. In Ratcliff, Limehouse und Canary Wharf konnten die Bewohner in den verkehrsarmen Nebengassen Pflanzen auf dem Schlamm, vermengt mit Abfällen und Ausscheidungen aller Art ziehen. Der Unrat lag dort mehr als 20 Zentimeter oder noch mehr hoch. Dazu kam noch, dass viele der Industriebarone ihre Betriebsstätten aller Art immer noch in London aufrecht erhielten und die Dampfkessel ihrer Maschinen weiterhin mit dem billigen Torf oder Kohle von den eigenen Ländereien heizten. Statt in neue Kessel zu investieren und zu sauberem Vaporid zu greifen, bliesen sie auch Ende des 19. Jahrhunderts noch fette, schwarze Qualm- und Rußwolken in die Luft. Eine schwächere Abart von Vaporid, das Steampowder, wurde zwar in Britannien selbst hergestellt, jedoch im größeren Umfang nur von der Navy, der Army und einigen Transportunternehmen zu Wasser, zur Luft und auf der Schiene verwendet. Trotzdem sah man auf dem Wassern Britanniens manches Mal noch die alten, großen Frachter, bei welchen man die Kessel noch immer nicht umgerüstet hatte und mit Kohle beheizte. Auch das Rail- und Subwaynetz im Empire waren noch nicht komplett von der Kohle abgenabelt. Von einem umfassenden Dampf- oder Elektrizitätsnetz, wie es anderen Teilen des britischen Weltreiches, etwa in Liverpool, in Glasgow, in Dublin oder sogar in British Kairo, Bombay, ja selbst in Kalkutta und Hyderabad in Indien oder Hongkong in China bereits an der Tagesordnung war, konnte man in London bislang nur träumen. Hier war Konservatismus in seiner reinsten Form zu erleben.
Die Baker Street war eine der breiteren und reineren Straßen Londons. Zwar nicht vergleichbar mit etwa der Fleetstreet oder ‚the Strand‘, aber sie gehörte unzweifelhaft zu den besseren Adressen Londons. Hier hatte in der Nummer 221b im ersten Stock eines der Häuser auch ein sehr prominenter Bewohner der Stadt sein Domizil aufgeschlagen. In letzter Zeit war es allerdings etwas ruhig um den asketisch wirkenden, groß gewachsenen Mann geworden. Seit Doktor Watson in einer seiner Geschichten das Ableben seines Freundes bekannt gegeben hatte, waren zunehmend nur noch ernst zu nehmende Kunden aufgetaucht. Jene, die sich die Mühe machten, die Berichte des unermüdlichen Chronisten Watson einer eigenen Prüfung zu unterziehen und jene, die sehr verzweifelt auf der Suche nach einem allerletzten Strohhalm waren. So wie jene junge Dame, welche eben die Treppe zur Wohnung des berühmtesten aller Detektive erklomm und beinahe schüchtern an seine Tür pochte.
„Als ich spät noch saß zur Nacht – suchte, was ich fände noch an Macht – in der alten Bücher Lehr, als ich plötzlich hört ein Pochen“, deklamierte Sherlock Holmes mit erhobener Stimme. „Würden Sie diesem Pochen bitte nachgehen, mein lieber Doktor Watson?“
„Aber gerne, Holmes.“ Doktor John Hamish Watson öffnete die Tür mit Schwung, und Sherlock deklamierte weiter.
„Verzeiht, hab euer Pochen kaum vernommen, meine Sinne waren schon benommen, doch tretet ein, Madame.“
„Danke sehr. Aber ich hoffe doch sehr, sie haben einen Stuhl für mich, Mister Holmes. Oder sollten sie mir wirklich nur eine Athene-Büste zum niedersetzen anbieten können?“, fragte eine noch junge Dame in etwas formloser, einfach geschnittenen Kleidung in gedeckten Farben und trat ein. „Zumindest denke ich, sie müssen der berühmte Mister Sherlock Holmes sein. Und wenn ich davon ausgehen darf, so ist wohl dieser Herr Doktor John Hamish Watson!“
„Zu ihren Diensten, Madame“, verneigte sich der Doktor höflich.
„Das möchte ich doch sehr hoffen, Doktor“, lächelte die Frau Watson an. „Könnten sie bitte die Tür schließen?“
Watson kam dieser Bitte umgehend nach. „Aber selbstverständlich, Madame.“
Holmes hatte sich erhoben und schritt um die junge Frau herum, während er mit seinem Zeigefinger seine Lippen klopfte.
„Nun, Watson, wir haben hier vor uns die Schwester eines Mannes, der in Schwierigkeiten steckt“, begann er. „Und zwar ist die junge Dame die Schwester eines Polizisten. Eines DI, der in der Whitehall Avenue mit seinem Revolver herum geschossen und, nachdem er aus einer Ohnmacht erwachte, seltsames Zeug von sich gegeben hat. Man hat ihn nach Bedlam gebracht, und diese junge Dame, Miss Leonore Ponder, möchte uns bitten, mit ihrem Bruder, DI Joseph Ponder zu sprechen.“
„Das ist wahrhaft erstau…“ wunderte sich Watson, dann verengten sich seine Augen zu schmalen Schlitzen. „Moment, das alles stand wohl in dem Brief, den Sie vorhin geöffnet und gelesen haben, Holmes! So gut deduzieren nicht einmal Sie! Und deshalb rezitierten Sie bereits dieses Gedicht von Poe, ‚die Krähe‘, noch ehe Miss Ponder pochte!“
„Exzellent kombiniert, mein lieber Doktor, sie machen Fortschritte“, freute sich Holmes. „Nur – das besagte Gedicht nennt sich ‚der Rabe‘. DI Lestrade bittet uns in diesem Schreiben, mit der Miss zu sprechen und, wenn es eine Möglichkeit gibt, ihrem Bruder zu helfen. Er möchte, dass wir uns auf inoffiziellem Wege umhören, denn eigentlich gibt es ja gar keinen Fall. Leider spricht alles für einen Nervenzusammenbruch des Detektiv Inspector. Soweit korrekt, Miss Ponder?“
„Das ist absolut richtig, Mister Holmes“, nickte Leonore.
„Hat denn Scotland Yard überhaupt keine Untersuchung angestellt“, wunderte sich der Doktor.
„Der Commissioner hat eine Untersuchung angeordnet, Doktor, aber der DS, welcher meinen Bruder fand, hat nur herausgefunden, dass er vorher bei einem Medium eine Seance besucht hat. Dort soll ihn irgend ein Umstand so heftig erregt haben, dass er Hals über Kopf das Haus verlassen habe. Die Dienstboten der Lady Abigail Chesterton konnten ihn leider nicht mehr einholen.“
„Nun, für Leichtgläubige kann die Teilnahme an einer Seance schon erschreckend sein, Miss. Diese Leute verstehen ihr Handwerk! Darf ich ihnen eine Tasse Tee anbieten?“ John hielt die Kanne hoch.
„Ich bitte darum. Keinen Zucker, nur ein Tröpfchen Milch, bitte. Danke, Sir.“ Leonore nahm ihren Tee entgegen. „Das Problem bei dieser Annahme ist nur, dass mein Bruder keineswegs ein leichtgläubiger Charakter war. Er war im Gegenteil davon überzeugt, dass man Scharlatanen wie solchen selbsternannten Medien das Handwerk legen müsse, da sie Betrüger sind und dazu die Wahrsagerei den religiösen Grundfesten der Kirche von England widerspricht. Er war, man kann es nicht anders nennen, immer noch eine Art anglikanischer Fundamentalist durch und durch.“
„Sie selbst sehen diesen Glauben allerdings etwas weniger streng.“ Sherlock hatte seine gebogene Pfeife aus Meerschaum zur Hand genommen und stopfte sie voller Hingabe mit einem Tabak, den er selbst unter zu Hilfenahme eines kleinen Schwämmchens mit edelstem Brandy parfümiert hatte. Der herbe Geruch des edlen Mac Baren Burley Tabaks, vermischt mit dem feinen Duft des Weinbrandes von Barrel Brothers mit der feinen Honignote darin erfüllte den Raum. „Sie gestatten doch?“
„Es ist ihr Haus, Mister Holmes“, bekundete die Dame. „Aber wie kommen Sie darauf, dass ich weniger fundamentalistisch bin als mein Bruder?“
„Sie tragen Schmuck, wenn es auch nur eine kleine Brosche ist, ihr Gewand ist zwar nicht nach der allerneuesten Mode, dennoch aber von gewissem chic und zeigt einige farbliche Accessoires, und Sie tragen, wenn ich das bemerken darf, recht hübsche Schuhe“, zählte Sherlock Holmes auf. „Außerdem sind sie mit zwei alleinstehenden Gentlemen allein in deren Wohnung, ohne das geringste Anzeichen einer Anspannung zu zeigen, wie ich sie leider sehr oft bei extrem konservativen Damen in einer solchen Situation wahrnehmen musste.“
„Nun….“ Leonore Ponder zögerte etwas. „Ja, Sie haben recht, ich denke bei weitem weniger konservativ als mein Bruder, und mein Verlobter bestärkt mich darin eher noch. Ich bitte Sie nur, es meinem Bruder nicht zu erzählen, denn nach dem Gesetz ist er mein Vormund. Und er könnte die Hochzeit noch verhindern wollen, erführe er von den liberalen Ansichten von Mister Honybridge.“
Holmes verbeugte sich im Sitzen. „Selbstverständlich werden wir Ihre und die Ansichten Ihres Verlobten mit der allergrößten Diskretion behandeln, Miss Leonore. Ich werde mit dem größten Vergnügen helfen. Doktor Watson und ich werden uns sofort auf den Weg nach Bedlam machen.“
Leonore Ponder erhob sich, und selbstverständlich auch die Herren. „Dann darf ich mich verabschieden. Mister Holmes, Doktor Watson, ich bin entzückt, sie kennen gelernt zu haben. Auf Wiedersehen, meine Herren!“
„Das Vergnügen ist ganz auf unserer Seite, Miss Leonore“, versicherte Watson, während er der Dame die Türe aufhielt.
Kaum war die Türe geschlossen, warf Holmes seinen rot-goldenen Hausrock ab und schlüpfte in Weste und Sakko.
„Sie erstaunen mich, Holmes“, wunderte sich der Doktor. „Ich hätte nicht erwartet, dass sie sich mit einer derartigen Bagatelle abgeben!“
„Nichts, das die königliche Familie des Empire angeht, ist eine Bagatelle, mein lieber Watson!“ Mit geübten Fingern band Holmes seine Fliege um den Hals.
„Die königliche…“ Watson stockte der Atem.
„Aber natürlich, mein Bester.“ Holmes schlüpfte in seine Schuhe. „Auf welches Alter würden sie unsere Besucherin denn schätzen?“
„Also, Holmes, Damen und – also, bitte, so etwas tut ein Gentleman doch nicht“, wand sich der etwas konservative Watson.
„Los, Doktor, raten sie!“ Holmes machte mit der linken Hand eine auffordernde Geste, während er mit der rechten einige Gegenstände in sein Jackett steckte. „Sie als Mediziner müssten doch eine ungefähre Vorstellung haben. Zwanzig? Dreißig? Vierzig?“
„Nun“, Doktor Watson ergab sich in sein Schicksal. „Sicher älter als zwanzig, aber ebenso sicher noch keine vierzig. Dreißig erscheint mir recht realistisch.“
„Gut, mein lieber Freund. Erinnern sie sich an ihre Gesichtszüge?“ Der Detektiv warf seinen Invernessmantel über die Schultern und griff zum Zylinder. „Stellen sie sich jetzt dieses Gesicht älter vor, die Haare straff gescheitelt und nicht gelockt!“
„Alle Teufel, Holmes!“
Sherlock griff nach einem Buch und schlug den Vorsatz auf. „Das britische Adelsregister aus dem Jahre 1852, damals war unsere verehrte Monarchin Queen Victoria 33 Jahre alt und ihr damals aktuelles Portrait zierte selbstverständlich das Buch.“
„Diese Ähnlichkeit – es ist verblüffend, Holmes!“ Watson drehte das Buch hin und her.-
„Wir müssen noch dazu rechnen, dass diese Frau mit dreißig unverheiratet und Mündel ihres Bruders sein möchte, eines stockkonservativen Bruders wohlgemerkt, und einen liberal denkenden Verlobten haben will“, fuhr Holmes fort. „Wäre sie ein Mündel dieser Person, hätte dieser bereits für eine Hochzeit mit einem ihm bekannten ebenso konservativen Mann gesorgt. Dazu kommt noch die kleine, aber sehr hübsche Brosche.“
„Ein blauer Löwe auf goldenem Grund, umgeben von einer Anzahl Herzen“, erinnerte sich Watson, während auch er in den Mantel schlüpfte und zum Hut griff. „Und?“
„Dieses Symbol in dieser Farbkombination ist Teil des Wappens der Hannoveraner, welche, wie sie wissen, das Geschlecht unserer Queen sind! Ich darf bitten?“, winkte der Detektiv Doktor Watson hinaus, verließ selbst die Wohnung und verschloss die Tür.
„Dann war die junge Dame ein Mitglied…“
„Ich denke, wir hatten Besuch von ihrer königlichen Hoheit, Prinzessin Beatrice, Doktor.“
„Und Lestrade?“, fragte der Doktor immer noch fassungslos.
„Der gute, alte DI Lestrade“, lächelte Holmes sprsamst. „Ich denke, er hat vom Commissioner den ausdrücklichen Befehl erhalten, die Geschichte mit der Schwester zu glauben. So wie auch wir indirekt den Befehl erhalten haben, uns daran zu halten. Sonst hätte uns ihre Hoheit sicher zu sich gebeten, statt uns zu besuchen! Also, Watson, wir besuchen jetzt DI Ponder auf die Bitten seiner Schwester Leonore.“
Auf der Straße hielt Holmes einen der herumlaufenden Jungen am Arm fest. „Nicht so hastig, Jimmy Japp! Du hast doch noch deine Bande, die ihre Augen überall hat?“
„Natürlich, Mister Holmes“, krähte der Junge. „Wenn man ein guter Detektiv werden will, braucht man seine Connections!“
„Das ist gut, Jimmy. Wenn du alt genug bist, solltest du dich bei Scotland Yard bewerben. Ich werde dich dann empfehlen“, versprach Holmes. „Aber jetzt hör einmal zu. Ich möchte, dass du und deine Bande diese Adresse im Auge behaltet und diesen Mann auftreibt und ebenfalls gut beobachtet. Ich will jeden seiner Schritte wissen, klar!“ Holmes steckte dem ärmlich, aber sauber gekleideten Knaben einen Zettel und eine Half Crown zu.
„Ganz klar, Meister! Ein feiner Pinkel mal wieder, Mister Holmes.“ James Japp studierte die Angaben. „Was hat denn der Aidan Allistair of Saussage ausgefressen?“
„Wenn ich das schon wüsste, bräuchte ich dich doch nicht, kleiner Mann“, erklärte Holmes. „Abmarsch, und ihr wisst, wenn eure Informationen gut sind, springt auch was raus für euch!“
„Der Auftrag wird prompt erledigt! Auf Wiedersehen, Mister Holmes. Tschüss, Doc!“

Gemeinsam schritten die Herren die Baker Street entlang zur Marylebone Street, wo sie auf eine vorbei kommende Droschke hofften. Eine Hoffnung, die auch nicht enttäuscht wurde. Schon wenige Minuten später hielt ein zweirädriger Mietwagen mit vorgespanntem Vaporidkessel auf einem lenkbaren Rad schnaufend und pfeifend vor dem winkenden Holmes und Doctor Watson.
„Und dieser Krach ist also die Zukunft, Holmes! Warum in aller Welt muss man die schönen Gäule durch solch laute Teekessel ersetzen!“ Der Doktor schüttelte den Kopf. „Reicht es denn nicht, dass Eisenbahnen und Schiffe damit unterwegs sind? Müssen sie sogar auf den Straßen herum fahren?“
Holmes lächelte. „Mein lieber Freund, ich muss ihnen zustimmen, wenn es um torf- oder kohlebeheizte Dampfmaschinen geht. Aber diese Vaporidkessel haben schon ihre Vorteile. Vor allem sind sie sauberer!“
„Ach was, ein paar Pferdeäpfel haben noch niemand krank gemacht“, brummte der Arzt.
„Es gibt Gassen in London, da ziehen die Bewohner ihr Gemüse im 8 Zoll hohen Unrat, Doktor“, gab Holmes zu bedenken.
„Sollen sie doch froh sein“ versetzte Doktor Watson. „Bei den Preisen, die das Grünzeug heutzutage auf dem Markt kostet!“ Mittlerweile hatten sie über die Bond und die New Bond Street die Saint James Street erreicht und die Pall Mall und the Mall überquert, um in den Birdcage Walk zur Westminster Brigde abzubiegen.
Das Bethlehem Royal Hospital, im Volksmund Bedlam genannt, lag seit 1815 am südseitigen Themseufer im Stadtteil Southwark in einem großen Garten an der Lambeth Road. Es hatte als erste psychiatrische Klinik zwei Abteilungen, eine für unheilbare und eine für als heilbar eingestufte Patienten erhalten. Besonders schön oder gar angenehm war das Leben in beiden Abteilungen nicht, man versuchte die meisten heilbaren Fälle mit Kaltwasser- oder Elektroschockkuren zu therapieren, wenn man nicht gleich zu so seltsamen Methoden wie Schädelöffnungen griff. Allen damaligen Behandlungsmethoden für psychische Krankheiten war einiges gemeinsam. Sie waren zumeist physisch, brutal und schmerzhaft. Von der Psychoanalyse war man in ganz Europa noch ziemlich weit entfernt, selbst Siegmund Freud arbeitete neben der Hypnose noch des Öfteren mit der verbreiteten Elektrokrampftherapie. Einige wenige Glückliche wurden auch schmerzlos mit Homöopathie behandelt, welche damals in Großbritannien eben auf dem Vormarsch war, aber vor allem die älteren Ärzte hatten schwerste Bedenken gegen dieses neumodische Zeug. Eine große Wanne mit Eiswürfel, ein Feuerwehrschlauch mit ordentlich Druck oder ein Transformator, der ordentlich elektrischen Strom abgab, Hammer und Hohlmeißel, vielleicht noch ein Bohrer, mit dem man Stücke aus dem Schädelknochen fräsen konnte, das war doch immer das einzig Wahre und Vernünftige!
Obwohl das Gebäude der Klinik architektonisch durchaus ansprechend und freundlich gestaltet war, hing doch eine psychische Niedergeschlagenheit wie eine dunkle Wolke über dem Hospital, dem Holmes und Watson sich nun näherten.
„Es ist dies die modernste Klinik ihrer Art, Holmes“, bekundete der Doktor und strich über den Schnurrbart. „Hier wird seit vorigem Jahr mit dem neuesten Gerät zur Elektrokrampftherapie gearbeitet, die wesentlich wirkungsvoller auf den Organismus wirken als die alten. Und sie haben jetzt eine eigene Eismaschine angeschafft, mit der sie die Wanne füllen können, in welcher der Patient liegt. Sie müssen das Eis nicht mehr blockweise liefern lassen und danach lagern.“
„Das, mein lieber Doktor, hört sich für mich eher nach gezieltem Sadismus als nach medizinischen Heilmethoden an!“ Holmes betrachtete das Gebäude mit dem Türmchen und den vergitterten Fenstern.
„Aber Holmes, dass sind die neuesten wissenschaftlichen Standards, mit denen man Schizophrenie und Depressionen heilen kann“, erklärte Watson. „Und der neue Arzt arbeitet jetzt mit einem ganz feinen Hohlmeißel und einem winzigen Hämmerchen. An der richtigen Stelle angesetzt, beruhigt es den Patienten auf der Stelle! Man kann doch nicht zulassen, dass der Patient sich oder andere verletzt!“
„Natürlich nicht, mein lieber Doktor“, bestätigte Holmes und betrachtete intensiv die Fenster unter der Kuppel. „Das sollte doch wohl wirklich ein Monopol der professionellen Ärzte bleiben. Wo kämen wir hin, wenn jeder Amateur jemand anderem eine Verletzung zufügen dürfte!“
„Ganz recht, Holmes. Ganz re…, was sehen sie denn dort so interessantes an den Fenstern im Turm. Da ist doch nichts!“
„Ganz genau, Doktor!“ Holmes sah den Doktor an. „Dort ist nichts zu sehen!“
„Nun, warum sehen sie dann so interessiert hinauf“, wunderte sich der Mediziner.
„Warum sind gerade die am höchsten gelegenen Fenster nicht vergittert, Doktor?“
„Vielleicht weil… nun, wahrscheinlich… es werden Zimmer für das Personal sein“, vermutete Watson endlich. „Oder ein Bereitschaftsraum für Wachposten.“
„Alles gute Vorschläge, mein lieber Watson“, bekundete Holmes geistesabwesend. „Aber… nun, vielleicht hat dieses kleine Detail ja auch überhaupt nichts mit DI Joseph Ponder zu tun. Sogar sehr wahrscheinlich nicht. Ich werde es mir aber einmal vormerken.“
„Dann lassen sie uns gehen, Holmes“ forderte der Arzt seinen Freund auf. „Und bitte keine anzüglichen Bemerkungen über die Kuren, wie sie sie mir gegenüber kund getan hatten!“
„Selbstverständlich. Ich werde dies bezüglich schweigen wie ein Grab, mein lieber Watson. Bitte, nach ihnen, werter Freund. Hier sind sie zu Hause.“
Watson sah den Freund finster an, der abwehrend die Hände hob. „Fachlich, alter Freund, rein fachlich als Arzt natürlich!“
Vor der Eingangstür aus massiver Eiche war ein kleiner, bogenförmiger Säulengang, auf dem einige Stühle und Aschenbecher bereit standen. Eine Frau im Habit eines anglikanischen geistlichen Ordens stand neben einem Mann, welcher einen weißen Mantel über seinen Anzug gezogen hatte und hektisch eine Zigarette rauchte.
„…braucht keine Eiskur mehr, Doktor. Ich fürchte, er würde die nächste nicht mehr überleben. Sein Körper macht die beständigen Unterkühlungen einfach nicht mehr mit! Geben sie ihm doch eine Pause, um sich zu erholen“, hörten die beiden Herren die Schwester sagen.
„Gut!“ Der Arzt nahm noch einen tiefen Zug. „Ich nehme das auf meine Kappe. Es wäre tatsächlich nicht sehr opportun, wenn der Mann geistig gesund an Lungenentzündung oder ähnlichem stürbe. Geben sie ihm statt dessen drei Mal täglich 5 Tropfen Kalium D 3 und 8 Tropfen Arsen D… nehmen sie D 6. Danke Schwester Theodora. Sie sind wirklich eine gute Seele für die Patienten. Ja bitte, meine Herren“, wandte er sich an Holmes und Watson.
„Doktor John Watson, dies ist mein Freund Mister Sherlock Holmes.“ Beide nahmen kurz den Hut ab. „Wir kommen, um uns im Auftrag seiner Schwester nach Mister Joseph Ponder zu erkundigen!“
„So? Nun, da hat sich die Dame aber reichlich Zeit gelassen!“ Der Mann warf seinen Zigarettenstummel einfach zur Seite. „Ich bin Alexander Pope. Doktor Alexander G. Pope. Nicht verwandt, nicht verschwägert, aber recht ähnlich im Geiste!“ Er rieb sich über das müde Gesicht.
„Der etwas konservative Gatte der Dame hat etwas dagegen, sie den Unbillen der zugegeben harten und grausamen Welt auszusetzen, Doktor Pope“, erklärte Sherlock. „Sie kam zu mir, meiner Diskretion vertrauend – wie ich ihrer Verschwiegenheit als Arztes vertraue, sollte der Gentleman dem Wunsch der Dame doch noch nachkommen wollen und sich tatsächlich nach seinem Schwager erkundigen!“
„Dessen können sie natürlich versichert sein, Mister Holmes“ versicherte A. Pope. „Aber bitte, folgen sie mir, Gentlemen. Was reizt den besten Detektiv Londons eigentlich… nein, das geht mich absolut nichts an. Entschuldigen sie mir, auch ein Arzt kann dem Laster der Neugier frönen. Sind sie eigentlich sicher, dass die Dame seine Schwester ist, Mister Holmes?“
„Nun…“ Der derzeit beste Detektiv zögerte kurz. „Ich bin eigentlich ziemlich sicher, was die Identität der Dame angeht. Und ich habe mich bisher nur einmal in einer Dame geirrt.“ Watson hustete und hielt zwei Finger hoch. „Ja, schon gut, Watson! ZWEI Mal. Aber dass Lady Cecily dieses Kleid, welches ihr von ihrem Ex-Verlobten präsentiert wurde, nach der Trennung von diesem untreuen Mann tatsächlich ihrer Zofe weiterschenkte, und diese mir in genau diesem Kleid dann auch noch in der Eisenbahn begegnete – ja, ja, in Ordnung, ich gestehe, ich habe mich in der jungen Dame geirrt. Sie sagte wirklich die Wahrheit. Sind sie jetzt zufrieden, werter Doktor? Wollen sie auch noch eine Zigarre?“ Watson tippte grinsend mit dem Knauf seines Spazierstocks an seine Hutkrempe. „Aber, wie gesagt, bei besagter Dame bin ich mir betreffend ihrer Identität beinahe absolut sicher.“
„Wie geht es DI Ponder denn eigentlich“, ergriff nun Doktor Watson das Wort.
„Das ist seltsam!“ Seine Hände tief in den Taschen vergraben schlenderte Doktor Pope mit den Herren durch Gebäude des Hospitals. „Er ist an sich völlig Herr seiner Sinne, aber es fehlt im jede Erinnerung vor seinem Aufwachen hier in der Klinik. Wir haben ihm erklärt, wer und was er ist, und er hat bemerkenswerte Geistesgaben bewiesen. Doch wir beschreiben die gesamte Tafel praktisch neu. Hier hinauf, Gentlemen!“
„Nicht die geringste Erinnerung? Kein kleiner Schatten“, hakte Watson nach.
„Nun, er spricht flüssig Englisch, kann lesen, schreiben und rechnen, zitiert aus den Werken von Shakespeare und kennt die Theorien Newtons. Er weiß, wer die Queen ist, kennt ihre Kinder und kann auf einem Globus viele der bekannteren Länder richtig zuordnen. Er kennt das Datum, nachdem wir ihm die Länge seiner Bewusstlosigkeit erklärten. Er hat eine phänomenale Bildung, an welche er sich scheinbar vollständig erinnert. Aber er hat keine Ahnung, wie er dazu gekommen ist. Alles, was seine Person betrifft, ist völlig ausgelöscht!“
„Hmm!“
„Doktor Watson, sie haben einen eigentümlichen Gesichtsausdruck“, kam Holmes nicht umhin, es zu bemerken.
„Eine Erinnerung, Holmes. Es – es ist noch zu früh, etwas konkretes zu sagen. Sie haben die Sachen des DI unter Verwahrung, Doktor Pope?“
„Aber selbstverständlich, Doktor Watson!“
„Dürfte ich sie dann bitten, sein Hemd bringen zu lassen? Ich hoffe, ihre Reinigung war noch nicht…“
„Nein, Doktor“, wehrte Pope ab. „Die Polizei hat uns angewiesen, bis auf weiteres nichts zu verändern und alles so zu behandeln, als lägen ungeklärte Umstände vor! Bitte warten sie hier einen Moment, Gentlemen.“ Pope ging den Gang entlang und öffnete eine Tür mit der Aufschrift Nurses und rief einige Worte in den Raum.
Das Zimmer, in welchem DI Joseph Ponder auf dem Bett saß und in einem Buch blätterte, war ein wenig freundlicher Raum. Die Gitter vor den Fenstern erinnerten eher an ein Gefängnis und die Riemen, welche an dem Bett befestigt waren, gemahnten stets daran, dass selbst die relative Freiheit, sein Bett verlassen und auf die Toilette oder gar in den Garten gehen zu dürfen unter Umständen schnell eingeschränkt werden könnte. Ponder hatte sich das Privileg des täglichen einstündigen Gartenbesuchs teuer erkauft. Mit Geduld und stets ruhiger und beherrschter Laune, mit absoluter Folgsamkeit. Was auch immer mit seinem Gehirn geschehen war, dumm war der Inspektor unter Garantie nicht. So lächelte er seinem Besuch durchaus freundlich zu.
„Guten Tag, Doktor Pope. Meine Herren, sie müssen mir verzeihen, aber ich muss gestehen, ich habe nicht die geringste Ahnung, wer sie sind.“ Er klopfte mit der Hand gegen seinen Kopf. „Beinahe nur leere Seiten, und das wenige, das ich weiß, habe ich auch zweiter Hand erfahren.“
„Das ist tragisch, Sir“, bekannte Holmes. „Mein Name ist Sherlock Holmes, und dieser Gentleman ist Doktor Watson. Wir kommen…“
„Der Sherlock Holmes?“, rief Ponder überrascht. „221 Baker Street? Aber – hat nicht ihr Compagnon geschrieben, sie seien tot?“
„Um einen etwas besseren Schriftsteller als Doktor Watson zu zitieren – die Gerüchte über mein Ableben sind stark übertrieben“, warf Holmes mit einem Seitenblick auf Watson hin.
„Es ist mir eine Ehre, Sir“, zeigte sich der DI erfreut. „Haben wir uns vielleicht bereits vor diesem – Zwischenfall gekannt?“
„Nein, DI, leider nicht.“ Holmes zog sich einen Stuhl heran und sah dem Polizisten direkt ins Gesicht. „Wir sind im Auftrag ihrer Schwester Leonore hier, um uns nach ihnen zu erkundigen. Lestrade – ich fürchte, der Name wird ihnen ebenso wenig sagen wie der ihrer Schwester, aber er ist wie sie DI beim Yard – hat die junge Dame an mich verwiesen, um mich nach ihrem Zustand zu erkundigen.“
„Das ist – sehr nett von dieser Dame, an die ich mich leider überhaupt nicht erinnern kann“, sagte Ponder mit ein wenig Verzweiflung in der Stimme. „Verzeihen sie mir bitte!“
„Es gibt nichts zu verzeihen, Sir. Es müssen schlimme Umstände gewesen sein, welche sie in die Amnesie trieben.“
Ponder runzelte die Stirn. „Das habe ich mir auch schon gedacht, aber…“
„Eine leere Tafel. Ich weiß“, beschwichtigte Holmes. „Vielleicht…“ Ein Pochen unterbrach ihn.
„Die Kleidung des DI.“ Eine Schwester überreichte Doktor Pope das Paket, der es sofort an Watson weitergab. Der öffnete die Umhüllung und zog das Hemd heraus, beroch es ausgiebig und nickte.
„Was ist, Doktor Watson.“ Pope war das Gebaren des ehemaligen Militärarztes aufgefallen, der legte das Kleidungsstück beiseite.
„Doktor Pope, kennen sie die Studie von Huntigworth und Powell zur individuellen olfaktorischen Wahrnehmung des Menschen?“
„Aber ja, selbstverständlich, Doktor Watson!“ Pope massierte sich die Stirn. „Als Beispiel führen die Herren den Geruch von Bittermandeln bei Zyanid an. Nur ein winziger Bruchteil der Menschen ist fähig, diesen Geruch wahrzunehmen. Aber für alle Menschen ist Zyanid bereits in relativ geringer Dosis absolut tödlich.“
„Korrekt, Doktor“, bestätigte John Hamish. „In Indien hatten wir einmal großes Glück, im Offiziersklub einem Anschlag zu entgehen. Ich roch plötzlich etwas befremdliches, das dennoch alarmierend war. Ich schrie damals, dass alle den Raum sofort verlassen sollten, und alle folgten glücklicherweise dem Aufruf. Später fand man die Quelle des Geruches in der Nähe meines Tisches, einige Räucherstäbchen waren mit einem überaus bösartigen Halluzinogen getränkt worden – es nennt sich Mathibrahm. Eine Droge, welche in stark verdünnter Form gerne von Yogis und anderen Gurus eingesetzt wird, um sich selbst in einen Rausch zu steigern und das Publikum empfänglicher für die angeblichen Wunder zu machen. Überdosiert allerdings ruft es nicht nur Halluzinationen hervor, sondern bewirkt auch eine komplette und irreversible Amnesie, und noch höher dosiert den Tod eines Menschen. Forensisch noch nicht nachweisbar, nur durch Nasen wie die meinige eine ist. Mathibrahm ist üblicherweise geruch- und geschmacklos, außer für eine Handvoll Leute auf diesem Planeten. Zu denen ich offenbar zu gehören scheine. Also, wenn dieses Mittel durch den Schweiß des DI nach einer Woche noch derart stark riechend in diesem Hemd sitzt, gehe ich ganz stark von einem misslungenen Mordversuch aus. Es ist wirklich schade, dass sein Gedächtnis derart komplett gelöscht ist – da werden sich keine Anhaltspunkte mehr finden.“
„Das heißt, ich bin völlig normal, treffe mit meinem Hut den Boden und könnte meinen Dienst wieder aufnehmen?“ Ponder kniff die Augen zusammen und atmete tief durch. „Ich müsste nur mit Hilfe von Kollegen und alten Aufzeichnungen wieder Anknüpfungspunkte schaffen. Meine Vergangenheit so weit es wichtig ist neu erlernen, aber das wäre doch immerhin möglich, oder?“
„Meines Wissens nach – und ich glaube, in ganz London werden sie niemanden finden, der besser über Mathibrahm Bescheid weiß – kann in diesem Hospital nichts mehr für sie gemacht werden. Oder überhaupt in einem Krankenhaus. Hoffen wir für sie, dass sie ein Tagebuch geführt haben, DI.“
„Dann könnte ich doch entlassen werden, Doktor Pope“, wandte sich Ponder hoffnungsvoll an diesen.
„Nun – also, wenn Doktor Watson es so darstellt, und nach dem, wie sich der Fall entwickelt hat – wieso eigentlich nicht. Sind sie bereit, Mister Ponder wenn nötig medizinisch zu unterstützen, Doktor? Dann wäre er in ihren Händen besser aufgehoben als in meinen.“
„Ich unterschreibe den Revers selbstverständlich, Doktor Pope. Können wir die Formalitäten erledigen, dann nehmen wir den DI gleich mit und bringen ihn zu seiner Wohnung. Vielleicht finden wir ja ein Photoalbum oder…“ Die Tür fiel hinter den beiden Doctores ins Schloss, und Holmes schüttelte beinahe unmerklich den Kopf.
„Nun, es sieht so aus, als bekämen sie ein neues Leben, DI! Sie haben die Chance, ganz neu zu beginnen.“
Ponder nickte. „Zumindest werde ich viel in Parks spazieren gehen können. Ich hoffe, ich wohne in der Nähe eines solchen, denn ich scheine ein wirklicher Parkliebhaber gewesen zu sein.“
Endlich waren alle Formulare unterschrieben und die Herren saßen in einer Droschke.
„Ich bitte um Entschuldigung, DI, aber ehe wir sie nach Hause bringen, müssten wir noch ein wenig in der Baker Street vorbei sehen. Es dauert nur eine Stunde oder zwei.“ Holmes legte den Zeigefinger an die Lippen.
„Ich bitte sie, Mister Holmes. Ich darf Hosen und ein Hemd tragen, das meine Hände frei lässt. Meine Füße stecken in Schuhen, da draußen ist eine der aufregendsten Städte der Welt, und ich bin in Einschränkungen frei! Was kann es schöneres geben. Ich fasse mich in Geduld.“ In der Baker Street betraten sie das Haus 221, Holmes holte einen kleinen Schlüssel aus seiner Westentasche und überreichte ihn Ponder.
„Wofür ist…“
„Bitte, diese Treppe hinunter, die zweite Tür links. Öffnen sie bitte.“ Sherlock überließ Ponder den Vortritt.
„Sandsäcke? Punchingbälle? Die betreiben Boxen, Mister Holmes?“
„Das weniger, DI Ponder. Doktor Watson nennt dieses Kämmerchen meinen Wutraum, verschweigt ihn allerdings in seinen Büchern über mich geflissentlich. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn im Moment gut gebrauchen können. Wenn sie fertig sind, bitten wir sie auf einen Imbiss und eine Dusche in den ersten Stock. Frische Kleidung wird dann ebenfalls auf sie warten. Nur mit einer Schwester werde ich leider nicht aufwarten können.“
„Mister Holmes, ich habe keine Schwester, und sie wissen das. Warum also diese Scharade?“
„Mister Ponder, eine Dame besuchte mich auf Empfehlung von DI Lestrade und stellte sich als ihre Schwester vor. Ein leicht zu durchschauendes Alias, aber die Stellung der Dame ließ es geraten scheinen, das Spiel mitzumachen. Ich hoffe, sie bringen Licht ins Dunkel. Ihre Erinnerung hat wieder eingesetzt, oder?“
Ponder lachte stoßweise. „Es erschien mir opportun, dies dem Personal in Bedlam nicht mitzuteilen. Holmes, es gibt im Moment nicht viele Personen im Kingdom, denen ich vertrauen kann. Ich habe gehört, ihre erste Loyalität gehört dem Königshaus und dem Empire?“
„Und der Gerechtigkeit, Mister Ponder“, versicherte der Welt bester Detektiv. „Vielleicht nicht immer den Buchstaben des Gesetzes, aber stets der Gerechtigkeit.“
„Das ist gut, Mister Holmes. Denn in diesem Fall dürfen sie, wie ich befürchte, nicht einmal allen Mitgliedern der königlichen Familie völlig vertrauen.“ Der Polizist hatte während des Gesprächs seine Jacke abgelegt und Boxhandschuhe übergestreift.
„Bitte, Mister Ponder, bedienen sie sich“, wies Holmes auf die Geräte. „Wir erwarten sie in einer halben Stunde zum Tee. Bis dahin werden wir nichts unternehmen.“
Holmes und Watson erklommen die Stiege, von unten hörte man laute, unartikulierte Schreie und das rasante Trommeln von gepolsterten Lederhandschuhen auf prall ausgestopftes Leder.
„Nicht jedem Mitglied der royal Family vertrauen? Ist das nicht beinahe Hochverrat?“ Doktor Watson hatte den Hut abgenommen und kontrollierte seine Frisur im Spiegel.
„Natürlich nicht, Watson, es wäre nur Hochverrat, wenn wir etwas gegen die Familie unternähmen.“ Holmes legte den Rock ab und krempelte die Ärmel hoch. „Glauben und Annehmen dürfen wir in diesem Land immer noch alles. Das meiste dürfen wir sogar sagen. Vollständige und irreversible Amnesie?“
„Eine Notlüge, Holmes. Ich bin vielleicht nicht ein so guter Beobachter wie sie, aber ganz blind bin ich nicht. Und niemand kann behaupten, dass ich dumm sei. Wollen sie jetzt etwa eine Dosis?“
„Nein, Doktor, ich möchte kein Morphium, und sie sind beileibe weder blind noch dumm. Ich wäre auch der letzte, so etwas zu behaupten. Allerdings sind sie üblicherweise ein sehr direkter Mensch, dem das Herz gerne auf der Zunge liegt. Diese kleine Spur an Gerissenheit ist bei ihnen sehr selten, mein guter Freund. Aber ich genieße es durchaus, sie auch ab und zu kennen zu lernen!“ Sherlock griff zu seiner Pfeife und entzündete sie. „Der Fall hat ganz entschieden interessante Details, Watson. Sogar sehr interessante Details.“
Als Joseph Ponder die Treppe erklomm, erwartete ihn die reinste Katzenmusik. Holmes stand mit geschlossenen Augen in der Mitte des Raumes und malträtierte mit Hingabe seine Fiedel. Die Saiten klangen kratzig, rau und disharmonisch wie die Stimme der Alkoholsüchtigen in der Gin Lane von Saint Giles.
„Ach, unser Besuch!“ Watsons Stimme war die Erleichterung anzuhören, als Holmes sein Spiel unterbrach. „Bitte, DI, dort finden sie das Bad, und ein Anzug aus ihrer Wohnung ist auch eingetroffen. Fühlen sie sich doch ganz wie zu Hause.“ Als Ponder erfrischt das Badezimmer verließ, saß Holmes in seinem großen Polstersessel und rauchte eine Pfeife, fixierte den DI mit den Augen.
„Ich bin ganz gespannt, was sie zu berichten haben“, bemerkte er. Und Ponder erzählte von dem Auftrag des Commissioner Sir Gerald Wilderson, den Club und die Person betreffend, von seinem Gespräch mit Lady Abigail Chesterton und dem unheimlichen Kopf.
„Da werde ich dieses Teufelszeug wohl schon in mir gehabt haben“, schlussfolgerte der Polizist.
„Nicht unbedingt!“ Holmes sprach am Mundstück seiner Pfeife vorbei.
„Aber wie könnte man sich diese – diese Erscheinung denn sonst erklären“, fragte Ponder und Holmes überlegte nur kurz.
„Mit Spiegeln! Mit Hypnose! Oder vielleicht doch mit Mathibrahm, aber auf jeden Fall glaube ich, dass die Dosis zu diesem Fall noch nicht auf ihren Tod abgezielt war. Irgendetwas haben sie gesehen, und es war nicht PCI Mayborne.“
„Nicht? Aber ich habe gesehen…“, wollte Ponder seine Beobachtung bekräftigen, aber Holmes machte eine wegwischende Geste.
„Der PCI wurde zu jener Zeit von mehreren Zeugen gesehen, und zwar nicht bei Abigail Chesterton. Es muss etwas anderes gewesen sein.“
„Dann – dann weiß ich auch nicht weiter.“ Ponder vergrub verzweifelt das Gesicht in seinen Händen
„Haben sie etwas dagegen, wenn der Doktor ihr Unterbewusstsein befragt?“ Holmes baute aus seinen Fingern ein Dach.
„Hypnose?“, überlegte Ponder. „Ist das nicht auch nur so ein billiger Jahrmarktstrick?“
Holmes grinste süffisant. „Lassen sie sich überraschen, Detektive Inspector.“
„Machen sie es sich zuerst bequem, DI, trinken sie etwas Tee und beruhigen sie sich. Sie auch, Holmes. So aufgeregt, wie wir alle sind, kommen wir doch nie auf einen grünen Zweig. Wir atmen ein paar Mal tief ein und wieder aus, lockern unsere Arme und Beine, unsere Zehen und Finger!“ Die goldene Uhr an Watsons Kette drehte sich hin und her, hin und her, versandte winzige goldene Blitze durch den Raum, drehte sich und her, hin und….
„Tja, Ponder. Dieses Mal hatte Doktor Watson leider wirklich keinen Erfolg, wie ich fürchte. Bitte, DI, fahren sie nach Hause und ruhen sie sich aus.“ Sherlock stand mit den Armen auf dem Rücken am Fenster und sah auf die Straße. Dann drehte er sich um und reichte dem Beamten die Hand. „Viel Glück, DI Ponder, in ihrem neuen, alten Leben! Wir haben Sir Gerald benachrichtigt, dass eine Droge im Spiel war. Sie sind noch zwei Wochen bei vollen Bezügen beurlaubt, dann erwartet sie der Yard wieder im Dienst!“
„Danke, Sir.“ Ponder ergriff die Hand mit seinen eigenen. „Immerhin weiß ich jetzt, dass ich mir kein Fehlverhalten zu Schulden kommen ließ. Und was machen wir mit dieser Giftmischerin, die sich Lady Abigail nennt?“
„Derzeit – noch nichts.“ Sherlock Holmes hob die Schultern. „Lestrade hat einige Leute, die das Haus nicht aus den Augen lassen. Und ich auch, DI Ponder. Für alle außer Lestrade und Sir Gerald sind sie weiter der Mann ohne Erinnerung. Bleiben sie es, bis ihnen Sir Gerald eine Entwarnung gibt“, mahnte Watson. „Bitte, sie dürfen an dem Fall nicht mehr arbeiten, das würde nur Verdacht erregen!“
„Dann fahre ich jetzt zum Yard. Polizisten schwelgen gerne in Erinnerungen, ich bin auf der Suche nach einer solchen – ein wenig Schmierenkomödie.“ Ponder lachte. „Noch einmal Danke, und leben sie wohl.“ Holmes griff zur Fiedel und entlockte ihr schauerliche Misstöne.
„Ob er es geglaubt hat?“ Dieses Mal stand Watson am Fenster und beobachtete die Abfahrt des Peelers. Holmes legte die Geige weg.
„Ich hoffe doch sehr! Zumindest lange genug.“
„Wenn ich gehört hätte, was er hörte…“
„Unzweifelhaft, werter Doktor und Freund. Unzweifelhaft! Warten wir ab, was Jimmy Japp zu berichten hat.“
=◇=
Etwa 50 Kilometer von der Mündung der Themse stromaufwärts begann der Hafen von London und zog sich 17 Flusskilometer beinahe bis zum Tower of London. Die Bezirke entlang der Themse wurden inoffiziell auch als die ‚Docklands‘ bezeichnet. Ein Teil davon war eine von einer weiten Flussschleife gebildete Halbinsel mit Namen Isle of Dog, wo das Millwall- und das West India-Dock lagen. Während am West India-Dock vor allem Waren und Passagiere von und zu den Antillen und anderen Karibischen Inseln ein- oder ausgeschifft wurden, waren die Millfort Docks spezialisiert auf Getreide. London benötigte Tonnen und Abertonnen an Weizen, Roggen und Reis, um die Mägen der Bewohner manchmal mehr schlecht als recht zu füllen. Das meiste Korn erreichte London per Schiff. Jeden Tag kamen die Vorarbeiter in die Pubs und wählten jene Glücklichen aus, welche einen Tag schwere Arbeit und kargen Lohn erhielten, sich davon aber zumindest wieder einen ganzen Teller Kartoffelbrei mit einer undefinierbaren Sauce kaufen konnten. Die Hauptbestandteile dieser Sauce schienen billiges Fett und jede Menge Minze zu sein. Natürlich durfte der Arbeiter von seinem Lohn auch noch einen Vertreter bezahlen, der dann dafür sorgte, dass er im Pub während der Auswahl in der ersten Reihe sitzen durfte. Die Dockarbeiter mit ihrer robusten Kleidung und den festen, genagelten Schuhen waren für jedermann leicht zu erkennen, und an der Anstecknadel auf ihrer Kappe konnte man sie sogar den einzelnen Bezirken zuordnen. Wenn man keine Nadel besaß, gehörte man einfach nicht dazu, auf irgend eine Art musste man sich zuerst einmal in die Gemeinschaft einbringen.
Der Mann in dem alten, bereits etwas fadenscheinigen Matrosenmantel, der spät am Abend gebückt über die nur spärlich beleuchtete Hafenstraße rund um die Halbinsel hinkte und sich einem der Pubs näherte, hatte wohl schon bessere Tage gesehen. Vor der Tür zögerte er kurz, dann öffnete er die Tür und hinkte hinein. Die Gespräche flauten kurz ab, Dutzende Augenpaare richteten sich auf den Neuankömmling, musterten in kurz und wandten sich wieder einander zu. Ein Seemann war keine Konkurrenz für sie, da lohnte es sich nun einmal nicht, einen Streit zu beginnen.
„Stout!“ Die Stimme des Matrosen klang heiser, nicht mehr ganz gesund, ein Los, welches er mit vielen Teerjacken teilte. Der Barmann schob ein Glas dunkles Bier über den Tresen. Der Seemann nickte dankbar, nahm einen tiefen Schluck und sah sich ein wenig um, niemand der Anwesenden beachtete ihn mehr. An einem Tisch an der Rückwand saß ein Hüne mit breiten Schultern und breitem Vollbart, er schaufelte einen Löffel baked Beans mit Toast in seinen breiten Mund und spülte mit Red Ale nach.
„Johnny“, dröhnte seine Stimme. „Verdamm mich, du hast mich etliche Pfund gekostet mit deinem blöden Raid. Und dafür wirst du mir bezahlen! Am Wochenende boxt du gegen Billy vom Stockton Pier, und bei Gott, in der vierten Runde wirst du dich auf die Bretter legen. Oder du wirst bald unter ihnen liegen. Vergiss deinen dummen Stolz, wenn wir die Pinkel schröpfen wollen! Bringt ihn weg!“ Dann widmete er sich wieder seinen Bohnen, ab und zu dem Mädchen neben sich auch einen Löffel abgebend. Ein Mann brachte einen Zettel.

„Den hat ein Junge abgegeben, Boss!“
„Scheiße“, schrie der Riese, sprang auf und sah sich im Schankraum um. Der Mann im Matrosenmantel tippte an seine Mütze und kratzte den grauen Bart.
„Hallo, Donnegall“, wisperte er leise.
„Holmes“, flüsterte der Rotbart. „Wie haben sie mich denn gefunden?“ Der Riese fiel wieder schwer auf die Bank zurück und winkte seine Leibwächter beiseite.
„Oh, das war nicht sehr schwer“, bemerkte Holmes und setzte sich zu den beiden. „Du und Molly, ihr seid ein auffälliges Paar, und ihr strebt immer an die Spitze. Selbst hier.“
„Und was jetzt, großer Detektiv?“, fragte Donnegall, er hatte sich rasch wieder gefasst. „Warten draußen schon die Greifer?“
„Nein, es weiß niemand außer mir Bescheid, großer Finn Fitzpatrick Donnegall. Meine Arbeit ist abgeschlossen, wenn der Fall gelöst ist. Ich verhafte niemand, das überlasse ich den Peelern. Nein, ich brauche dich, Donnegall. Beziehungsweise brauche ich – jemand, der zwei feuchte Arbeiten erledigt. Bald. Und jemand, der die Ägypter im Auge behält.“
„Das ist eine verdammte Falle“, kniff Finn misstrauisch die Augen zusammen. „Da steig ich nicht darauf ein!“
Holmes rieb sich das Gesicht. „Es geht um die Ehre eines Mitglieds der königlichen Familie, und unter Umständen auch um mehr. Nämlich um den Bestand des ganzen königlichen Hauses in England und um das Empire. Es gibt eine Verschwörung, welche mit rechtsstaatlichen Mitteln nicht mehr zu verhindern ist.“
„Nehmen wir nur des Gespräches willen an, ich wäre interessiert.“ Finn sah ostentativ in die Ferne. „Um wen würde es sich denn handeln?“ Holmes zog zwei in absolut neutraler Kanzleischrift geschriebene Zettel hervor, die Zeichen wirkten wie mit der Schablone gemalt und verrieten nichts über den Schreiber.
Der Ire kratzte sich den Bart. „Na schön. Ich überlege es mir.“
„Tu das, Finn.“ Holmes befestigte den Bart und setzte auch die Mütze wieder auf. „Unter dem Tisch findest du ein Päckchen, ich denke, das wird reichen. Plus zwanzig Prozent für dich.“
„Ich habe noch nicht ja gesagt“, protestierte Donnegall.
„Du weißt es, ich weiß es, Molly weiß es. Das reicht.“ Holmes machte Anstalten, sich zu erheben.
„Irgendwelche Wünsche dabei, Mister Holmes? Ein letzter Gruß?“ Molly bestätigte damit den Geschäftsabschluss, und Molly P. stand zu ihrem Wort.
„Keine unnötigen Schnörkel, Molly. Nur so bald wie möglich.“ Damit hinkte die Gestalt im Matrosenmantel wieder in die Dunkelheit und verschwand im Nebel. Molly grinste Finn Donnegall an. „Das würde uns kein Schwein glauben“, flüsterte sie. „Ausgerechnet Mister Sherlock Holmes betraut uns mit einer Geschäftsauflösung.“
=◇=
Morgendlicher Nebel war im April keine Seltenheit in den Straßen Londons, behinderte den Verkehr aber nicht sonderlich. Die Bewohner der Stadt waren es gewohnt, beinahe ebenso sehr ihre Ohren zur Orientierung zu benützen wie ihre Augen. Auch ihre gute Laune litt nicht sonderlich, und Sir Aidan pfiff sich ein kleines Lied. Bald würde er Lady Charlotte so weit haben, dass sie ihre Beine nicht nur ihm öffnete. Und danach, danach würde sie alles für ihn tun! Alles! Und dann – mit ihr als Gallionsfigur die Revolution, die Queen aus dem Wege räumen. Mit Hilfe der dem Goldenen Frühling treuen Arbeiter der Egypt and North Africa Docks konnte dort vorher ein Aufstand angezettelt werden, und Lady Abigail Chestertons treue Anhänger in gehobener Position wären auch zum Eingreifen bereit. König Aidan I klang doch gar nicht mal schlecht, oder sollte er doch einen der klassischen Kronnamen vorziehen? Georg? Edward? Henry? Vor ihm wichen zwei Gestalten aus seinem Weg. Aidan kicherte vor sich hin. Recht so, wenn der künftige König nahte, hatte das Fußvolk beiseite zu weichen. Die Bewegung sah er kaum, unter seinem Brustbein war ein kurzer Schmerz, die Klinge erreichte von unten das Herz Aidans und löschte sein Leben und seine überaus ambitionierten Träume aus. Für immer!
„Rasch jetzt!“ Der Stock wurde seiner toten Hand entwunden, statt dessen ein blutiger, offener Stockdegen hinein gedrückt. Seine Taschen wurden penibel geleert, während ein Komplize eine Spur aus frischem Rinderblut zog und ein blutiges Taschentusch an dessen Ende platzierte.
„Fertig? Dann weg! Schnell!“ Sekunden später hatte der Nebel jede Spur der Täter verschluckt. Erst gut eine Stunde später stolperte der Bobby PC John McCain über die Leiche, das Trillern seiner Pfeife trug trotz des Nebels mehrere Blöcke weit, und die Antwort ertönte auch sofort.
In ihrem Haus in der Old Park Lane drehte sich Abigail Chesterton noch einmal in ihrem Bett um. Gestern war es wieder einmal sehr spät geworden. Nun, es ging eben nicht anders, ihre Gefolgschaft musste bei Laune gehalten werden. Und das ging im London des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts nur noch mit wenigen Attraktionen. Sex gehörte unbedingt dazu. Immer und überall, aber jetzt noch viel mehr. Durch die allzu prüde Königin für die höhere Gesellschaft immer stärker in den Untergrund, in verschwiegene Clubs und das Ausland verdrängt, wurde die Erotik im Geheimen immer exzessiver ausgelebt. Hatte man sich früher einfach mit seiner Geliebten verlustiert, kamen nun Fesseln und Reitgerten zum Einsatz. Nur zu zweit im Bett zu liegen galt als Langweilig, je größer die Gruppe, umso besser. Nun, für Abigail und ihre Auftraggeber war diese Entwicklung durchaus nützlich gewesen, sie befriedigte alle Wünsche ihrer Kunden, egal welche es waren.
Samuel, ihr Butler, war bereits auf den Beinen und bereitete alles für das Frühstück ihrer Ladyship vor, inklusive der kleinen silbernen Vase mit der einzelnen Rose, dabei plauderte er ein wenig mit Miss Rosalinde, der Köchin. Im Schlafzimmer von Lady Abigail bauschte sich drei Mal der Vorhang, und jählings wurde die Schlafende von harten Männerfäusten gepackt und unsanft aus dem Schlummer gerissen, ein Mann hielt sie nieder, ein zweiter hinderte sie am Schreien, während ein dritter rasch ihre Habe durchsuchte.
„Da haben wir’s ja! Ma – thi – brahm.“ Die Hand vor ihrem Mund wurde entfernt, doch ehe sie schreien konnte, wurde ein feuchter Lappen auf ihr Gesicht gedrückt. Sie konnte den Atem nicht lange genug anhalten, die indische Droge füllte ihre Lunge komplett aus und brachte ihr selbst den Tod, den sie anderen zugedacht hatte.
=◇=
„Nun, das war’s dann!“ DI Lestrade hatte Holmes und Watson in der Baker Street aufgesucht. „Miss Leonore ist glücklich, ihren Bruder wieder zu haben, und dieser Sir Aidan Allistair of Saussage ist einem Raub, der zum Mord wurde, zum Opfer gefallen. In der selben Nacht stirbt auch diese Abigail Chesterton, beide praktisch vor unseren Augen. Sie wissen wohl nichts für den Yard relevantes darüber, oder?“
Holmes sog nachdenklich an seiner geschwungenen Meerschaumpfeife. „Ich fürchte, nein, Inspektor Lestrade. Nichts von dem, was ich über diese Personen oder ihre Ermordung weiß, müsste die Metropolitan Police erfahren.“ Er reichte Lestrade einen Packen Papier. „Nichtsdestoweniger bin ich bereit, ihnen die Berichte von Jimmy Japp bezüglich der Beobachtungen von Sir Aidan und dem Haus in der Old Park Lane zu überlassen.“ Rasch überflog der Polizist die Schriftstücke, seine Augenbraue wanderte in die Höhe.
„Das sind nicht nur exakte Beobachtungen und Beschreibungen, die Berichte sind besser als viele unserer eigenen, Holmes“, bewunderte er die Leistung. „Wer ist denn dieser Jimmy Japp?“
„Ein Junge aus diesem Viertel, Lestrade“, flog beinahe so etwas wie ein sparsames Lächeln über Holmes Gesicht. „Ich habe ihn ein wenig unter meine Fittiche genommen, er möchte unbedingt Detektiv werden. Ich denke allerdings, er wäre beim Yard besser aufgehoben, und wenn es einmal soweit ist, wäre er ein würdiger Nachfolger für sie!“
„Verdammt ja, Leute, die so beobachten können und solch winzige Details erkennen, brauchen wir. Wie alt ist der Junge?“ Immer noch fasziniert blätterte der Peeler durch die Berichte, las ab und zu eine Passage. „Diese Halskette, die er hier erwähnt, ist so genau beschrieben, dass man sie sicher wieder erkennen kann.“
„Er ist etwas über zehn Jahre alt, Lestrade“, beschied Holmes. „Die Beschreibung der Halskette stammt allerdings von einer jungen Dame namens Jane Marple, einer Verwandten von Jimmy, welche gerade zu Besuch in London weilt.“
„So? Sie sollten sich trotzdem einen neuen Helfer besorgen, Holmes. In fünf Jahren steckt er in einer Uniform, in acht wird er Detective Constable, darauf wette ich. Schicken sie ihn zu mir, und ich werde Sir Gerald noch heute seine Ergebnisse vorlegen!“
Im Kensington Palast sah Lady Charlotte blicklos aus dem Fenster auf den vom Nebel verhüllten Garten. Ab und zu schälte sich aus dem Grau der Schatten eines der mächtigen, alten Bäume, welche noch nach dem Plan von Sir Christopher Wren Ende des 17. Jahrhunderts gepflanzt worden waren, aus dem eintönigen Grau. Ein Anblick, welcher durchaus zu Lady Charlottes Stimmung passend war, sie hatte vor kurzem die Nachricht vom Tod Sir Aidans erhalten. Sie trauerte, und durfte es doch nicht zu offen zeigen. Ein Pochen, und das Dienstmädchen Ginger steckte den Kopf zur Tür herein.
„Ma’am, Sir William ist eingetroffen. Er hat mir das übliche Zeugnis und ein Billett für euer Ladyschaft gegeben. Er bittet, in einer halben Stunde empfangen zu werden.“
Charlotte, die Duchess of Moorbay wandte kaum den Kopf. „Sag ihm – es ist gut, Ginger. Ich werde seine Lordschaft empfangen!“
Pünktlich auf die Minute betrat der große, etwas grobschlächtig wirkende Sir William den Salon seiner Ehefrau.
„Sie kommen zu einer ungewöhnlichen Zeit, Sir“, sprach ihn Charlotte an. „Es ist weder Mittwoch noch vier Uhr dreißig. Was bedeutet, dass etwas unvorhergesehenes geschehen sein muss. Bitte, nehmen sie doch Platz, Sir.“
Der Duke nickte. „Ma’am, es ist mir bewusst, dass ich mit meiner Neigung kein guter Ehemann bin, kein guter Ehemann sein kann. Aber in meinem Londoner Club wird darüber gesprochen, dass Sir Aidan Allistair of Saussage ermordet wurde, und ich – ich bin vielleicht homosexuell , aber nicht völlig vertrottelt und ich habe durchaus Augen im Kopf. Es war euch von meiner Seite jede Minute mit Sir Aidan vergönnt, um so mehr, als ich sowohl eurer Diskretion als auch eurer Vorsicht eventueller Schwangerschaften gegenüber sicher war. Jetzt aber dachte ich, dass ihr in dieser Situation vielleicht jemanden brauchen könntet, einen Vertrauten, einen – Freund.“
„Das ist sehr…“ Die Beine Charlottes gaben nach, sie verlor den Halt. Gerade schaffte es Sie William noch, seine Frau aufzufangen und auf einen Diwan zu betten. Hemmungsloses Schluchzen brach aus ihrer Kehle und nässte die Brust seines Rockes, wohin er ihren Kopf gebettet hatte.
„Ja, Charlotte, weine nur, es befreit die Seele. Ich bin für dich da, meine Liebe.“ Ginger, welche wenig später den Tee brachte, erzählte den anderen Dienern davon, dass Sir William über das Verhältnis seiner Frau Bescheid gewusst und seine Frau zu trösten versucht hatte. Seitdem war der Schotte bei der Dienerschaft weitaus beliebter und geachteter als vorher, und seine Besuche im Kensington Palast wurden auch wieder häufiger. Besonders, als sich ihre Ladyschaft die Uniform eines Seekadetten mit engen Hosen und eine zugehörige Perücke zulegte. Und eine sehr naturalistische und fein gearbeitete Elfenbeinschnitzerei. Doppelseitig und mit Lederriemen daran…
=◇=
Durch die Brompton Road im Chelsea rollte eine Droschke durch den immer noch wallenden Nebel und hielt vor einem repräsentativen Haus.
„Hier sind wir, mein lieber Watson. Steigen sie nur aus.“ Holmes öffnete die Droschkentür und sprang hinaus.
„Wo immer hier auch sein mag“, beschwerte sich Doktor Watson.
„In der Brompton Road, lieber Doktor, und hier ist der Merlin Club.“ Mit diesen Worten schob Holmes seinen Freund die Treppe hinauf.
„Scharlatane und Betrüger Londons vereinigt euch“, grummelte Watson, und Holmes schüttelte leicht den Kopf.
„Die besten Illusionisten und Zauberkünstler Britanniens treffen sich hier, werter Doktor. Guten Abend, Frank!“ Sherlock Holmes übergab seinen Invernessmantel und den hohen Hut dem Butler, und auch Watson legte notgedrungen ab. „Sehen sie her, Doktor, sie sehen nur meine leeren Hand, und nun?“ Ein Kartenspiel fächerte mit den Bildseiten zu Watson vor dessen Gesicht auf, scheinbar zufällig gemischt. „Wählen sie eine Karte und merken sie sich diese, alter Freund. Nicht hingreifen, nicht hinzeigen, nur merken!“ Holmes schlug den Fächer wieder zusammen, klopfte nach jeder Seite darauf, bis ein akkurater Stapel entstand und hielt ihn mit der Schmalseite nach oben. Langsam schob sich eine Karte aus dem Stapel, Holmes sah noch nicht einmal hin. „Dies ist die Herz Dame, und diese haben sie vorhin gewählt. Es gibt wohl eine neue Flamme in ihrem Leben, die sie mir noch nicht vorgestellt haben.“
„Ich bin erstaunt, Holmes“, bemerkte Watson.
„Ach, nur ein wenig angewandte Psychologie und Fingerfertigkeit, Doktor. Nichts besonderes.“
„Oh, ich habe nichts anderes angenommen!“ Der Doktor sah mit ernster Mine starr geradeaus. „Mich wundert, dass sie sich damit abgeben!“
„Aber mein lieber Doktor! Es gibt kein besseres Training für die Beobachtungsgabe eines Detektivs, als einem guten Zauberkünstler bei der Arbeit zuzusehen. Aber bitte, durch diese Tür“, bedeutete Sherlock seinem Freund einzutreten und folgte ihm. „Guten Abend, Exzellenz!“ Doktor Watson benötigte eigentlich niemanden, der ihm sein Gegenüber vorstellte. Die hagere, asketische Gestalt mit den stechenden Adleraugen, der silberne Haarkranz, das prominente Gebiss und die schmale Nase ließen keinen Zweifel an dessen Identität aufkommen.
„Sir Cadwalader Prichard, Erzbischof von Canterburry, Primas der Church of England und Hochmeister des Ordens vom Stab Merlins“, machte Holmes die Herren trotzdem bekannt. „Doktor John Hamish Watson.“
„Und die Zauberkünstler?“ Watson hatte ein wenig die Fassung verloren.
„Eine Tarnung, mein lieber Doktor!“, schloss Holmes die Tür zu dem großen Raum. „Hochmeister, Doktor Watson hat im Verlauf der Untersuchung eines Falles Kenntnis vom Stab des Merlin bekommen, aber seine Bedeutung nur am Rande erfasst. Ich denke, es ist nötig, ihn ganz einzuweihen und ihm den Eid abzunehmen.“
„Nun gut, ich vertraue ihnen, Barde Sherlock. Bitte, nehmen sie Platz meine Herren. Einen Sherry vielleicht? Ich finde, es plaudert sich einfach gemütlicher mit einem Glas. Doktor, das nun Folgende ist nicht leicht zu glauben, besonders für einen praktischen Denker wie sie. Bitte hören sie trotzdem zu, stellen sie ihre Fragen bitte hinterher. Naturgemäß wird die Erklärung einige Blöcke umfassen müssen, also bitte ich sie um Geduld. Der erste Block ist schon schwer genug zu verdauen, aber es war schon seit Anbeginn der Menschheit so, dass immer wieder Menschen mit besonderen Fähigkeiten geboren wurden, mein lieber Doktor. Menschen, welche von Gott – ja, oder der Natur, Barde Sherlock – besondere Gaben verliehen bekamen, und diese Personen schufen manchmal die erstaunlichsten Artefakte. Die Bundelade des Volkes Israel, den Tempel in Jerusalem mit perfekten Proportionen, das verschollene Signum, unter dem Konstantin siegte. Excalibur, das Schwert Alis – die Liste ist sehr, sehr lange. Unter anderem stellte ein Mann, ein Berater des vielleicht größten englischen Königs Arthur Pendragon einen Stab her. Einen Stab, mit welchem er der Überlieferung nach sogar den Drachen beschwören konnte, wenn das Land in Gefahr war. Hier kommt auch eine gewisse Morghaine oder Morgana ins Spiel. Die Geschichte verwirrt sich an dieser Stelle etwas, denn die Handlungen dieser Person sind oft derart konfus und widersprüchlich, dass wir eigentlich von zwei Frauen ausgehen müssen, welche die Legende später zu einer Person verschmolzen hat. Beide sind Zauberinnen, doch eine ist Artus und Merlin wohlgesonnen, während die andere hinter dem Leben Merlins und vor allem hinter dessen Stab her ist. Manchen Quellen zufolge verführte sie den Berater des Königs sogar, und angeblich durchaus mit gewissem Erfolg. Aber sie hat Merlin wohl unterschätzt, denn sie konnte seine kurzfristige Schwäche nicht nützen. Also kommt es irgendwann zu einem Duellum Arcanum zwischen beiden Geistern, in dessen Verlauf Merlin von der Erde verbannt wird. Allerdings bleibt die Siegerin mit leeren Händen zurück, denn Merlin kann seinen Stab mit sich nehmen. Der Rest der Sage ist wohl bekannt, oder? Artus, Guinevere und Lancelot in einer glücklichen Menage à troi, oder besser gesagt, einer Menage à quatre mit Morghaine le Fey. Eigentlich darf Artus Morghaine, die er wirklich aus ganzem Herzen und auch tieferen Regionen liebt, nur als Bruder gerne haben, und Guinevere ihren Lancelot ebenfalls. Aber in einer geheimen Absprache funktioniert es doch, hinter verschlossenen Türen, im Geheimen. Bis Mordred die Sache auffliegen und dem ab diesem Zeitpunkt sehr unglücklichen König Artus keine Wahl mehr lässt. Die drei Personen, die er auf der Welt am meisten liebt, müssen aus Camelot fliehen, und als letzten Liebesbeweis kann er nur noch die Verfolgung so weit verzögern, dass sie sein Reich verlassen können. Dann noch am Ende die Schlacht von Cammlan, die noch lebenden Ritter der Tafelrunde finden ihr trauriges Ende, Artus tötet seinen Sohn Mordred und wird von diesem selbst auf den Tod verwundet. Der sterbende König wird dann von Morghaine nach Avalon gebracht, Excalibur der Herrin vom See zurück gegeben. Der Sage nach ist Artus nicht tot und soll wieder kommen, wenn die Not am größten ist. Das tragische Ende des ersten Kapitels der Geschichte. Sehr intensiv mit sagen- und märchenhaften Elementen verwebt, aber das alles ist ein Teil unseres nationalen Erbes! Sie sagen gar nichts dazu, Doktor?“
Watson nippte an seinem Sherry. „Ich bin nur erstaunt, wie wenig sie die Sache mit dem doppelten Ehebruch erschüttert, Erzbischof!“
Sir Cadwalader lachte laut auf. „Grandios, mein lieber Doktor! Aber wissen sie, ich bin Waliser. Wir in Wales sehen weder die Monogamie noch die totale eheliche Treue als so sehr in Stein gemeißelte absolute Wahrheit wie die Engländer, solange wir es nicht müssen.“
„Nun gut“, akzeptierte der Doktor. „Sie sprachen von einem ersten Teil, Sir. Was ist mit dem zweiten?“
„Erinnern sie sich an das Datum 1531, Doktor? Heinrich VIII löst sich vom Papsttum und macht die englische Krone zum Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Zwei Jahre zuvor hatten in Wales einige Mönche einen bemerkenswerten Fund gemacht. Bei Ausschachtungen während der Renovierung einer Klosteranlage bei Llanfyllin yp Bwlch y ddar stießen die Mönche auf eine Höhle, welche recht gemütlich eingerichtet war. Von irgendwoher hatte der Bewohner dieser Höhle auch Nahrung und sogar Bier und Wein bekommen, denn es gibt Tagebucheintragungen über einige Jahrzehnte hinweg. Leider nicht über Jahrhunderte, bis zu seiner Befreiung, aber unsterblich war Merlin nun einmal nicht. Er schreibt auch sehr ausführlich von seinem Kampf mit der fremden Hexe um seinen Stab, den er nur mit viel Mühe retten und mit sich nehmen konnte. Der Rest sind Anweisungen, wie ein Retter und Schützer Britanniens diesen Stab einsetzen kann, wenn er denn je gefunden wird. Bis hin zum Ruf an den großen Drachen, was auch immer der Drache sein soll. Wir haben keine wirkliche Vorstellung vom Drachen, vermuten aber ein Wetterphänomen dahinter. Nun, gut, weiter in der Erzählung. Jedenfalls war dieser Stab der wirkliche Grund, warum es zum Streit mit dem Papst kam, mein lieber Doktor, nicht eine simple Scheidung oder die Annullierung einer Ehe.“
„Das wirft alle meine Vorstellungen und vieles von dem, was ich in der Schule lernte, einfach einmal so auf den Schutthaufen. Vielleicht könnte ich jetzt etwas stärkeres als einen Sherry haben?“ Watson hatte sich zurück gelehnt und die Augen geschlossen.
„Aber gerne, alter Freund. Sie erlauben doch, Exzellenz?“ Auf einer Anrichte standen mehrere schön geschliffene Flaschen, Holmes ergriff eine davon. „Gin?“
„Gin ist hervorragend“, nickte Watson.
„Zum ersten Mal kam dann dieser Stab unter unserer Königin Elisabeth zum Einsatz, als sie 1588 die spanische Armada abwehrte“, fuhr Sir Cadwalader fort. „Der damalige Bischof von Canterburry konnte den Stab vor dem Zugriff der Queen Mary und des Papstes retten und übergab ihn danach an die jungfräuliche Königin, welche einen Orden dafür stiftete. Unseren. Mit der Magie Merlins sorgte der damalige Großmeister auch für das der englischen Flotte so günstige Wetter. Danach verliert sich allerdings die Spur wieder, unter den Stuarts und den Cromwells ist der Stab lange Zeit verschollen. Jetzt kommen wir in das Jahr 1708, in die Regentschaft von Queen Anne. Sie nutzt den Stab, um die Landung ihres Halbbruders James Francis Edward Stuart am Firth of Forth zu verhindern. Seit den ersten Hannoveranern existiert der Pakt zwischen dem Orden und den Königen wieder, in Zeiten der höchsten Not England gegen Feinde von außen zu verteidigen, und nur zu verteidigen. Und so wird es bleiben, Doktor Watson. Allerdings ist es dazu wichtig, dass sowohl der Stab als auch der Orden absolut geheim bleiben.“
„Und genau diese Geheimhaltung ist nun kompromittiert“, warf Holmes ein.
Der Erzbischof fuhr herum. „Wie bitte? Was wollen sie damit sagen, Barde Sherlock?“
„DI Joseph Ponder hat im Haus von Abigail Chesterton etwas aufgeschnappt, das genau darauf hinweist. Inklusive eines Planes, den Stab an sich zu bringen!“
„In diesem Fall müssen wir das Artefakt sofort in Sicherheit bringen“, rief der Ordensmeister. „Danke, Barde Holmes! Und Doktor, werden sie über das Gehörte Stillschweigen bewahren?“
„Darauf gebe ich ihnen mein Wort, Sir!“, versprach Watson und hob die Schwurhand. „Als Offizier und als Gentleman.“
Wenige Minuten später verließen Sherlock Holmes und Doktor Watson den Merlin Club mit einer Tasche für einen Queue und bestiegen eine Droschke.
„221 Baker Street!“ rief Holmes dem Kutscher laut zu, und sie fuhren los. „Haben sie auch ihren Revolver mit, mein lieber Watson?“ Wie beiläufig klang die Frage des Detektives während der Fahrt.
„Aber selbstverständlich, Holmes. Ich habe ihn praktisch immer dabei“, versetzte der Doktor.
„Das ist gut, Doktor!“ Holmes sah aus dem Fenster. „Ich vermute, sie werden ihn bald benötigen.“ Watson legte seinen Webley mit gespanntem Hahn auf den Schoß, und wirklich, die Droschke blieb bald darauf stehen und eine Hand mit einem Revolver wurde herein gestreckt. Watson schoss als erster, draußen röchelte jemand, Holmes und Watson ließen sich seitwärts aus der Droschke fallen und setzten ihre Waffen ein, ohne lange zu zögern und ohne Munition zu verschwenden. Vier Personen und der Kutscher gingen schwer verwundet zu Boden, aus gewisser Entfernung ertönte auch schon die Pfeife eines Bobbys, und einige Uniformierte stürmten näher.
„Und das alles für einen alten Billardstock“, resümierte Holmes, holte den Stock aus der Tasche und betrachtete ihn. „Es ist zwar ein echter Brunswick, aber dafür gleich fünf, nein, eigentlich sechs Männer auf uns anzusetzen?“
„Nun, Holmes, damit hat dieses Problem doch wohl endlich ein Ende“, vermutete Watson.
Sherlock lud gelassen seinen Revolver nach. „Im Gegenteil, Watson, für den Orden beginnen die Probleme jetzt erst. Irgend jemand ist noch hier in London, der hinter dem Stab her ist. Und derzeit haben wir keine Ahnung, wo wir nach ihm suchen müssen. Mehr als einige Finger konnten wir nicht abhacken, der Kopf ist aber immer noch aktiv. Und er ist unsichtbar!“
=◇=
Konstantinopel
Das alte Byzanz und spätere Konstantinopel war einst nur auf die Halbinsel zwischen dem Marmarameer im Süden und der als ‚goldenes Horn‘ bekannten langgestreckten Bucht im Norden und ein kleines Dorf namens Galata jenseits des Hornes beschränkt. Diese Stadt, die Hauptstadt des oströmischen Reiches, wurde durch dicke Mauern und später zusätzlich durch große Bronzekanonen geschützt. Dennoch eroberte 1453 Sultan Mehmed II allen Bemühungen der Architekten dieser ausgeklügelten Wehranlagen zum Trotz die Festung am Marmarameer. Dieser Mehmed machte Konstantinopel zur Hauptstadt seines osmanischen Reiches, eine Stellung, welche die Stadt auch 1887 immer noch innehatte. Allerdings hatte sich in den letzten 436 Jahren einiges geändert. Beiderseits des Bosporus war die Stadt bis zum schwarzen Meer im Norden gewachsen, und auch im Süden hatte sie sich sowohl auf europäischer als auch asiatischer Seite längs des Marmarameeres ausgebreitet. Das moderne Konstantinopel hatte einige Orte wie etwa Rumelifeneri an der nördlichen Einfahrt in die Meerenge des Bosporus einfach geschluckt. Der Name der ehemaligen Hafenstadt existierte nur noch als Bezirksbezeichnung und erinnerte an frühere Zeiten. Welche wie überall auf der Welt selbstverständlich viel besser und glorreicher als die Gegenwart waren. Im Jahre 1.267 nach der Hedschra oder dem Jahre 1856 des gregorianischen Kalenders verließ die Familie des Sultans mit ihrem Hof und ihren Schätzen und Reliquien den alten Topkapi-Palast und übersiedelte unter dem Sultan Abdülmecid I in den neu gebauten und mit den damals modernsten Dampfliften sowie zentralen Heizungs- und Warmwasseranlagen ausgestatteten Dolmabahaçe – Sarayi direkt am Bosporus. Nur wenige Jahre später, im Sommer 1859, begannen die Bauarbeiten an einer neuen Eisenbahn, welche über Edirne und Sofia ‚Altin Kapi‘ – ‚Die Goldene Pforte‘ – mit Europa verbinden sollte. Abdülmecid, von den Fortschritten Europas durchaus begeistert, reformierte nicht nur die Technik im osmanischen Reich, sondern auch die soziale Struktur in seinem Staat. Er schaffte die bis dahin benützte arabische Schrift ab und entschied, die einfache lateinische Schrift einzuführen. Der reformfreudige Sultan erklärte außerdem Religion zur Privatsache, mit der es jeder nach seinem Gutdünken halten durfte und verkündete das Ende der willkürlichen Rechtsprechung nach eigenwilligen Auslegungen der Scharia durch religiöse Richter. Dieses muslimische Regelwerk wurde zwar zur prinzipiellen Grundlage der neuen, geschriebenen und für jedermann gleich geltenden Gesetze, diese Vorgaben wurden aber stark säkularisiert. Die Sondersteuern für Christen, Juden und alle Anhänger einer anderen Religion wurden ebenso abgeschafft wie die Sonderrechte für Imame und Ulema. Leider erst, nachdem einige besonders dickköpfige Rechts- und Religionsgelehrte diesen durch das Schwert eines Scharfrichters verloren hatten. Danach herrschte für das Erste einmal Ruhe im Land, und Abdülmecid, der sich selbst weiterhin öffentlich zum Islam bekannte, setzte im ägyptischen, arabischen, eurasischen und inselgriechischen Teil je ein eigenes Parlament ein und rief die Bevölkerung aller osmanischen Gebiete zur Wahl auf. Auf der Arabischen Halbinsel funktionierte das mit der Wahl nicht besonders gut, die Scheichs behielten einfach ihre Macht und pfiffen auf die osmanischen Herren, wie sie es schon immer getan hatten. In Ägypten formierte sich ein halbwegs funktionierendes System mit großen Freiheiten, bis die Briten und Franzosen den Suez-Kanal bauten und Ägypten danach verarmte. Dann formierte sich der Urabi-Aufstand gegen die Fremdherrschaft, bis die Briten endgültig einmarschierten und auch damit Schluss machten. Danach hatten weder der Khedive noch das Parlament im Land am Nil etwas zu sagen. Auf den ostägäischen Inseln wie Lesbos, Chios, Samos und Ikaria – um nur die größeren zu nennen – sowie auf Kreta interessierten sich die Militärkommandanten wie die arabischen Scheichs nicht für Beschlüsse der hohen Pforte und regierten weiter wie die absoluten Herrscher. Durchaus mit dem Wissen und der Billigung einiger hoher Offiziere in der Umgebung des Paschas. Nur im Rest von Abdülmecids Reich entwickelten sich seine Reformen langsam in die von ihm gewünschte Richtung. 1860 erkrankte jedoch der Sultan schwer, er hustete Blut und seine Kräfte schwanden rapide dahin. Seine Ärzte diagnostizierten seine Krankheit als die gefürchtete Lungenschwindsucht, oder moderner ausgedrückt, Tuberkulose.
=◇=
Aus dem Tagebuch der Günül, der dritten Frau des Sultan Abdülmecid.
》Die Frauen des Sultans hatten sich um sein Bett versammelt und versuchten, seine Schmerzen zu lindern und ihm Trost zu spenden in seiner Qual. Die jüngste Frau des Sultans mit Namen Fehime aber ging hin und studierte die Bücher Ibn Sinas, um in den alten Lehren Hilfe und Trost zu finden. Nach drei Tagen kam Fehime wieder aus dem Kämmerchen, in das sie sich zurück gezogen hatte..
„Gehe in die Schatzkammer und bringe dem Sultan den Hirka-i Şerif“, befahl Fehime einem Diener. „Schnell, so laufe doch schon!“
„Was erhoffst du dir denn vom Mantel des Propheten“, wunderte sich Abdülmecids erste Frau.
Fehime fuhr sich durch das zerzauste Haar. „Wenn die Krankheit von Allah gewollt ist, um unseren Gemahl zu prüfen oder zu strafen, ist nichts zu erhoffen, Karaca. Wenn sein Zustand aber von Menschen gewollt und herbei geführt wurde, dann wird der heilige Mantel seinen Körper gesunden lassen.“
„Von Menschen gewollt? Du sprichst von Gift?“ Günül wich erschrocken zurück. „Wer sollte unserem Gemahl, dem Sultan, denn so etwas antun wollen?“
Özgül machte eine wegwerfende Handbewegung. „In Mekka und Arabien wetzen diese ewig gestrigen Ulema bereits ihre Messer und Zungen, sie reden wider die Reformen des Sultans. Wahrscheinlich wollen sie, dass wir wieder alles aufgeben, jeden Komfort, den uns die neue Zeit gebracht hat, weil sie mit ihren Privilegien einen Teil ihrer Macht verloren haben und sie diese wieder erringen wollen.“
Karaca überlegte nur kurz. „Wir haben nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen! Fehime, wasch dich und mach dich hübsch für unseren Gemahl. Du sollst seine Glieder wärmen und sein Auge erfreuen, und wir werden euch beide mit dem Mantel bedecken.“
Kurze Zeit später betrat die junge Frau das Gemach ihres Ehemannes. Der Sultan hatte sie vor drei Jahren geheiratet, da war sie achtzehn Jahre alt gewesen, mit zwanzig hatte sie ihm einen Sohn geboren. Die anderen fünfzehn Frauen des Sultans begleiteten sie und trugen den schwarzen Mantel, den der Sage nach bereits Mohammed, der Prophet getragen haben sollte. Fehime war von zarter Figur, der Sultan konnte ihre Taille beinahe völlig umfassen, und sie besaß ein schmales, hübsches Gesichtchen.
„Du warst lange nicht bei mir!“ Ein Hustenanfall überfiel den Sultan.
„Ich weiß, Gebieter!“ Sie setzte sich neben ihm auf das Bett und strich seine wirren Haare zurück. „Aber vielleicht wissen wir jetzt Heilung zu schaffen.“
Matt schüttelte Abdülmecid den Kopf. „Es gibt keine Heilung von der Tuberkulose, Fehime!“ Wieder verkrampfte heftiger Husten den Körper des Kranken und unterbrach seine Rede. Schwach hob er die Hand. „Du solltest nicht so nahe bei mir sitzen, Fehime, du Glück meiner Augen! Sonst ergeht es dir bald wie mit!“
„Ich glaube nicht, Gebieter.“ Sie warf ihr leichtes Gewand ab und kuschelte sich an den Leib Abdülmecids. „Wenn es Allahs Wille ist, so gehen wir gemeinsam über schmale Brücke ins Jenseits und stellen uns gemeinsam der Prüfung, sonst werden wir beide gesund, glücklich und lange leben.“ Die Frauen des Sultans bedeckten die beiden mit Mohammeds Mantel und zogen sich an die Wände des Gemaches zurück. Plötzlich entrang sich ein urweltlich anmutendes Gebrüll dem Sultan, seine Muskeln verkrampften sich spastisch, kaum konnte Fehime dafür sorgen, dass der Mantel sie beide weiter bedeckte. Ihre Mitfrauen kamen ihr zu Hilfe und hielten den um sich schlagenden Sultan fest.
„Ich verbrenne“, brüllte dieser. „So helft mir doch, ich verbrenne von innen!“ Fehime strich ihm über die Stirn, sprach beruhigen auf ihn ein. Dann, von einem Moment zum anderen, erzitterte sein ganzer Körper. „Mir ist kalt“, jammerte der Sultan. „So entsetzlich kalt.“ Fehime und Karaca umarmten ihn von beiden Seiten und versuchten ihm Wärme zu spenden, bis der Sultan übergangslos in einen tiefen, ruhigen Schlaf versank.
„So ruhig hat er schon lange nicht mehr geschlafen!“ Karaca erhob sich. „Bringt uns etwas zu trinken! Rasch!“ Dann bedeckte sie den schlafenden bis zum Hals wieder mit dem Mantel und zog Fehime an ihre umfangreiche Brust. „Er schläft ohne zu Husten, das erste Mal seit Wochen. Du hast dem Sultan vielleicht wirklich das Leben gerettet.“《
=◇=
Theodora Katoionais legte das Buch zu Seite, aus welchem sie Nikos Matrophanakis vorgelesen hatte. „Und, der Sultan hat überlebt, er regiert ja heute noch. Und das war erst vor 29 Jahren, nicht in legendären Zeiten!“
„Ja, und er regiert auch immer noch über uns Kreter, verdammt sollen diese Türken alle sein.“ Nikos ballte die Fäuste, und Theodora lächelte.
„Nun, wenn sie den echten Mantel besitzen, dann stimmt vielleicht auch die Legende, dass der Bogen Mohammeds vorhanden sind, welcher angeblich weiter schießen kann als der Himmel hoch ist, dessen Pfeile nie fehlgehen und immer wieder in den Köcher des Schützen zurückkehren. Dazu noch das Schwert, das David Goliath nach dessen Tod abgenommen hat und die Schuhe des Propheten, mit welchen er den Lauf der Kamele übertreffen konnte. Und selbst, wenn wir nur die Standarte des Propheten entwenden könnten! Die Standarte, welcher im Falle der Gefahr jeder Gläubige folgen muss!“ Theodora trommelte mit ihren Fingern auf den Einband des Buches. „Es werden noch weitere Kämpfer für unsere Freiheit in Stambul eintreffen, Nikos, und dann werden wir dem Dolmabahaçe – Palast einen Besuch abstatten. Zumindest der Schatzkammer.“
„Oh! Das mit dem Bogen und dem Schwert verstehe ich! Aber wird das gegen die Maxim-Gewehre und die Schnellfeuerkanonen der Türken reichen?“ Nikos verzog das Gesicht. „Ich bin zwar prinzipiell zu jedem Opfer bereit, aber Sinn, wirklichen Sinn sollte es schon machen. Wenn ich schon sterben soll, dann in einem glorreichen Kampf, der meinen Freunden zu einem Leben in Freiheit verschafft!“
„Es soll auch einen heiligen Schild geben, die Sultane und Kalifen der Osmanen und Araber haben alle Reliquien, die Mohammed und seinen Erben zugerechnet werden, hier in ihre Schatzkammer gebracht“, erklärte Theodora. „Wir müssen nur den Weg dorthin erforschen.“
„Und wie stellst du dir das vor?“, fragte Nikos. „Soll ich etwa – nein, vergiss es! Ich werde kein Eunuch! Niemals!“
„Das ist gar nicht so schlimm, wie es sich anhört, Niko“, neckte Theodora ihren Gefährten. „Die Ärzte der Pforte verstehen ihr Handwerk. Ein winziger Schnitt, wenige Tage später bist du wieder gesund!“
„Gesund vielleicht, aber kein Mann mehr“, schüttelte Nikos den Kopf.

„Ach, diese Zeiten sind doch lange vorbei“, behauptete Theodora mit wegwerfender Handbewegung. „Heute trennt man den Palastdienern doch nur noch die Samenleiter ab. Man wird zeugungsunfähig, bleibt aber potent. Bei jetzt schon 46 Frauen ist der Sultan mit seinen 66 Jahren vielleicht gar nicht so unglücklich über ein wenig Unterstützung. Aber was die Kinder angeht, muss er sich eben sicher sein.“
„Nein!“, beharrte Nikos kategorisch. „Keine Kastration! Nicht mit mir!“
Theodora wuschelte durch Nikos Haar. „Es wäre auch zu spät, Niko. Ahmad al Massud hat schon länger einen Diener eingeschleust, der uns die Pläne bringen soll!“
„Puh“, seufzte Nikos tief. „Ich hatte schon um meine Männlichkeit gefürchtet!“
„Na, um die wäre es ja wirklich schade“, lachte Theodora. „Aber nicht jetzt, Mikis kann jeden Moment kommen. Ach, das wird er schon sein.“
„Also, dieser Gang hier führt direkt in die Schatzkammer des Sultans. Wenn ihr es bisher geschafft habt, hält euch nichts mehr auf.“ Der große, muskulöse Mann hatte einen Plan der obersten Etage des Dolmabahaçe-Palastes auf dem Tisch ausgebreitet. „Es sieht vielleicht nicht so schwierig aus, aber ihr müsst durch den Garten, und dort sind jede Menge Wachposten und Streifen. Die Österreicher haben den Osmanen starke Fresnelscheinwerfer geliefert, damit sie bei Avilcar ihren Luftschiffhafen bauen durften. Einige von den Lampen schwenken dauernd über den Garten und sparen nur einen kleinen Bereich genau hier aus.“ Der Agent deutete grinsend auf eine bestimmte Stelle im Garten. „Die dreiundvierzigste Frau des Sultans hat dort einen kleinen Pavillon bauen lassen und möchte nicht durch dieses Licht gestört werden, wenn sie dort zu übernachten gedenkt.“
„Warum sollte sie…?“, blickte Nikos von einer zum anderen.
„Niko, Aysun möchte dem Sultan noch einen Sohn schenken. Um jeden Preis!“ Theodora breitete die Arme aus. „Um JEDEN Preis, wenn du verstehst!“
„Oh. OH!“
„Ja, oh!“, nickte Theodora.
„Sie hat das Holz des Pavillons aus der Heimat des Propheten besorgt und in Mekka weihen lassen, ihr Teppich stammt aus Dschiddha.“, deklamierte Mikis mit getragener Stimme. „So verbringt sie lange Stunden auf den Knien im Gebet, Allah erfüllt ihre Seele, der Sultan ihre Gedanken und dessen Ältester Sohn ihren Leib. So hat jeder etwas von ihr, und es bleibt sogar in der Familie. Für uns ist das ein Glück. Wir werden die Waffen benötigen, um Atrá bint Selinas Pläne zu durchkreuzen und danach die Freiheit Kretas zu erkämpfen. Die Mitera megala Saloumne wird uns dabei helfen, wenn erst die Gefahr durch den Goldenen Frühling gebannt ist.“
„Kaló, kaló, Miki! Wir werden bereit und unsere Kameraden bald hier sein, es werden viele kommen, niemand wird zurückstehen wollen, wenn es um die Freiheit der Heimat geht!“
„Warst du auch schon einmal in der Schatzkammer“ fragte Theodora, und Mikis lachte.
„Tagsüber ist es nicht wirklich schwierig. Es sind diverse Gegenstände darin verstaut, die immer wieder benötigt werden. Und sei es nur, weil der Sultan sich an ihrem Anblick ergötzen möchte, denn wozu hat man denn sonst einen Haufen Schätze? Besonders oft aber lässt er sich den Topf Abrahams kommen, füllt ihn mit Wasser und versucht, aus den Bildern Rat für seine Entscheidungen zu finden. Wie das mit seiner Begeisterung für Wissenschaft und Technik zusammen passt, ist mir ein Rätsel.“
„Und – sind die Waffen des muslimischen Propheten in der Kammer?“ Nikos Matroprophanakis beugte sich gespannt vor. „Und kann man damit wirklich etwas anfangen?“
„Da sind sie“, bestätigte der eingeschleuste Agent. „Und als ich Fehime einmal dort hinein begleitete, glühte der Spalt im Schwert des Ali ibn Abi Talib plötzlich auf.“
„Welcher Spalt denn in welchem Schwert?“ Nikos hob die Hände. „Ja, schon gut, ich bin fürchterlich ungebildet, was islamische Reliquien angeht. Ich bin ein guter Christ und habe keine Ahnung von dieser muslimischen schwarzen Magie.“
Theodora Katoionais lachte launisch. „Ali ibn Abi Talib war der Schwiegersohn Mohameds, des Propheten. Der Legende nach soll er das Schwert vom Erzengel Gabriel persönlich bei der Schlacht von Badr erhalten haben. Der Name Zulfikar bedeutet entweder zweiklingig, zweispitzig oder zweischneidig.“
„Wird wohl zweischneidig bedeuten“, brummte Nikos. „Wozu sollte man ein Schwert mit zwei Spitzen herstellen, und wo sollte eine zweite Klinge sein?“
„Tatsächlich stimmen alle Übersetzungen in etwa“, erklärte Mikis. „Das Schwert ist gerade und wird durch einen Spalt von der Spitze bis zum Heft geteilt. Beide Klingen sind zwar über die ganze Länge einige Male verbunden, und auch an der Spitze gibt es eine, wie soll ich sagen, eine vorgelagerte Extraspitze, also eigentlich könnte man durchaus auch von drei Spitzen sprechen. Wie auch immer, wenn Fehime an dem Schwert vorüber ging, sah man Funken von einer Klinge zur anderen springen, am Heft beginnend und im zick-zack zur Spitze wandernd. Und bei dem Kavs-i Saâdet, dem Bogen des Propheten begann die Sehne zu singen. Aber wenn ihr mich fragt, der Bogen und die Pfeile sind viel älter als Mohamed. Es ist, wenn ich mich nicht sehr irre, eher ein hunnischer Hornbogen. Oder ein skythischer, vielleicht auch mongolischer. Jedenfalls sicher kein arabischer, denn den würde ich erkennen.“
„Meinetwegen darf es ein japanischer oder indianischer Bogen sein, aber schießt der wirklich so weit und so genau?“ Nikos war misstrauisch.
„Das kann ich nicht sagen“, bedauerte Mikis. „Ich habe nie gesehen, wie diese Waffen benutzt wurden. Lipàmai!“
„Den échi simasia! Da kann man jetzt auch nichts daran ändern.“ Theodora rieb sich die Hände. „Es wird jedenfalls eine Freude sein, die Waffen in den Lefka Ori unserer Heimat zu erproben. Und dann werfen wir die Osmanen aus Chania hinaus und holen uns auch Herakleion wieder zurück!“ Ihre Augen leuchteten fanatisch auf.
„Nun gut, ich werde wieder in den Palast zurückkehren.“ Mikis erhob sich und wies auf seinen Schritt. „Öhümüle könnte heute Abend meiner Dienste bedürfen, und es wäre auffällig, wenn ich nicht im Palast in meinem Zimmer wäre.“
„Dann bist du also doch kein…“
„Doch, bin ich. Ich werde nie wieder Kinder zeugen können, aber sonst bin ich durchaus noch potent!“ Mikis grinste. „Und bei Öhühüle ist der Dienst zumindest keine Strafe!“
„Ich habe es dir gesagt, Niko. Die Zeit der schwabbeligen impotenten Eunuchen ist schon lange vorbei.“
=◇=
„Los, los, los!“ Nikos stieß zwei Schatten vorwärts, welche zwischen zwei Lichtstrahlen aus den grellen, starken Suchscheinwerfern durch den Garten hasteten und das nächste Stück sicherer Dunkelheit erreichten, ehe sie von den Lichtstrahlen erfasst wurden. „Die nächsten!“ Wieder liefen zwei schwarz gekleidete Männer los. Sie hatten es im Hinterhof des von ihnen gemieteten Hauses nachgestellt und geübt, mit der Stoppuhr in der Hand. Immer und immer wieder, der Zeitablauf war ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Die Mechanik der Suchscheinwerfer vergaß zwar keine Stelle in dem großzügigen Garten, war dafür aber leicht berechenbar. Und die Kreter hatten nachgerechnet, mehr als nur einmal. Mikis hatte die genauen Informationen geliefert, und heute musste es einfach gewagt werden. Zwei Haken wurden in die Luft geworfen, verfingen sich in den Säulen des Wandelganges und verschafften so den ersten beiden Einbrechern die Möglichkeit, die Wand zu erklettern. Raschest, denn das Licht des Scheinwerfers würde nur all zu bald wieder kommen. Sie schafften es eben noch, sich über die Brüstung zu schwingen, ehe der Lichtkegel wieder über die Fassade schwenkte. Sechs Männer waren es schließlich, welche den Scheinwerfern und den immer noch so genannten Haremswächtern im Garten zum Trotz im Gang zum Tor der großen Schatzkammer standen.
„Vorwärts, nicht trödeln“, raunte Nikos Matropophanakis. Schon huschten sie weiter, für den erfahrenen Schlosser Dimitris Kolparatakis war der Verschluss der letzten Tür auch kein großes Problem mehr. Sie zwängten sich eiligst durch einen schmalen Spalt und standen in einer großen Halle mit vielen hüfthohen Säulen und Podesten, die Wände mit herrlichen Mosaiken verziert, welche in arabischer Kaligraphie Koransprüche zeigten. Weiches Licht aus einer nicht erkennbaren Quelle erfüllte den ganzen Raum, durch den die Kreter jetzt langsam gingen, die einzelnen Stücke bestaunend.
„Das muss die Standarte des Propheten sein, die Sancak-i Şerif.“
„Und dieses seltsame Ding ist wohl das Schwert Zulfikar!“ Nikos nahm das Schwert hoch. „Hier beginnen wirklich Funken zu laufen. Das ist ein seltsames Gefühl in der Hand!“ Ein blendender Blitz schlug in die Wand, zertrümmerte das Mauerwerk und sprengte ein riesiges Loch in die Wand, durch welches nun der bleiche Mond schien.
„Los, dort hinaus!“ Rasch schnappte sich jeder noch ein Stück, dann sprangen sie durch das Loch in der Wand in den Bosporus. Geplant war es allerdings nicht so gewesen. Nicht ganz!
Die Männer an den starken Scheinwerfern auf dem Dach des Dolmabahaçe-Palastes hatten so schnell reagiert, wie man es von einer Eliteeinheit wie den Janitscharen auch erwarten konnte. Früher die in den Dienst an der Waffe gepresste Kinder christlicher Sklaven, war ein Posten bei den Janitscharen heute eine Ehre, welche nur mit Mühe errungen werden konnte. Hatte ein Soldat einen höheren Unteroffiziersrang erworben, durfte er sich einem Eignungstest unterziehen. Die meisten wurden hier bereits ausgesiebt, auf den Rest wartete für sechs Monate die Cehennem, die Hölle auf Erden. Auch hier schieden noch sieben bis acht Kandidaten von zehn aus, doch sie durften auf der Kopfbedeckung bereits ein kleines Abzeichen der Janitscharen, ein silbernes Kreuz umschlossen von einem goldenen Halbmond auf schwarzem Hintergrund auf der Kopfbedeckung tragen. Nach bestandener Abschlussprüfung bekamen die Männer das endgültige Abzeichen. Doppelt so groß, mit rotem Hintergrund, die größte Auszeichnung, welche die Armee des osmanischen Sultans zu vergeben hatte. Sie waren stark, reaktionsschnell, hervorragende Schützen und mit der besten Ausrüstung ausgestattet, welche für Geld zu kaufen war. So suchten die Scheinwerfermannschaften sofort nach dem Energieausbruch, den sie für eine Explosion hielten, die Geschützmannschaften besetzten sofort alle den Palast verteidigenden Kanonen und die Gewehrschützen besetzten die Brustwehren. Das Wasser schien aufzuleuchten, eine Kanone des Palastes wurde scheinbar von einem gleißenden Kugelblitz total deformiert und rot glühend aus der nicht überdachten Barbette geworfen. Die Infanteristen nahmen aus ihren Schnellfeuerkarabinern die leuchtende Stelle unter Beschuss, und auch vom Palasteigenen Hafen aus feuerten die dampfbetriebenen Revolverkanonen im Kaliber .45 dorthin. Das Wasser schien durch die Einschläge zu kochen, es musste doch ein Wirkungstreffer gelingen! Doch immer wieder brach ein Blitz aus dieser Stelle, eine Kanone nach der anderen wurde völlig zerstört, eine Gattling-Gun nach der anderen schwieg, ihre Stellungen brannten lichterloh. Aus dem goldenen Horn kam eine schnittige Dampfyacht mit voller Maschinenleistung, fünf Männer kletterten nacheinander an Bord und zogen einen sechsten an einem Seil hinter sich an Deck. Immer und immer wieder trafen die Blitze dieses sechsten die Stellungen der Janitscharen, welche in todesverachtendem Mut weiterkämpften, bis die Yacht in die Dardanellen einfuhr und außer Sicht kam.
„Geschafft“, jubelte Theodora laut und steuerte das schnittige Schiff gekonnt durch die Meerenge, dem Mittelmeer entgegen.
=◇=
Auf der Halbinsel nördlich von Çanakkale läutete tief unterhalb der Erde eine Glocke. Ein Üstçavuş, ein Hauptbootsmann der osmanischen Marine hielt den Schalltrichter an sein Ohr, dann zog er wild an einer Schnur. Durch die Gänge hallte das Läuten unzähliger Glocken, welche alle an einem Strang hingen und die Marinesoldaten auf ihre Stationen riefen. Dann eilte er zu seinem Yüzbaşi, seinem Kapitänsleutnant, auf dessen Alarmposten. Noch während des Laufes fühlte er, wie mächtige dampfhydraulische Kolben den geheimen Geschützstand an die Oberfläche hoben, rasch erstattete er seine Meldung. Scheinwerfer richteten sich auf das Marmarameer, und doch, es war kein Lichtstrahl zu sehen. Der Yüzbaşi trat an ein Fernglas, das in einem vertikalen Ring auf einer Drehscheibe montiert war.
„Entfernung 374 – Richtung 249 Grad. Uuuund FEUER!“ Die vier 40 Zentimeter Dampfkanonen der Stadtverteidigung zischten jede einmal wie überdimensionale Teekessel und schleuderten ihre Granaten über das Wasser! An der Stelle, wo sie auftrafen, verging ein Schiff in einer plötzlichen Stichflamme, dann schwammen nur noch einige brennende Bruchstücke im Wasser, und ein seltsames Glühen versank langsam im Meer.
=◇=
Kreta
Süden der Insel Kretas in der Provinz Sfakia war berühmt für seine steil ins Meer abfallendenden Küstenregionen, welche immer wieder von zerklüfteten tiefen Schluchten durchzogen wurden. Der berühmteste dieser Einschnitte war die Samaria – Schlucht, an deren südlichem Ausgang das kleine Fischerdorf Agia Roumeli lag, ein Ort, welcher ausschließlich über die 17 Kilometer lange und an einer Stelle nur vier Meter breiten Schlucht oder vom Meer aus zu erreichen war. Die Provinz war aber auch berühmt für ihre wilden, ungezügelten Bewohner, welche immer noch heftigen Widerstand gegen das Osmanische Reich leisteten. Das Gelände war wie geschaffen für die großgewachsenen Männer in ihren schwarzen Hosen, schwarzen Hemden, den charakteristischen Kopftüchern und den hochschäftigen Stiefeln, in denen stets eines der langen Messer mir dem Schwalbenschwanz-Griff steckte. Nicht sehr fest, wie schon mancher Türke erfahren hatte, die Ehre und die Blutrache waren integraler Bestandteil des sfakiotischen Alltags. Sie waren schnell gekränkt, diese Männer mit den wilden Schnauzbärten, stets ein wenig unrasiert an den Wangen und am Kinn. Trotz aller Bemühungen entzog sich dieses Gebiet der Kontrolle durch die Truppen des Sultans in Konstantinopel. Nicht, dass der Rest dieser Insel wirklich als befriedet gelten konnte, aber nirgendwo waren Überfälle auf die Soldaten der Osmanen derart häufig wie im Südwesten Kretas.
Östlich von Agia Roumeli stieg die Küste steil auf vier- bis fünfhundert Meter in die Höhe, immer wieder von kleinen, schmalen Sandstränden gesäumt und von Schluchten unterbrochen. Wasser hatte im kristallinen Kalkstein der Lefka Ori, der weißen Berge, tiefe Höhlen hinterlassen, und in einer von ihnen sollte Thalos, der Wächter Kretas, gewohnt haben. Thalos, der bronzene Riese, den entweder Zeus für den Schutz Europas auf die Insel gebracht oder Hephaistos dem Minos zum Geschenk gemacht hatte, es gab beide Versionen in den örtlichen Überlieferungen. Auf jeden Fall sollte er der Sage nach jeden Tag drei Mal die Insel umrundet haben und schwere Steine nach den Schiffen der Feinde der Kreter geworfen haben. Näherten sich die Feinde dennoch, so erhitzte er sich bis zur roten Glut und umarmte sie, eine mehr als unangenehme Vorstellung. Doch eines Tages schoss ein Bogenschütze den Stopfen, der sein Blut im Körper hielt, heraus, und das war dann das Ende von Kretas stärkstem Verteidiger.
Jetzt aber war in einer anderen Höhle, welche einen Eingang in einem Steilhang in großer Höhe weit im Landesinneren mit einer großen, vom Meer ausgewaschenen Höhle am Steilufer Sfakias verband, eine Gruppe Menschen am Werk, welche von sich behaupteten, ebenfalls Kreta befreien und danach auch verteidigen zu wollen. Ein neuer Hephaistos, der die Blitze dieses Mal für Elevtheria, der personifizierten Freiheit, schmieden sollte. Damit trafen diese Personen den Nerv der Sfakioten, denen die Besatzung ihrer Heimat durch die Osmanen stets ein Dorn im Fleisch gewesen war. Verächtlich hingen sie bereits an die Namen aller anderen Kreter, die sich mit den Machthabern halbwegs arrangiert hatten, ein ‚akis‘, eine Verniedlichung, eine Verkleinerung. Aus Agrotis, dem Bauern, wurde so ein Agrotakis, ein Bäuerchen, aus Inopios, dem Weinbauern, ein Inopiakis. Viele der wilden Bergbewohner wussten von der Schmiede, auch wenn sie noch die Wenigsten von ihnen gesehen hatte. Aber sie existierte tatsächlich. Auf dem riesigen unterirdischen Meeresarm schwammen drei ausgemusterte Panzerschiffe der britischen Royal-Oak-Klasse, mit Stahl gepanzerte Liniendampfschiffe, mit vier schweren 34,3 Zentimeter-Geschütze in zwei Barbetten am Bug und am Heck, auf jeder Seite 5 Außendeck – Geschützinseln mit je einer Schnellfeuerkanone im Kaliber 15,2 Zentimeter. Zwischen diesen Deckinseln wie auch davor und dahinter wurden soeben verkürzte, offenbar handgeschmiedete Hubrohre mit vereinfachten Ressel-Schrauben angeschweißt, die von starken Werner-Dampfturbinen-Motoren angetrieben wurden. Ein viertes Panzerschiff war aus dem Wasser gehoben und erhielt eben zwei Vortriebsröhren unter dem Rumpf angepasst. Die 125 Meter langen und 23 breiten Schiffe aus bestem Sheffieldstahl würden dennoch nie zu den schnellsten Flugschiffen gehören, auch wenn die dicke Panzerung über den Barbetten entfernt und das Freibord bei maritimer Fahrt damit auf 8 Meter erhöht worden war.
Daneben lagen noch einige Kasemattenschiffe vor Anker, jene sechzig bis achtzig Meter langen Schiffe, deren Kanonen auf einem durchgehenden Deck unter einem gepanzerten Hauptdeck standen. Hier hatte man bei einigen ebenfalls bereits das schwere Panzerdeck abgenommen und war bei einem eben dabei, den Corpus eines Starrluftschiffes darüber zu montieren. Genauer gesagt, drei ineinander liegende Rümpfe, jeder mit eigenem Gerüst, die Gaszellen waren durch die kreuzweise verleimten Leinenstreifen, in welche auch Seidenfäden verwebt waren, einigermaßen gut geschützt. Das Leinen wurde durch diese Methode der Verarbeitung steif genug, um eine gute, feste Hülle abzugeben und blieben trotzdem halbwegs flexibel, um von kleineren Geschossen nicht sofort durchschlagen zu werden. Auch das Holzgerippe der Hülle wurde dergestalt mit Metallfedern an den Verbindungsstellen verarbeitet, dass es bis zu einem gewissen Grad nachgab und dann wieder zurück in die alte Form sprang. Wenn der Feind nicht mit wirklich schweren Geschützen aus nächster Nähe das Feuer eröffnete, war die Konstruktion schon recht widerstandsfähig. Der Schichtaufbau hatte sich immerhin bereits bei den Soldaten der Achäern bewährt, als Bronze so teuer war, dass nur Fürsten Metallrüstungen besitzen konnten. Es konnte kein Zweifel bestehen, hier wurde an einer zwar nicht allzu modernen, aber durchaus brauchbaren fliegenden Flotte gebaut.
Ein Mann in einer Dschellaba, wie sie üblicherweise von den Völkern der Sahara getragen wurde, beobachtete die Arbeiten.
„Es geht gut voran, Wakil der Wahib Alaya. Ich denke, wir werden den Termin einhalten können!“ Der Sprecher trug einen dunkelblauen Arbeitsanzug, wie er überall auf der Welt zu finden war. Der Araber nickte.
„Das ist gut, Krakowsky Bey. Wenn erst die Mächte Europas vom Goldenen Frühling aufgehetzt alles in Schutt und Asche gelegt haben, werden wir unsererseits die Ursupatoren zu vertreiben wissen. Und dann – dann werden die unterdrückten Völker der Welt wieder frei sein! Es wird wieder ein freies Polen geben. Und natürlich auch eine freie Slowakei, Páne Hašek.“
Der Mann, der eben dazu getreten war, rieb sich die Hände an einem Tuch ab und nickte. „Die Österreicher haben schon zu lange den Stiefel in unserem Genick. Es wird Zeit, dass sie alle miteinander nach Hause gehen!“
„Wie wahr, meine Herren, wie wahr! Ich darf also der Herrin Saloumne berichten, dass unsere Arbeiten nach Plan vorangehen?“
=◇=
Mikis Parás packte sein Gewehr fester. Das Flechettegewehr aus der Schweiz, dass ihm der Berber überlassen hatte, würde den höchsten Offizier der türkischen Truppe, welche wieder einmal in die Lefka Ori gekommen war, als ersten töten. Der Teufel mochte wissen, warum sie es wieder und wieder versuchten, und warum sie nie aus ihren Fehlern lernten. Wenn der Offizier tot war und während alle noch ratlos auf einen Befehl warteten, wollten seine Brüder Yannis und Josif mit ihren erbeuteten türkischen Militärgewehren ebenfalls das Feuer eröffnen. Ein Kapetanios, zwei Ypolochagoi und sechzig Stratiotes! Mikis lachte leise. Diese Flachländer hatten doch überhaupt keine Ahnung, wie man sich im Gebirge bewegte. Diese Soldaten mussten sich auf jeden Schritt auf diesem Weg derart konzentrieren, dass für die Umgebung kaum Aufmerksamkeit übrig blieb. Zu wenig jedenfalls, um den Hinterhalt zu bemerken. Der Kapetanios war der einzige, der auf einem trittsicheren Muli saß, in der Mitte seiner Truppe. Die Sfakioten kannten sich aus, sie wussten, wie man diese osmanischen Dummköpfe bekämpfte. Einmal hatten die Türken einige Kurden in das Gebiet geschickt, um die Kreter zu bekämpfen. Doch die einzigen Toten, die es gegeben hatte, waren die türkischen Offiziere. Die in den Dienst gepressten Kurden waren in den Bergen verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Die Sprachbarriere zwischen ihnen und den Kretern, welche die Truppe nie aus den Augen gelassen hatten, war bald überwunden und der gemeinsame Feind stärkte das Bündnis. Natürlich hatten auch die Sfakioten Leute mit türkischen Sprachkenntnissen in ihren Reihen, und die Kreter wussten wieder etwas mehr über die Osmanen. Jetzt kam der Offizier um die Kurve, Mikis legte an und zielte auf die Brust des Hauptmannes. Ein kaum hörbares Zischen ertönte und die staubgraue Uniformjacke des Offiziers verfärbte sich an drei Stellen blutrot, langsam rutschte er aus dem Sattel des Maultieres. Von zwei anderen Stellen der Berghänge knallten Schüsse, das Echo hallte donnernd durch die enge Schlucht, die beiden Leutnants brachen tot zusammen. Die Soldaten versuchten sich hinter den Felsen auf dem Grund der Schlucht in Sicherheit zu bringen, aber es gab zu wenige davon, das Gegenfeuer kam spät, viel zu spät, schon lagen zwölf der Soldaten verwundet auf dem Boden der Schlucht. Die Projektile aus den osmanischen Karabinern schlugen in die Felswände, pfiffen als Querschläger herum, verletzten aber niemand mehr, die drei Brüder waren schon lange wieder verschwunden. Endlich legte sich wieder Stille über den Ort des Überfalls, die Onbaşi sammelten die Soldaten und organisierten den Abtransport der Verwundeten.

=◇=
Der Militärkommandant von Kreta, Mir Alay Kümnül Aktümir, tobte wütend in seinem Bureau. Schon wieder war ein Kapten, ein Hauptmann, und zwei seiner Tegmen, seiner Leutnants in einem Hinterhalt getötet und viele Askari verwundet worden. Diese verdammten Sfakioten hielten einfach nicht ruhig. Die Insel war erobert und gehörte dem Sultan in Konstantinopel, das sollten diese Bergbewohner endlich einsehen und ihre Steuern zahlen. Statt dessen beschossen sie weiterhin alles, was eine türkische Uniform trug, raubten Geld, Waffen und Munition. So konnte es einfach nicht weitergehen! Der Kurs des Herrschers war zu sanft, zu weich. Diese Verbrecher verstanden ja doch nur eine Sprache, und in dieser würde er jetzt zu diesem Gesindel sprechen.
„BINBAŞI“ brüllte er laut, und sein Vertreter, Major Ekzümir Früschgümün, stürzte in das Bureau des Obersten.
„Zu Befehl, Mir Alay!“
„Binbaşi, treiben sie fünfzig Kreter zusammen, die Hälfte davon ihre frechen Weiber! Zwanzig für den Hauptmann, je zehn für die Leutnants und zehn für die Soldaten. Jeder und Jede soll hundert Peitschenhiebe bekommen und dann mit einer Schnur erdrosselt werden! Öffentlich, sorge dafür, dass die Bewohner von Kandia es nicht nur erfahren, sondern dass möglichst viele es auch zu sehen bekommen! Es muss ein Exempel statuiert werden. Diese Sfakioten sollen sehen, dass sie nur ihren eigenen Landsleuten schaden!“
„Aber, Mir Alay, die Sfakioten verachten die Nordkreter. Davon werden…“
„Du hast deine Befehle, Binbaşi“, tobte der Mir Alay. „Gib es weit und breit bekannt, in einer Woche wird das Urteil vollstreckt. Keine weiteren Widerworte!“
Die Nachricht machte schnell die Runde, schneller noch, als es der Oberst gedacht hatte. Besonders die wohlhabenderen Kreter wurden ‚eingeladen‘, der ‚Hinrichtung der Hochverräter‘ beizuwohnen, um zu sehen, wie ‚die wohltätige und weise Herrschaft des Sultan Gerechtigkeit übte‘. Auch in Retimo, welches bei den Kretern Rethymnon genannt wurde.
„Sie wollen Frauen auspeitschen und erdrosseln? Frauen, die noch nicht einmal für die Handlungen ihrer Ehemänner verantwortlich gemacht werden dürften?“ Alexios Kapetanakis war fassungslos. Der Händler hatte sich mit der osmanischen Herrschaft halbwegs abgefunden gehabt, aber jetzt? „Ob Abdülmecid davon weiß?“
„Egal, ob er informiert ist!“ Dimitri Vaskakis schritt aufgebracht im Raum umher. „Der Militärkommandant im Megalo Kastro, wie sie Herakleion jetzt nennen, regiert über uns wie ein absoluter Herrscher! Und dem Sultan in Konstantinopel ist es völlig egal. Als sich Jorgos Arkopokis, der gewählte Sprecher der kretischen Bevölkerung, beschweren wollte und zumindest die Frauen freihandeln wollte, hat man ihn und seine Familie gleich mit zu den Verurteilten gesteckt!“
„Seiner ganzen Familie?“ Die Knie gaben Alexios nach, er sank auf seinen Stuhl. „Seine Tochter ist doch noch keine sechzehn und seine Söhne überhaupt erst zehn und sechs!“
„Zusätzlich zu den Fünfzig.“ Dimitris ballte wieder die Fäuste. „Dieses Unrecht schreit zum Himmel! Wir müssen etwas unternehmen!“
Alexios nickte. „Ich bin Witwer, und ich bin alt. Meine Peristrofoi mögen noch alte Modelle mit Pulverhorn und Kugelbeutel sein, aber auf fünfzig Meter treffe ich mein Ziel. Elf osmanische Skyloi werden sterben, die zwölfte Kugel wird mich zu meiner geliebten Nephele bringen.“
„Meine Familie habe ich nach Griechenland in Sicherheit gebracht, Eleni besucht ihre Schwester in Athen. Jetzt sind es schon zweiundzwanzig Malakes, welche diesen Tag nicht überstehen werden!“
„Es werden hoffentlich mehr sein!“ Alexios schlug mit der Hand auf den Tisch. „Wir werden ja wohl nicht die einzigen Männer sein, die noch übrig sind!“
Rund um die alte venezianische Festung Candia, welche die Osmanen Megalo Kastro und die Kreter Herakleion nannten, hatten sich die vormals in der Festung lebenden Kreter ansiedeln müssen, welche sich das Wohnrecht von den Venezianern mit Blut und Eisen erkauft hatten. Abermals waren sie rechtlos im eigenen Land, wieder hatten sie einen fremden Herrscher mit einer ihrer Anschauung nach falschen Religion. Wobei es den Kretern egal war, ob sich jemand drei-, vier-, fünfmal oder noch öfter nach Osten, Westen oder Mekka verneigte, solange sie in ihren Kirchen und Häusern tun und lassen konnten, was sie wollten. Panagiotis Ploicharakis war einer von ihnen. Er entstammte einer Familie von Segelmeistern, welche schon seit langer Zeit Segelschiffe durch die tückischen Wetter der Ägäis gebracht hatten. Heute nannte er nur noch einen kleinen Laden sein eigen, wo er im Hinterland selbst geerntete Oliven und das Öl daraus verkaufte. Und natürlich Wein, jenen rostfarbenen, dunklen Rosé, der nur auf den Hängen des Ida gedieh. Er polterte die Stufen in den Keller hinunter, auf der Suche nach seiner Frau.
„Irini! Bist du… Was machst du da?“ Fassungslos sah er zu, wie seine Frau gehacktes Blei in ein Säckchen stopfte.
„Ich werde nicht zusehen, wie unschuldige Frauen sterben, Panagiotis. Lieber teile ich dieses Schicksal und nehme noch einige der Tourkoi mit in den Tod! Jetzt, wo wir Frauen vor der Willkür des Oberst doch nicht mehr sicher sind, möchte ich selbst über mein Ende bestimmen!“
Panagiotis umarmte seine Frau. „Du hast recht! Wir haben schon viel zu lange still gehalten. Aber so wird das nichts, Irini. Schau her, das Pulver zuerst hier hinein, eine Zündkapsel, und das Blei ordentlich nach der Seite verteilen. Jetzt noch eine Schlaufe, ein paar werden wir noch werfen können, ehe sie uns erwischen. Ich habe noch zwei alte Pistolen, für einen letzten Ausweg, ehe sie uns gefangen nehmen!“
Auch in die Berge Sfakias drang die Nachricht von der geplanten Folter und Hinrichtung.
„FRAUEN?“ Manolis Oplitis brüllte wie ein wilder Stier. „Bei allen Teufeln, was fällt diesem Oberst denn da ein? Man führt doch keinen Krieg gegen Frauen! Das ist unehrenhaft! Das ist ein Verbrechen! Das können wir einfach nicht zulassen. Holt eure Gewehre, lieber ehrenhaft sterben als keinen Finger gegen dieses Verbrechen zu rühren.“
=◇=
Am angegebenen Tag versammelte sich eine große Menge auf dem Richtplatz, auf welchem die Osmanen zehn Pfähle mit jeweils einer Hand- und einer Fußfessel aufgerichtet hatten, ihre Opfer sollten offensichtlich die Tortur in den Fesseln mit gespreizten Armen und Beinen hängend ertragen müssen. Das Gemurmel der Anwesenden wurde lauter, drohender, als die Geiseln auf den Platz gezerrt wurden. Dann erschien auf einer Zinne Oberst Aktümir, der Militärkommandant der Insel und winkte herrisch, und die ersten fünf Opfer wurden von ihren Henkern zu den vorbereiteten Pfählen geführt. Drei Frauen und zwei Männer, unbekleidet wie alle anderen, die Hände hinter dem Rücken gefesselt, mit komplett kahl geschorenem Haar. Auch wenn diese Fünf mit stolz erhobenem Haupt ihrem Schicksal entgegengingen, der Zustand der Gefangenen war als zusätzliche Demütigung gedacht und wurde nicht nur von den Zusehern auch so aufgenommen. Wieder hob der Oberst die Hand zu einem Befehl, doch dann griff er sich an die Brust, der dumpfe Knall eines Schusses ertönte, und überall in der Menge fuhren Hände unter die Mäntel und Jacken, kamen mit Revolvern und alten, einschüssigen Pistolen wieder zum Vorschein. Die Wachsoldaten, welche zuerst gar nicht wirklich realisierten, was hier geschah, wurden völlig überraschend unter Feuer genommen. Bomben explodierten zwischen ihnen, sie flüchteten auf das Tor der Festung zu, welche einundzwanzig Jahre der Belagerung durch die Truppen des Sultans stand gehalten hatte.
Berenike Kamatakis, eine junge Frau, die zu den ersten fünf Opfern gehören hätte sollen, entwand sich geistesgegenwärtig dem Griff ihres Henkers, trat ihm mit dem Knie machtvoll zwischen die Beine und einige Male kräftig in den Bauch, dann warf sie sich über ihn und verbiss sich in seiner Kehle. Die Menge kannte nun kein Halten mehr, sie eignete sich die Waffen der gefallenen Soldaten an und feuerte auf jeden Türken, der sich zeigte. Einige liefen los und schnitten die Fesseln der Geiseln durch, worauf Berenike das Werk, das sie mit den Zähnen begonnen hatte, mit den Händen beendete und ihren Henker endgültig erwürgte. Danach riss sie den Revolvergürtel des Mannes, an den dieser in seiner Panik und im Todeskampf gar nicht mehr gedacht hatte, an sich und stürmte, nackt wie sie war, den anderen nach! Die Soldaten schossen von den Mauern in die Menge, doch irgendwo lagen einige Scharfschütze in ihren Verstecken, deren Gewehre immer wieder Opfer von den Osmanen forderte. Jedem Kreter, der starb, folgte sogleich ein anderer, ergriff dessen Waffe und stürmte weiter, in den Hof der Festung, die Menge ergoss sich die Wälle hinauf. Dann kehrte Ruhe ein, weiter kamen die aufgebrachten Kreter vorderhand nicht mehr, die Türen zu den weiteren Teilen der Festung waren verriegelt, auf den Zinnen standen noch mehr Soldaten, schussbereit wartend.
„Erchetai ena Kanoni“, hallte ein Schrei über den Hof, und einige Kreter rollten aus dem Zeughaus im Hof ein kleines Feldgeschütz im Kaliber 6,23 Zentimeter. Ein paar Männer schleppten Munitionskisten herbei und luden die Kanone!
„Noch eine!“ Eine zweite Kanone wurde herbeigerollt, und wurde wie die erste rasch geladen. Es machte den Kretern wenig aus, von den Soldaten mit ihren Gewehren unter Feuer genommen zu werden, und auch wenn einige dabei starben, es kamen immer wieder neue nach. Viele Kreter folgten Berenike Kamatakis, stürmten hinter ihr her auf die Bastionen und kämpften die Wachsoldaten nieder. Männer, die von dem Anblick der nackten Frau, welche nur mit dem Munitionsgürtel über der Schulter bekleidet wie eine Erynne kämpfte, völlig gelähmt waren. Dann drehten sie die Kanonen gegen das Zentrum der Festung, wo sich die Osmanen verschanzt hatten. Die Geschütze donnerten und schleuderten ihre Granaten gegen die Mauern der Kaserne, wo sie detonierten und große Löcher in die Mauern rissen. Die Gegenwehr der Türken erlahmte immer mehr, und der Binbaşi hisste die Parlamentärflagge. Er versuchte den ganzen Aufstand auf dem Verhandlungsweg zu beenden. Umsonst, die Kreter verlangten die bedingungslose Kapitulation der Garnison in Megalo Kastro, was der Binbaşi aber ablehnte. Die Besatzung der große Festung wurde nach zähen, harten Kämpfen letztlich völlig aufgerieben, die Kreter nahmen fürchterliche Rache für die Jahre der Unterdrückung. Berenike Kamatakis aber wurde die erste Frau Oberst in der Geschichte Kretas, und später auch die erste Ministerpräsidentin des kretischen Sultanats, aber ihre Haare hatte seit den Tagen des Aufstandes niemand mehr berühren dürfen.
=◇=
Rom
Der Mann in der Uniform eines Tenente Colonnello der italienischen Armee stürzte in den Thronsaal und unterbrach König Umberto und seinen Premier Crispi bei ihrem Gespräch über neue Steuern.
„Majestät! Verzeihen Majestät, aber – unsere Flotte in Eritrea! Versenkt, so gut wie völlig versenkt! Nur die FRANCESCO K ist der Vernichtung entkommen und hat uns einen Bericht aus Bur Sudan gekabelt.“
„Haben die Kakanier etwa das Feuer auf unsere Schiffe eröffnet? Das wäre eine unerhörte Beleidigung, mehr noch, eine Kriegserklärung!“ Umberto sprang von seinem Drehsessel auf.
„Nein, Majestät!“, meldete der Oberstleutnant mit überschnappender Stimme. „An Josephshafen sind unsere Schiffe unbehelligt vorbei gefahren. Kein Schiff hat den Hafen verlassen, und die Luftschiffe haben nur beobachtet und die Drei-Meilen-Zone nie verlassen. Auch britische Schiffe waren nicht in der Nähe, als es geschah.“
„Welche Geschütze haben unsere Flotte denn dann versenkt? Abessinien hat die Grenze zu unseren Kolonien bewaffnet, wie wir feststellen mussten. Aber Kanonen, die von der Grenze bis zum Meer feuern können? Mehr als 60 Kilometer?“ Francesco Crispi schüttelte den Kopf. „Gibt es derart weitreichende Geschütze denn überhaupt?“
„Die Franzosen und die Deutschen experimentieren mit weitreichenden Langgeschützen, Herr Premierminister“, berichtete der Offizier .“ Aber beide sind noch lange nicht an der 50 Kilometermarke. Und sie brauchen außerdem auch noch Schienen zum Transport der Waffen.“
„Dann rufen sie den Generalstab zusammen, Colonnello“, befahl der König.
Der Offizier nahm Haltung an. „Die Herren Generale wurden bereits benachrichtigt, Majestät! Sie müssten demnächst eintreffen!“
=◇=
„Nun, meine Herren, was haben sie mir mitzuteilen?“ Die kleinen, stechenden Augen von Re d’Italia Umberto I durchbohrten seine Generäle wie Lanzen aus purem Licht.
„Wir wissen nichts genaues, Majestät!“ Als erstes hatte der altgediente General Alessandro Miottini, welcher bereits Vittorio Emanuele I treu gedient hatte und der das Vertrauen des Königs besaß, das Wort ergriffen. „Der Bericht, den die FRANCESCO K aus Suez übermittelt hat, spricht von Trommelklängen, zu denen sich sowohl der Sand an Land als auch das zu gigantischen Wellen formte, welche die Landkreuzer durcheinander warfen und die Flotte unter sich begruben. Die FRANCESCO K hatte ausschließlich Infanteristen an Bord und hatte befehlsgemäß etwas abseits geankert, um auf die Ausschiffung ihrer Truppen zu warten. Das rettete unser Schiff und die Menschen an Bord!“
Der Colonello der Guarda Segreto, Luigi Granetti, legte einige Depeschen auf den Tisch. „Wir haben einige telegraphische Nachrichten aus Josephshafen empfangen und decodieren können, Majestät. Da gibt es einen Capitano McIvor des englischen Pioniercorps, welcher eben dabei war, in der Gegend Landvermessungen durchzuführen. Er hat alles gesehen, und er spricht von einer rund drei Meter durchmessenden Trommel, welche…“
„Haben sie etwa getrunken“, platzte Unberto ungläubig heraus. „Wie soll denn eine Trommel Schiffe versenken?“
„Das – wissen wir nicht, Majestät. Es ist uns unbegreiflich! Wir haben sofort im kleinen Maßstab Experimente durchgeführt, aber um diese Wirkung zu erreichen, müsste die Trommel sehr viel größer als diese drei Meter sein. Wie viel größer können wir leider nicht sagen, aber zehn Mal größer wäre nach Einschätzung meiner Leute das Minimum. Und das würde die Rettung der FRANCESCO K noch nicht erklären.“
„Also wissen wir überhaupt nichts“, resümierte der König. „Geht wenigstens die Invasion am Shabelle voran?“
„Derzeit keinen Meter, Majestät“, wischte sich Generale Francesco Pesceri den Schweiß von der Stirn. „Wir haben ein Problem mit dem Nachschub an Munition. Die Abessinier haben gute englische Ornithopter und eine eigene Splittergranate für die Hale’schen Raketen speziell gegen Luftschiffe entwickelt. Zumindest gegen solche, welche keinen dreifachen Rumpf aus kristallisiertem Leichtstahl besitzen. Und der ist nicht nur teuer, sondern auch schwer zu bekommen. Der größte Teil der Produktion wird eben immer noch in Deutschland und den Donaumonarchien selbst verwendet. Auf dem freien Markt – nun, man muss Glück haben und dazu einen Agenten finden, der nicht mit Italien in Verbindung gebracht wird. Denn die Stahlwerke in Ulm verkaufen an uns nur zu doppeltem Preis. Sie mögen Italien nicht wirklich, glaube ich.“
„Dann benützen sie eben Dampfkraftwagen, um den Nachschub nach vorne zu bringen!“ Die Faust des Königs donnerte auf den Tisch. „Muss ich mich nach neuen Generälen umsehen?“
„Majestät, so bitter es ist, wir müssen zugeben, dass Abessinien in diesem Abschnitt der Grenze die Lufthoheit besitzt und es auch schwierig ist, die Verteidigungsstellungen zu umgehen.“ Der Chef des Generalstabes, Generale Guido Trapare, blieb zumindest nach außen eiskalt und beherrscht, wie fast immer. „Der Negus Negest hat mit internationaler Technik viele sehr starke Wüstenforts errichtet, welche uns, des mangelnden Nachschubs wegen, durchaus Paroli bieten können. Der wirkliche Vorstoß war ja über Baylul geplant, wo die Äthiopier im Vertrauen auf die Verträge mit den Engländern noch keine Forts errichtet hatten. In der Wüste von Shabelle sollten doch nur die Kräfte des Feindes gebunden werden. Der auch noch bei weitem stärker war, als die Guarda Segreto angenommen hatte. Wasserrohre, ha! Wasserrohre, aus denen uns jetzt Granaten mit großer Sprengkraft entgegen fließen.“
„Mein Vorgänger und sein Stab haben leider völlig falsche Schlüsse aus der Größe und der Menge an Rohren gezogen. Und aus dem Umstand, dass keine Bauwerke an der Oberfläche der Wüste zu sehen waren“, verteidigte sich Colonello Granetti. „Selbst Majestät war der Überzeugung, dass eine Handvoll Halbwilder keine hervorragenden Verteidigungsanlagen bauen könnten. Wir haben uns alle einfach geirrt. Sie konnten und sie machten es, mit internationaler Hilfe. Woher die Mittel dazu kamen, können wir von der Segreto noch immer nicht sagen! Fest steht, dass die Staatsschulden Abessiniens dich in normalem Rahmen bewegen.“
„Dann – irgend etwas müssen sie verkaufen oder verkauft haben“, spekulierte Francesco Crispi, der Premierminister. „Ist etwas von Bodenschätzen wie Gold oder Edelsteinen bekannt?“
„Damit kenne ich mich nicht aus, Premierminister“, antwortete der Colonello. „Ich weiß nur von Salz und Weihrauch!“
„Meine Herren, ich stelle fest, das sie nichts wissen!“ Der König schlug einmal mehr auf den Tisch. „Das ist indiskutabel. Ich möchte Antworten, sonst können sie sich von den Sternen auf ihren Krägen verabschieden! Sie haben eine Woche Zeit, auf Wiedersehen, meine Herren.“
=◇=
Tibesti
Der Chef de Legion Hanns Joachim Landau erwachte in seinem Kämmerchen und warf das Mädchen, welches mit ihm im Bett lag, einfach mit einem Tritt seines Fußes aus seinem Bett.
„Verschwinde jetzt“, knurrte er sie grob an. „Komm am Abend wieder!“ Er war nicht mehr der höfliche, nette Offizier des kaiserlich-königlichen Dragonerregimentes Nr. 9, er war ein Wolf geworden, ein Leitwolf, der sich seine Macht mit der Waffe in der Faust und brutaler Härte verschaffte. Das war auch die Sprache, welche von dem Söldnerhaufen, den er hier im Bergmassiv Tibesti ausbildete und drillte, am Besten verstanden wurde. Und Landau war hart. Knochenhart. Seine Strafen waren überaus rigide, der Stock und die Peitsche für bereits kleinere Vergehen beinahe schon an der Tagesordnung. Seine Männer achteten ihn und seine Macht notgedrungen, aber sie hassten und fürchteten ihn mehr als Pest, Cholera und alle Geschlechtskrankheiten zusammen. Auch die vorhandenen Frauen, welche für die Bedürfnisse der Männer hierher gelockt worden waren, hatten Angst vor der harten Hand des ehemaligen Dragoners. Und Landau gefiel diese Furcht durchaus, welche er verbreitete. Schon lange war es ihm völlig egal, für wen oder warum er diese Söldner ausbilden und in die Schlacht führen sollte, und wen er dabei töten musste.
Rasch sprang Landau unter die Dusche, schlüpfte in seine leichte Uniform und begab sich danach zur Offiziersmesse. Sein Kamerad Lester Concord, der Kommandant der britischen Legion der Yasue, begrüßte ihn.
„Bonjour mon pote! Kommen sie, Hanns, setzen sie sich zu uns.“ Hier im Tibesti-Gebirge wurde als Standard ähnlich wie bei der Fremdenlegion französisch gesprochen.
„Oui, `Anns, viens ici, assis-toi“, lud auch Martin Letelier, der Kommandant der französischen Legion, Hanns Joachim ein.
„Bonjour, Lester, Martin. Gerne!“ Er setzte sich und winkte der Bediensteten herrisch zu. „Kaffee, Ei, Brot, vite, vite!“ Rasch brachte das Mädchen das verlangte Frühstück, und Martin griff ihr dabei ungeniert unter den kurzen Rock, unter welchem die Mädchen in dieser Anlage nichts tragen durften.
„Ein Glück, dass ich mich für diesen Haufen anheuern habe lassen“, lachte der Franzose rau und knetete grob die Hinterbacke des Mädchens, welches verschüchtert stehen blieb.
„Lass sie los, Martin! Ich möchte noch einen Kaffee“, monierte Lester, und Martin zog seine Hand zurück.
„Meinetwegen! Sie kommt ja wieder zurück, oder, Schätzchen?“
„Oui, mon Commandant, je reviens tout de suite!“
„Dann lauf zu!“ Letelier schlug ihr noch einmal hart auf die Pobacke!
„Was hat die französische Legion denn heute vor?“ Oberst Yassid alHassathi war zu seinen Legionskommandanten getreten.
„Heute wollte ich einen ordentlichen Marsch durch die Wüste unternehmen, einfach ein paar Kilometer hinaus, und morgen dann wieder zurück!“ Yassid nickte.
„Die britische Legion hat heute den Schießstand mit den beweglichen Zielen, also machen wir Übungen, vielleicht sogar Gefechtsdienst mit scharfer Munition, ein wenig Angst kann den Leuten nicht schaden“, erklärte Lester, und Hanns ergänzte.
„Bei uns ist heute Artillerieausbildung dran. Und wieder technische Vorträge, damit die Männer die alten Dampfelefanten auch richtig bedienen können.“
„Schön, meine Herren, dann will ich sie nicht weiter aufhalten!“
„Oui, mon Colonel!“ Die Majore erhoben sich, salutierten flüchtig und sammelten ihre Hauptmänner und Leutnants ein. Lester machte noch rasch einen Umweg zu dem Mädchen, welches seinen Kaffeebecher abwartend in der Hand hielt. Er nahm den Becher entgegen und legte seine Hand an ihre Wange.
„Danke, meine Schöne. Heute Abend, mein Quartier!“
„Ich werde gehorchen, mon Commandant!“
Die gesamte Kasernenanlage war in großen Höhlen in den inneren Hängen eines Vulkankrater im Tibesti – Gebirge im Tschad untergebracht, mitten im scheinbar trockensten Teil Sahara. Doch lange Treppen nach unten führten zu einem unterirdische See, welcher Menschen und Maschinen mit jeder benötigten Menge an Wasser versorgte. Die abgeschiedene Lage inmitten der Sahara sorgte dafür, dass die Soldaten und die Mädchen ihren Vorgesetzten widerspruchslos gehorchten, denn das Leben der Frauen und Männer lag wörtlich in der Hand der höheren Offiziere. Nur sie konnten die Türen zu den Wasserhöhlen öffnen, es lag in ihrer Entscheidung, das kostbarste Gut zu geben – oder aber zu verweigern. Es war für die Soldaten kein Problem, den Vulkan zu verlassen, und viele machten es auch, um ab und zu ein wenig allein zu sein. Aber Flucht war eine Unmöglichkeit, die Rückkehr in die Zivilisation nur auf einem Weg möglich. Wenn die Armeen bereit waren, sie in den Kampf zogen und diesen Krieg überlebten. Dann bekamen sie ihren angesammelten Sold ausbezahlt und durften gehen. Ein Traum, den aber nicht alle teilten, denn für manche war dieses Versteck genau das richtige. Sie wurden in der Welt draußen per Steckbrief teilweise sogar international gesucht. Die Guillotine oder der Galgen wartete auf nicht wenige dieser Söldner, und hier waren sie nicht nur davor sicher, sondern hatten alles, was sie zum Leben brauchten, ab und zu, genau reglementiert, sogar weibliche Gesellschaft. Zumindest solange die Söldner ihren Offizieren gehorchten. Aus den Männern war ein wahres Raubtierrudel geworden, das die Offiziere mir Angst und Gewalt regierten.
„Commandant Landau! Colonel alHassathi wünscht sie zu sprechen!“ Sergent Pablo Monterosa, der Schreiber des Colonel, öffnete die Tür zu jenem Auditorium, in welchem Andreas Fischer eben an einem großen Modell aus dünnem Blech die notdürftige Reparatur eines Dampfelefanten im Falle eines Achsbruchs demonstrierte und salutierte stramm.
„Ich komme, Sergent.“ Der Legionskommandant wandte sich an seinen Vertreter, den er selbst als den zweitstärksten Wolf in seinem 2.160 Männern zählenden Rudel ausgewählt hatte.
„Capitaine Moser, übernehmen sie!“ Der Österreicher verließ den großen Lehrsaal und folgte dem Sergente zum Bureau des Kommandanten der Söldnerkaserne. Dort pochte der Sergente und öffnete auf ein gebelltes „Oui!“ die Tür und salutierte nach der französischen Art, die Handfläche nach vor gekehrt.
„Mon Colonel, Commandant Landau!“
„In Ordnung. Eintreten lassen!“
Landau betrat das Bureau seines Vorgesetzten und stand stramm, als seine Meldung machte. „Commandant Landau meldet sich wie befohlen!“
Der bullige, große Africaner mit dem arabischen Namen musterte Landau durchdringend. Der Colonel war der einzige Mann, der es jetzt noch schaffte, in dem Österreicher wirkliche Angst hervor zu rufen. Nicht, dass er bei anderen nicht auf der Hut sein musste. Wenn Moser ihn aus dem Weg räumte, konnte er selbst die deutsche Legion übernehmen. Und Babette natürlich, welche Landau als sein Eigentum betrachtete.
„Setzen sie sich“, forderte der Colonel seinen Chef d’Legion endlich auf. „Commandant, ich benötige sie und einige Männer für einen Sonderauftrag! Lesen sie zuerst einmal!“ Colonel Yassid alHassathi gab Landau einen dünnen Akt.
„Das kann unmöglich so stimmen, mon Colonel!“ Ungläubig blickte der Österreicher auf, nachdem er den Bericht ausgiebig studiert hatte.
„Doch, Commandant.“ Der Colonel erhob sich und betrachtete aus einem schmalen Fenster den Krater des ehemaligen Vulkans. „.Man hat mit mitgeteilt, dass den Schriften der Thora der Stamm Daniel des Volkes Israels einst über eine solche Waffe verfügte, sie aber verschwand. Die Falaschen in Gonder sagen von sich, dass sie der verlorene Stamm Daniel sind, also besitzen sie unter Umständen diese Trommel. Oder doch Informationen über deren Verbleib! Bisher war die Trommel eine Legende. Es haben schon viele versucht, dieser Überlieferung auf den Grund zu gehen. Ganz offiziell oder im Geheimen, aber noch niemand hatte Erfolg. Aber jetzt! Jetzt gibt es Beweise!“ AlHassathi schwieg eine Zeitlang, dann drehte er sich um und fixierte Landau mit seinem stechenden Blick. „Diese Schilderung ging von Josephshafen aus in die ganze Welt, ein englischer Offizier des Pionierchors war Augenzeuge, also – gehen sie, Commandant. Ab sofort sind sie Officier de Missions spéciales. Ich gebe ihnen zehn vertrauenswürdige Männer mit, die sie unterstützen sollen. Sie nehmen unser Kurierluftschiff, es wird soeben startklar gemacht und draußen auf sie warten. Damit sind sie in etwa 42 Stunden in der Nähe des Tanasees, mehr als 60 Stundenkilometer schafft diese kleine zivile Yacht eben nicht. Dort steigen sie um auf Kamele, Pferde, was immer sich gerade bietet. Sie erhalten genügend Mittel mit, spielen sie den Forschungsreisenden, den neugierigen Touristen oder setzen sie wenn nötig brachiale Gewalt ein. Einige andere Trupps werden ebenfalls in der Gegend rund um den See abgesetzt, der Treff- und Abholpunkt aller Gruppen ist Gonder. Hören sie sich um, und versuchen sie, diese Trommel zu finden. Um jeden Preis, Landau. Verstehen sie mich? Um jeden. In drei Wochen wird sie das Luftschiff wieder bei Gonder abholen, suchen sie einen gut markierbaren Landeplatz! Gute Reise, und viel Glück, Commandant!“
Landau erhob sich und salutierte. „Sie können sich auf mich verlassen, mon Colonel!“
„Das weiß ich, Commandant.“ AllHassati entgegnete den Gruß. „Sie sind mein härtester Mann. Bringen sie mir die Trommel!“
=◇=
„Diese Breiten hat Gott in heiligem Zorn geschaffen!“ murmelte Landau vor sich hin, als die Yacht MOSES über die schier unendlichen Weiten der Sahara glitt. „Vom Atlantik bis zum roten Meer und noch weiter nur eine zusammenhängende Wüste, gerade einmal unterbrochen vom Nil.“
„Es ist unsere Heimat, Landau Bey. Sie mag trocken und heiß sein, feindselig und unwirtlich. Und doch ist sie wunderschön. Man muss erst lernen, hier zu überleben, die Oasen und Wasserszellen zu finden. Und wenn Allah dieses Land wirklich im Zorn geschaffen haben sollte, dann geschah es bei den Oasen in Liebe. Und bei seinen Kindern, den Beduinen, ganz besonders!“ Mehmet ibn Ali strich sich über den wallenden Bart. Der glutäugige Beduine war einer der Begleiter des Commandant, gekleidet in eine weite, leichte Hose in naturfarbener Baumwolle und ein ebensolches Hemd, darüber eine helle, kurze Weste mit vielen Taschen und ein rotes Tuch wie einen Gürtel um die Hüften geschlungen. Die Schnürstiefel aus dickem Leinen mit dicker Ledersohle, mit Leder verstärkter Spitze und Ferse schützten die Unterschenkel vor Schlangenbissen und dem heißen Sand, waren aber leichter und kühler als die üblichen Lederstiefel. Aus dem Tuch sahen die Griffe zweier langläufiger Colt – Revolver, wie die Beni Yasue sie vorzogen, hervor. Auch Hanns Joachim Landau hatte ähnliche Kleidung gewählt, allerdings in grauen und schwarzen Farbtönen, diese Tracht hatte sich in der Wüste einfach bewährt, und er trug seine Revolver mit der ausschwenkbaren Trommel lieber in Holstern in Oberschenkelhöhe. Wenn sie das Luftschiff wieder verließen, würden die Männer auch einen weißen, vorne offenen Mantel mit weiten Ärmeln und einer Kapuze gegen die brennende Sonne anlegen. Derzeit aber genossen sie noch die Annehmlichkeiten der Flugyacht und betrachteten die unter ihnen vorbeiziehende Sahara.
„Abdullah schickt ein paar frische Weiber!“ Faisal ibn Mahmud zeigte hinunter, seine scharfen Augen hatten die Karawane während der mittäglichen Rast entdeckt. „Hoffentlich schickt er auch endlich wieder ein paar von den blonden Europäerinnen mit!“

„Treiben es die denn soviel anders?“ Mehmet nahm noch einen Schluck Wasser.
Faisal grinste. „Ach, mir gefällt einfach die helle Haut! Und dass sich diese verdammt stolzen Weiber uns verachteten Beduinen dann doch noch unterwerfen müssen!“
=◇=
Wirklich brachte diese Karawane einige europäische Frauen, dieses Mal aus dem russischen und polnischen Gebieten, und auch aus Brandenburg und Sachsen. In Kairo waren sie fröhlich und scherzend aus dem Linienzeppelin gestiegen, voller Vorfreude, dem heiligen Land und dem Dienst am Messias nahe zu sein. Mit dem Schiff sollte es weiter den Nil abwärts nach Damiette und R’as bal Bar gehen, dort wollten sie auf ein Schiff nach Aschdod umsteigen. Ein Dutzend junge Frauen, welche davon träumten, in Jerusalem zu predigen und die Bevölkerung von den Segnungen des neuen Messias zu überzeugen. Am Hafen von Kairo hatten sie auch gleich ein Schiff gefunden. Eine Frau namens Yasemin, mit welcher sie am Kai ins Gespräch gekommen waren, hatte es ihnen empfohlen. Ein kleines, aber gepflegtes Dampfboot für zwölf Passagiere, der Eigner fahre die Strecke regelmäßig, erzählte ihnen Yasemin. Noch am selben Abend sollte es losgehen, und sie könnten schon einmal an Bord gehen und buchen. Danach, wenn sie wollten, noch einmal an Land kommen und mit ihr ein wenig Kairo besichtigen und vielleicht irgendwo einen Tee trinken. Sie waren der Empfehlung der netten Frau gefolgt, der Kapitän und seine Mannschaft hatten sie zuvorkommend begrüßt und ihr Gepäck auf die Kabinen gebracht. Dann hatte er ihnen eingeschärft, knapp nach Sonnenuntergang an Bord zu kommen, da er knapp danach, wenn der Mond schien, ablegen wollte. Yasemins Tee schmeckte gut, leicht nach den Minzeblättern darin, und sie scherzen und lachten, bis sie ermattet und schläfrig an Bord gingen und sich in ihre Kajüten zurück zogen.
Als die sieben Frauen am nächsten Mittag erwachten, mussten sie feststellen, dass sie stromaufwärts unterwegs waren, und das mit erheblicher Geschwindigkeit. Auch der Kapitän und seine drei Helfer waren nicht mehr nett zu ihnen, sie wurden in einen Raum gezwungen und dort eingeschlossen, die Bitten und Vorhaltungen der Frauen wurden von den Männern nur mit rohem Gelächter quittiert. Dass ihr Schicksal noch schlimmeres für sie bereithalten sollte, erfuhren sie am Ende des vierten Tages. Als nämlich das Schiff an einer Stelle an das Ufer fuhr, wo weit und breit kein Hafen oder Ort zu sehen war. Mit brutaler Gewalt zwang man sie der Reihe nach in ein Boot, mit welchem man sie einzeln an Land brachte. Dort erwarteten sie bereits einige Männer in der Kleidung von Beduinen und ein großer, mit Dampf betriebener Wüstenbus mit großen, breiten Rädern und Gittern vor den überstrichenen Fenstern.
„Na los, ausziehen und in einer Reihe aufstellen!“ Einige Schläge mit den Reitpeitschen unterstrichen den Befehl. „Ihr seid ab sofort unser Eigentum, ihr gehört uns, und damit ihr das versteht, werden wir uns jetzt eine von euch aussuchen!“ Er ging die Reihe entlang, jede Andeutung der Frauen, Scham oder Brüste zu bedecken, wurde mit harten Schlägen mit einem Treibstock für die Kamele geahndet. Dann wies der Anführer auf eine der Frauen. „Die da! Und bringt die anderen in den Wagen!“ Wieder halfen die Peitschen nach, bis elf der Frauen im Inneren des Busses waren.
„Was geschieht jetzt mit Natascha“, fragte Miriana und versuchte einen Spalt zum hinaussehen zu finden. Doch die Schreie und anderen eindeutigen Geräusche von draußen vertrieben ganz schnell ihre Neugier, und nach einer Stunde wurde die weinende und blutende, von allen Männern missbrauchte Natascha zu den anderen Frauen in den Wagen gestoßen.
„Lasst euch doch von ihr erzählen, wie eure Zukunft aussehen wird“, erklang die harte Stimme des Anführers, dann wurden durch eine Klappe auf dem Dach einige Blechflaschen geworfen. „Zwei Liter Wasser für jede von euch, die bekommt ihr jetzt jeden Tag. Und wehe, ihr teilt nicht ordentlich!“
Bald darauf ruckte der Bus an und fuhr los, das war vor ungefähr sechs Tagen gewesen, in welchen sie den Bus nicht verlassen durften. Für die Verrichtung der Notdurft war eine Klappe aus dem Boden geschnitten und die Öffnung danach mit einem starken Gitter versehen worden, für halbwegs brauchbare Körperpflege und ähnliches war nicht genügend Wasser vorhanden. Der Geruch im Inneren des Wagens war entsprechend streng, als endlich die Tür aufgeschlossen wurde.
„Sortier! Vite, vite“, brüllte ein Mann mit vier Streifen auf seiner Schulter die Frauen barsch an, seine ungeduldigen Gesten verdeutlichten den Befehl!
„Heraus! Dalli“, übersetzte ein Mann mit zwei Streifen. „Aufstellen, los, los, alle nebeneinander, wird es bald!“
Der Mann mit den vier Streifen stolzierte vor den Frauen, von dem anderen Mann übersetzt wandte er sich dann an diese. „Ich bin Chef de Legion Martin Letelier, und ihr werdet jeden, der wie ich vier Streifen auf der Schulter trägt, mit mon Commandant ansprechen. Ihr werdet jedem Mann hier gehorchen, jedem ohne Ausnahme, wenn nicht einer von uns mit vier Streifen etwas anderes befiehlt. Wir sind hier in der Ausbildungskaserne für die Asnan Alrabi, die Zähne des Herrn! Ihr seid hier, um die Zähne und uns, ihre Kommandeure bei Laune zu halten.“ Noch einmal schritt er die Front der Frauen ab, blieb vor Helga Bogner stehen und nahm ihr Kinn in die Hand. „Dafür bekommt ihr Essen und Trinken, dazu noch einen Schlafplatz. Das muss für euch reichen. Ihr solltet jeden Gedanken an Widerstand besser gleich aufgeben, denn sonst gibt es weder Nahrung noch Wasser, sondern die Peitsche.“ Er wies mit dem Daumen über seine Schulter. „Oder die Blechhütte. Darin wird es tagsüber ziemlich heiß, kein angenehmer Aufenthaltsort. Umdrehen“ herrschte er Helga an. „Bücken!“ Er drückte ihren Oberkörper hinunter und drückte die Beine auseinander. Dann schlug er ihr mit der flachen Hand auf das Hinterteil, ehe er weiter ging. „Ich habe nicht gesagt, dass du dich bewegen darfst“, schrie er Helga an, als die Frau sich wieder aufrecht hinstellen wollte. Rasch bückte sie sich angstvoll wieder in die demütigende Position. „Lernt ganz schnell die französische Sprache, aber für dich…“ er wies mit dem Finger auf Luise Wagner, eine große, blonde Sächsin, „Für dich werde ich heute Abend keine Worte benötigen! Und jetzt bewegt euch! Alle! Rein in den Gang, dann wird man euch euer Zimmer zuweisen und den Tagesablauf erklären. Los, los, nur keine Wurzeln hier im Freien schlagen!“ Damit begann für die sieben Frauen der Dienst für die Ziele des Goldenen Frühlings, ohne dass sie es wussten. Sie glaubten immer noch, von Mädchenhändlern entführt worden zu sein, denn dass der Frühling Soldaten einsetzen sollte, das konnten und wollten sie nicht glauben.
=◇=
Abessinien
Die zehn Beduinen unter Chef du Légion Landau hatten das Luftschiff auf der fruchtbaren Hochebene westlich des Tanasees und nördlich des Vulkans Aroua verlassen. Von oben hatten sie eine Farm ausgemacht, einige Pferde, viele Ziegen und Schafe, ringsum Kilometer nichts als Weide und ein paar Hügel, Bäume und Bäche. Landau hatte beschlossen, hier zu landen und von der Farm für sich und seine Männer passende Fortbewegungsmittel zu beschaffen. Diese Farm gehörte Lars Jonson, einem friesischstämmigen Abessinier, dessen Vater es einmal als Söldner hierher verschlagen hatte und der, für seine treuen Dienste mit gutem Land bezahlt, geblieben war. Leider wurde Lars auf seiner eigenen Farm nach vielen Jahre Ruhe etwas zu unvorsichtig und trug seine Waffen nicht griffbereit bei sich.
„Wir haben hier kein Dampfmobil gefunden, Landau Bey, aber der Mann hat Pferde, mehr als genug für uns. Er will sie uns aber nicht überlassen! Nicht für Gold und gute Worte.“ Mehmet stemmte seine Fäuste in die Hüften.
„Dann soll eben die Peitsche mit ihm reden und er wird in Blei bezahlt.“ Landau lockerte seinen Revolver im Holster und stolzierte mit fünf seiner Araber auf den Pferdezüchter zu. „Packt und fesselt ihn“, befahl er ihnen, und seine Männer führten seinen Befehl sofort aus.
„Also doch dreckige, gemeine Räuber!“ schimpfte der Mann.
„Was soll ich sagen“ Landau stieß den Mann mit der Stiefelspitze an. „Pferderaub ist bei den Beduinen eine ritterliche Tat!“ Ein lauter Schrei ertönte, und als Landau sich nach der Quelle desselben umblickte, bemerkte er, wie Faisal eine blonde Frau an den Haaren aus dem Haus zerrte. „Ich glaube, die Zeit nehmen wir uns auch noch.“ Er drehte sich vollends um schritt auf Faisal und die Frau zu. Über die Schulter gewandt sagte er nur noch „Erschießt ihn, und dann kommt nach!“
=◇=
„Lars?“ Der alte Mann auf dem Pferd kniff die Augen zusammen.
„Gefesselt und dann erschossen, Pa!“
„Und was ist mit Heidi?“ Der jüngere Mann schluckte nur trocken und schüttelte den Kopf. „So schlimm?“
„Schlimmer, Pa. Die Arme ist nicht leicht und leider auch nicht schnell gestorben.“
Harald Werther nickte. „Ich habe ihn gewarnt, immer und immer wieder. Gehe nie unbewaffnet aus dem Haus, und bring deiner Frau das Schießen bei. Und jetzt? Ich wollte, ich hätte Unrecht gehabt, und Lars würde hier stehen und mich wegen meiner Übervorsicht auslachen. Henning, min Jong, wie viele waren es?“
„Elf, Pa.“ Henning wies nach Westen. „Dort drüben fangen ihre Spuren an, sie müssen mit einem Luftschiff gekommen sein. Sie sind in der Deckung von dem Hügel dort angeflogen, haben sich angeschlichen und dann Lars und Heidi überfallen.“
„Und wann?“
Harald zog ein Taschentuch hervor und schnäuzte sich lautstark, während Henning sich noch einmal umsah. „Ich würde sagen, sie sind vor vier, vielleicht auch fünf Stunden von hier weggeritten!“
„Meine arme Heidi, wie oft habe ich ihr das Gewehr in die Hand drücken wollen, wie oft mit dem Revolver üben. Immer hat sie gesagt, wir leben in einem guten Land, wo es Recht und Gesetz gibt. Und das stimmt ja auch, das Gesetz gibt es ja, bloß ist es hier draußen verdammt weit weg. Wie sollte es denn auch anders sein, zu viel leeres Land und zu wenig Leute. Hilft aber nichts, wenn wir bloß jammern, min Jong! Begrabe du jetzt deine Schwester und ihren Mann, ich reite nach Sēminī und benachrichtige die Askari. Morgen kann ich mit einer Truppe wieder hier sein, dann nehmen wir gemeinsam die Verfolgung auf.“
„Wie brauchen gute Pferde. Sie haben die besten Renner von Lars gestohlen“ warf Henning noch ein.
„Ja, schnell sind die Pferde, die Lars gezüchtet hat“, nickte Harald. „Schnelle Renner! Aber wir machen uns auf eine Jagd, min Jong, auf eine lange Jagd. Und ich sage dir, die langsameren, aber ausdauernden Zossen, die ich den abessinischen Askari in Guba geliefert habe, werden bei einer solchen langen Jagd erfolgreich sein. Wenn unsere Hintern mitspielen.“
„Da hab‘ wenig Sorgen Pa. Wir sind vom Viehtrieb gewöhnt, tagelang im Sattel zu bleiben! Unser Arsch ist aus besserem Leder als so mancher Sattel.“
„So ist’s recht, Henning, min Jong! Das ist die richtige Einstellung. Bis morgen dann!“
In der Hochebene rund um die Stadt Sēminī im Woreda Goba hatten sich die Überlebenden einer deutschen Söldnertruppe angesiedelt, welche im Krieg gegen die moslemischen Sultanate auf der Seite des äthiopisch-orthodoxen christlichen Abessiniens gekämpft hatten. Einen Teil ihres Soldes hatten sie in fruchtbarem Land und Tieren ausbezahlt bekommen. Die zumeist aus den nördlichen Ländern des deutschen Kaiserreiches stammenden Männer, welche zu Hause als dritte oder vierte Söhne für sich ohnehin keine Zukunft als Bauer oder Handwerker gesehen hatten, griffen nicht ungern zu. Nach einiger Zeit schrieben einige nach Hause und luden ihre Familien zu sich in dieses Land ein, in dem sie sich allmählich zu Hause fühlten. Einige der Männer heirateten zwar abessinische Frauen, und einige der Frauen, welche mit ihren Eltern oder Brüdern hierher zogen, nahmen dunkelhäutige Einheimische zum Mann, aber im Allgemeinen blieben die Deutschen ganz gerne unter sich. Mit Labskaus, in Essig mit Zwiebeln eingelegtem Fisch aus dem Tanasee, Brötchen und natürlich dem friesisch herbem Bier. Nicht, dass das Verhältnis zwischen ihnen und den Abessiniern ein schlechtes gewesen wäre, und wenn einer die Hilfe eines anderen benötigte, funktionierte es auch recht gut. Wenn eine neue Scheune gebaut werden musste, kamen schwarze und weiße Nachbarn zusammen, arbeiteten, tranken, aßen und lachten zusammen. Man achtete und mochte einander, vertraute sich gegenseitig Heim und Familie an, wenn man einige Tage in die Stadt oder auf einen Viehtrieb musste. Und trotzdem – irgendwie zogen Deutsche als Gatten meistens Deutsche vor. Vielleicht wegen der Küche, diese schwarzen Abessinierinnen brachten das Labskaus und den Rindereintopf einfach nicht so hin wie Mutti.
Es lag auf der Farm von Lars Jonson ein brutaler Überfall mit zwei Toten vor, besonders schwer dabei wog die tödlich endende Vergewaltigung durch die elf Männer. So war es auch kein Wunder, dass am nächsten Tag zwanzig berittene Farmer und ebenso viele abessinische Askari auf Pferden und einem dreiachsigen geländegängigen Dampfvehikel der Polizei, gut ausgerüstet mit Vorräten und Munition, auf die Farm der Jonsons kamen. Das gleiche Aufgebot hatte vor einigen Wochen einige Räuber aus dem Sudan stellen können, welche das Vieh und die Frauen einiger africanischer Bauern gestohlen hatten, und sie hatten einen Überfall von Mahdisten auf Rak’i Sēminī abwehren können. Es war also eine durchaus erfahrende, schlagkräftige und aufeinander eingespielte Truppe. Mit dem besten Fährtenleser der Gegend, der sich sofort an die Spitze der Verfolger setzte. Heidi war eine sanfte, nette Frau gewesen, bei Jedermann in dieser Gegend beliebt, ob schwarz, weiß oder gemischt, ob Mann, Frau oder Kind. Doch lange Trauerfeierlichkeiten mussten zuerst einmal warten, bei ihrer Rückkehr würde, wie in dieser Gegend üblich, ein gemeinsamer Gottesdienst mit den Geistlichen beider Richtungen, der orthodoxen und der lutherischen, stattfinden. Jetzt aber galt es, keine Zeit mehr zu verlieren. Henning hatte einige Kannen Kaffee gekocht, die jetzt noch rasch getrunken wurden, und dann machten sich die Männer auch schon auf den Weg.
„Sie sind nach Westen!“ Yoseph Irenya zügelte sein Pferd neben dem Wagen, in welchem der Hauptmann der Asaker fuhr. Auch Harald Werther auf seinem stämmigen Schecken kam hinzu geritten. „Ich glaube, sie wollen nördlich vom Negusawi Dawit durch die Hügelkette reiten!“
„Also über Icaco nach Mecha oder Delache“, überlegte Samuel Lench’a, der Captan. „Wie es auch sei, wir haben per Telegraphie unsere Station in Bahir Dar verständigt, und ich glaube, es wird ihnen schwer fallen, dort den blauen Nil zu überqueren. Wenn sie überhaupt so weit kommen sollten. Wie viel Vorsprung haben die Mörder?“
„Ich möchte sagen, zwischen und zwölf und fünfzehn Stunden!“
„Dann holen wir langsam auf. Mit etwa siebzehn Stunden Rückstand sind wir aufgebrochen?“ Der Offizier dachte nicht lange nach. „Weiter! Ich möchte möglichst nahe an die Hunde heran, ehe wir rasten. Harald, wie lange noch, ehe die Pferde eine Pause benötigen?“
„Ich würde dort unten den Fluss vorschlagen, Captan Samuel. Dort können sie sich satt trinken, sich ein wenig wälzen und einige Mäuler Gras fressen.“
„Einverstanden!“ Der schwarze Arm des Offiziers hob sich senkrecht in die Höhe, dann wies er nach vor. „Vorwärts, Marsch!“
Die Männer hatten die Sättel abgenommen und die Pferde zum grasen geschickt. Nun saßen sie an einem kleinen Feuerchen und wärmten schnell einige Konserven, welche sie halb warm hinab würgten, erleichtert durch einige Schlucke schwarzen, süßen Kaffees aus der Feldflasche. Kalt, denn das Feuer hatten sie schnell wieder ausgetreten, damit es nach ihrem Aufbruch nicht noch gloste und einen der gefürchteten weitläufigen Weidebrände verursachte. Reihum verschwanden die Männer noch in die Büsche, nach etwa einer Stunde drängte der Hauptmann bereits wieder zu Aufbruch.
„Abmarsch. Wie viel Rückstand, Yoseph?“ Der Scout hatte sich genau umgesehen. „Sie haben hier etwa vier Stunden Pause gemacht, den Spuren am anderen Ufer nach würde ich jetzt auf noch zehn Stunden schließen.“
„Weiter! Wir benötigen einen Platz für etwa zwei bis drei Stunden, wenn es Nacht wird.“
„Ich kenne einen“, versprach Yoseph.
=◇=
Fünf Tage lang waren die Männer nur für kurze Rasten aus den Sätteln gekommen, doch aufgeben kam für sie nicht in Frage. Nur weiter, immer weiter. Besonders, seit sie die Farm von Juda Brayatu gesehen hatten, die Eltern, die Kinder und die Angestellten, die Spuren der schweren Peitschen aus Flusspferdhaut. Es gab niemand in der Truppe, von dem die Mörder, Folterknechte und Vergewaltiger auch nur auf die geringste Milde hoffen durften. Sie alle waren nur noch von dem Wunsch getrieben, diese Männer zu stellen und ihrer Strafe zuzuführen. Eine öffentliche Hinrichtung in der Provinzhauptstadt Bahir Dar. Östlich von Mecha begann eine große, fruchtbare Ebene bis etwa Bahir Dar, wo der blaue Nil dem Tanasee entsprang und sich in weiten Schleifen zuerst weit nach Osten und dann nach Süden wand, um danach in einem weiten Bogen wieder nach Westen und schließlich nach Norden zurück zu kehren. Der Fluss hatte sich teilweise hunderte Meter tief in das äthiopische Hochland eingegraben und floss in tiefen Tälern durch Äthiopien und den Sudan, um sich bei Karthoum mit dem weißen Nil zu vereinigen und als lebensspendende Ader durch die Wüste nach Norden dem Mittelmeer zuzufließen. Östlich von Bahir Dar wurde das Land wieder zerklüftet und schwer passierbar, Captan Samuel Lench’a hatte daher den Wagen zurück gelassen und auch dessen Besatzung beritten gemacht. Geführt von ihrem Scout Yoseph Irenya folgten sie den Spuren und holten langsam, aber stetig auf, nur noch ganz wenige Stunden waren die Verfolgten noch voraus.
„Dort!“ Henning wies etwas beiseite, eine dunkle Rauchwolke erhob sich hinter einem Hang. Sofort trieb Yoseph sein Pferd an, wandte sich knapp vor dem Kamm um und winkte den anderen, ebenfalls zu kommen. Der Trupp sprengte den Hang hinauf, von oben sah man ein kleines Gehöft in Flammen stehen, aus denen ein Mann stolperte, der sofort niedergerungen, gefesselt und zu anderen, bereits gefangenen Personen gelegt wurde. Samuels rechte Hand hackte nach unten, und die Reiter galoppierten los, dabei ihre Waffen schußbereit zur Hand nehmend.
=◇=
„Na los, gerbt ihnen ordentlich das Fell“, befahl Landau voller Vorfreude. Die Schmerzen, die Angst, das Geschrei der Gefolterten bereiteten ihm beinahe körperliche Lust. „Irgendwer muss doch etwas über diese komische Waffe wissen!“
Mahmud ibn Abi nahm grinsend seine Peitsche zur Hand. „Mit dem größten Vergnügen, mon Commandant.“ Er holte weit aus, stolperte dann aber plötzlich zwei, drei, vier Schritte vorwärts und brach mit ungläubigem Gesicht zusammen. Die Hand des ehemaligen Dragoneroffiziers griff zur Waffe, noch ehe sein Gehirn die Gefahr komplett erfasste, er riss den schweren Revolver heraus und wirbelte herum. Eine Kugel traf seinen Arm, eine weitere sein Bein. Er versuchte noch einmal, seinen zweiten Revolver mit der linken Hand auszurichten, doch dazu kam er nicht mehr. Einer der Reiter sprang von seinem Pferd, sein Stiefel traf Landau seitwärts am Kopf, Dunkelheit breitete sich in seinem Denken aus. Als er langsam wieder zu sich kam, war er fest und schmerzhaft an Armen und Beinen gefesselt.
„Ach, der feine Pinkel ist auch schon wieder wach!“ Ein alter Mann mit wild wucherndem Bart sprach ihn auf englisch an. „Weißt du, wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle einfach hier aufhängen. Oder dort in das brennende Haus werfen. Aber der Samuel, der unser Captan ist, möchte euch nach Bahir Dar bringen. Nun, mir ist das auch recht, das Ergebnis bleibt im Endeffekt ja doch das gleiche. Ihr werdet allesamt am Halse aufgehängt, bis der Tod eintritt. Oder gesteinigt. Oder irgendwie anders hingerichtet. Und das ist für euch Verbrecherbande eigentlich noch viel zu gut!“ Harald Werther trat Landau noch einmal kräftig in die Rippen. „Das war für Heidi, du gottverdammter Hurensohn!“
Henning zog seinen Vater weg. „Komm, Vadern! Mach dir die Stiefel nicht an einem solchen Stück Scheiße dreckig! Außerdem, wenn sie im Kittchen sitzen, werden ihnen einige von den anderen Gefangenen schon klar machen, was sie von Vergewaltigern halten.“ Landau schloss die Augen. Er hatte verloren, auf ganzer Linie. Damit musste er sich nun abfinden, das Risiko war ihm bewusst gewesen, sein Weg ging jetzt eben zu Ende. War es das wert gewesen? Die schmucke Einserpanier der 9. Dragoner mit der weißen Jacke zu den dunkelgrünen Hosen und dem schwarzen Lederzeug fiel ihm wieder ein. Er könnte sie immer noch tragen, wenn nicht – nein, es war seine Entscheidung gewesen. Die Diebstähle, die Betrügereien, später dann die Vergewaltigungen, die – Morde. Niemand hatte ihm die Waffe an den Kopf gehalten, niemand ihn gezwungen. Er war in letzter Zeit seinen niedersten, seinen sadistischen Trieben gefolgt, und jetzt zahlte er eben den Preis dafür.
Im Schritt ritten die zwanzig Polizisten und die Farmer in Richtung Bahir Dar, die zehn Gefangenen, welche notdürftig verbunden waren, stolperten an einer Leine um den Hals hinter den vorderen Reitern her. Captan Samuel Lench’a hatte keine Lynchjustiz zugelassen, aber besonders in Schutz hatte er die Verbrecher auch nicht gerade genommen. Die Wunden waren nur so weit versorgt worden, dass die Beduinen und Landau marschieren konnten. Die Leiche Mahmuds hatten die Farmer in das brennende Haus geworfen, löschen machte ja ohnehin keinen Sinn mehr. Der Farmbesitzer Thomas At’imashi ritt mit den Polizisten nach der Hauptstadt der Provinz, während sein Sohn mit den Angestellten und den Nachbarn mit dem Wiederaufbau beginnen wollte. Auch Sahra At’imashi war bei ihrem Sohn auf der Farm geblieben, sicherheitshalber. Nicht, dass die Gejagten noch entkommen konnten, indem sie eine Frau als Geisel nahmen. Es war kein fröhlicher Ritt, die Sieger waren immer noch bedrückt von den Bildern, die sie während der Verfolgung zu sehen bekommen hatten.
=◇=
Berlin
Kriminalrat Franz Kaltenegger hatte das Herz in der Hose und einen mächtigen Frosch im Hals. Immerhin geschah es ja nicht jeden Tag, dass man einer Legende gegenüber saß, und der Kanzler und Einiger Deutschlands zum Kaiserreich Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck konnte schon zu seinen Lebzeiten durchaus als solche bezeichnet werden.
„Der Minister für innere Sicherheit und der Heeresminister haben mir etwas mitgeteilt, das ich kaum glauben kann, meine Herren!“ Der vierschrötige Mann schlug mit der Faust auf den Tisch.
„Mit Verlaub, Durchlaucht, aber der Kriminalsrat Kaltenegger ist ein durchaus fähiger Mann, der sich nichts aus den Fingern saugt.“ Oberst Donnersmark ließ sich nicht einschüchtern und stand zu seinem Kriminalrat. „Und er hat den Hersteller befragt, der ihm bestätigt hat, dass die gesamte Produktion von Munition und Waffen ohne Umweg an den geheimen Dienst und das Heeresbeschaffungsamt geliefert wird.“
Der Blick Bismarcks durchbohrte den Polizeirat. „Und dass direkt an der Quelle etwas verschwindet, hat er das auch bedacht?“
„Ich bitte Euer Durchlaucht…“
„Sprech er kurz und lass er diese Floskeln beiseite. Fürst reicht aus!“
„Nun jut“, nickte Kaltenegger. „Die Pistolen wurden in eener Serie von eentausend Stück fabriziert und an det Beschaffungsamt jeliefert. Ordentlich quittiert. Seitdem ist keene mehr jebaut worden, und diese speziellen Flechettes passen nur in die Heereswaffen. Da hat eener een janz jewaltigen Fehler jemacht, Fürst. Entweder hat eener von die Jeheimen den Schmissbacke Bobo umjenietet, eener von die Offiziere, oder eener von die Offiziere hat die Kanone jemandem überlassen. Die Dinger wurden an hohe Offiziere oder an Jeheimbeamte ausjegeben, und ick gloobe, die Jeheimen werden ihr Handwerkszeuch nich so einfach aus der Hand jeben. Außer sie sind tot, aber auch dann sollten wa wissen, wat jespielt wird.“
„Ich mag nicht, was er da andeutet, Kaltenegger!“ Bismarck beherrschte sich mühsam.
„Ick ooch nich, Fürst. Aber wat anderes will mir partout nich einfallen!“
„Mir auch nicht, Fürst!“ Der Herzog von Donnermark verteidigte seinen Beamten. „Wir werden selbstverständlich so diskret wie nur irgend möglich vorgehen, aber wir benötigen Akteneinsicht. Wir müssen wissen, wer eine solche Waffe bekommen hat!“
Der Kanzler starrte eine Zeit lang ins Leere, dann warf er einige Zeilen zu Papier und unterfertigte sie. „Hier, nehmen sie. Und jetzt hinaus, bevor ich es mir anders überlege. Die Offiziere erfahren sie, die Beamten des geheimen Dienstes werden vorderhand intern überprüft.“
„Danke, fürstliche Durchlaucht.“ Kaltenegger nahm die Order des Reichskanzlers und verstaute sie in seiner Brieftasche. „Wenn mir die jnädichsten Herren jetzt entschuldigen wollen!“ Mit einer höflichen Verbeugung verabschiedete sich der Kriminalrat.
Außerhalb des Bureaus lehnte sich Kaltenegger an die Wand und schnaufte erst einmal tief durch, dann las er die Order. Es war beinahe schon eine Card Blanche zu nennen, was die Untersuchungen der Morde mit einer reinen Militärwaffe anging. Beinahe, den die Geheimen waren derzeit noch ausgenommen. Diese aber verdächtigte Kalenegger ohnehin erst in zweiter Linie.
„Jut, jut“, murmelte er sich selber Mut zu. „Dann wollen wa mal!“ Er straffte seine Gestalt wieder und schritt durch den langen Flur des Kanzleramtes zum Eingang.
„Wie is et jeloofen, Herr Rat?“ Fritze Brauwitz und Karl Fischer traten an ihren Chef heran.
„Jut, Fritze. Wa haben dit Order, wa können an dit Arbeit jehen. Wollen wa mal kiecken, ob wa irchend eene Vabindung von die Friedrichstraße und dit Liste finden! Kommt mit, zuerst zum Heeresbeschaffungsamt, und dann werden wa Akten wälzen. Da kommt die Dampftram, springen wa gleich mal uf!“
An der Prachtstraße Leipziger Straße Nummer 5, angrenzend an den Garten des Prinz-Albrechts-Palais, stand im Bezirk Berlin Mitte das Heeresministerium und, in einem neu gebauten Nebentrakt, das kaiserlich Heeresbeschaffungsamt. Im Keller des Gebäudes konnte man jede ausgegebene Waffe in den Akten verfolgen. An wen wann wo warum ausgegeben, wieviel Munition, wie viel davon wurde warum verschossen. Alles stand hier, sobald man es dem Amt mitteilte, und das geschah üblicherweise zumindest einmal im Monat per Telegramm. Die erste Erhebung des Kriminalrates musste also eine Liste der Personen sein, welche eine solche Waffe besitzen sollten.
„Sind ja mal nur dreihundert Namen zu kontrollieren!“ meckerte Kalle Fischer. „Wie sollen wa da uf nen jrünen Zweech kommen?“
„Zuerst mal kiecken, ob eener in der Umjebung von die Friedrichstraße oda in det Nähe von dit Brauross-Anne ihrer Wohnung jemeldet ist.“ Fritze rollte einen Wagen mit Akten in das Bureau. „Det Melderejister. Lies ma den ersten Namen vor, Kalle, und ich kiecke, ob wa ne Adresse haben.“ „Also jut! Pistole Nummero null Punkt null null eens. Jeneraloberst Andreas Maria Kaltenstrom!“
„Im Einsatz! Der Herr Jeneraloberst sitzt in Friedrichsburch als Jeneraljouverneur vom Südkontinent.“ Atze Friedmann hatte die Einsatzakten vor sich. „Seit eenem Jahr in Kooriland. Da hat er die Pistole wohl mit!“
„Jut, schon eener weniger! Siehste wohl!“ Eine Pistole nach der anderen konnte ausgeschlossen werden.
„Jetzt kieck mal eener an!“
„Wat denn, Fritze? Wohnt dit Rittmeester Kostrovar denn irjendwo in dit Umjebung?“
„Nee, tschuldiche, Kalle. Aber ick seh‘ hier, dat eene Kostrowski Katherina in dit Friedrichstraße jemeldet ist!“
„Wat denn, die Kosaken-Kathi? Ick kann mir nicht erinnern, da wat jesehen zu haben. Die alte Bordsteinschnepfe wär mir doch wohl ufjefallen. Wart mal nen Momang!“ Friedrich blätterte in seinen Aufzeichnungen. „Also, an dit Adresse ist für dit janze Haus det Schild „Joldener Frühling jehangen!“
„Na siehste, Fritze! Ick habe dir doch gleech jesacht, det ist een simples Puff mit nem jroßartigem Namen!“
„Na, wirste recht haben. Die jute, alte Kosaken-Kathi. Weiter.“
„Na jut. Also, Nummero null Punkt eens zwee vier! Rittmeester Meester! Beschissener Rang for dit Name.“
„Stationiert in Deutsch-Westafrica!“ Die vier Polizisten arbeiteten die halbe Nacht. Von der nahen Jakobinerkirche schlug die voll klingende bronzene Glocke eben ein Uhr, als Fritze den letzten Meldezettel in das Register zurück steckte.
„Na siehste, Kalle. Von die paar hundert sind nur mehr unjefähr fufzich jeblieben! Melden wa dit morjen dem Herrn Rat!“
=◇=
„Neuigkeiten, Jungs!“ Kriminalrat Franz Kaltenegger warf seinen Zylinder auf den Tisch und seine Handschuhe hinein. „Ein jeheimer Ajent in Wien hat dem ollen Donnersmark da wat jesteckt. Die Kakanier sind im Zusammenhang mit eenem Giftanschlach uff die Prinzessin Maria Sophia und der Ermordung von eener jungen Adligen in Kairo uff eene konschpirative Orjanisation uffmerksam jeworden. Mit dem Namen Joldener Frühling! Also, wenn euch da wat ufffällt, denn sacht mer dit!“
„Also, Chef, da müssen wa nüscht lange suchen. Dit Puff is in dit Friedrichstraße!“
„Wie kommste uff Puff, Atze?“ Kaltenegger hatte soeben den Überzieher ablegen wollen und verharrte.
„Wenn die Kosaken-Kathi Kostrowski im Spiel ist, denn ist dit n Puff“, stellte Karl Fischer kategorisch fest.
„Jut Justav!“ Kaltenegger schlüpfte jetzt ganz aus dem Winterrock. „Wat is, Atze, Kalle, wollt ihr mal uff Staatskosten in dit Puff jehen?“
„Na allemal, Herr Rat! Allemal.“ Fritze sprang auf. „Mensch, der Kosaken-Kathi noch mal ordentlich an die Wäsche jehen, dit wär schon `n Spaß wie Bolle. So richtig filzen, det nich der kleenste Jroschen in det Tasche bleebt. Ick bin ma sicha, dit Meechen hat schon vor Jahren Koks verkooft, aba ick hab nie wat jefunden. Ick konnt ma schon denken, wo sie det Zeuch jehabt hat, aba dort durfte ick ja nich nachkiecken.“
„Werden wa aba noch warten müssen, Junge! Vorher kieckt ihr zwee Hübschen und ein paar Kollechen in Zivil mal, wer da aus- und einjeht! Vielleicht kennen wa ja eenen von die Typen“, bremste Franz Kaltenegger.
„Oder von die Meechen, Herr Rat. Da könnte ja ooch wat zu erfahren sein“, warf Kalle ein. „Nich alle von die Penunzenritzen sind ooch miese Weiber! Denkt ma an die Brauross-Anne, dit Meechen hat een Herz aus Jold jehabt! Ooch wenn se für Penunze den Arsch hinjehalten hat.“
„Haste recht, Kalle. Dit Anne war sicher nich die eenzige ehrliche Bordsteinschnepfe, kiecken wa mal.“
„Ach Fritze!“ Kaltenegger schüttelte den Kopf. „Die meisten horizontalen Meechen sind viel ehrlicher als Politiker. Die Huren müssen für ihr Jeld wenigstens den Arsch hinhalten!“
Der April hatte auch in Berlin endlich für angenehmere Temperaturen gesorgt, der Schnee, welcher im März dieses Jahres 1889 Deutschland und Österreich in Atem gehalten hatte, war nun geschmolzen. Die Temperaturen sanken tagsüber kaum mehr unter 15 Grad, und auch des Nachts erreichte das Thermometer die Null Grad nicht mehr. Während die beiden Schutzmänner über die Friedrichstraße flanierten, hielten sie ihr Gesicht in die bereits wärmende Sonne.

„Det is doch besser, als wenn dit Schnee fällt. So een schönes Wetter heute. Kaum een Wölkchen am Himmel!“ Manfred Jankowsky wirbelte mit seinem Schlagstock in der Luft. „Vorsicht, Steppke. Renn dit Leute nich üban Haufen. Und halt dit Mütze nächstens besser fest!“
„Mach ick, Manni! Tschuldige bitte!“
„Na denn, loof ma zu, Klause. Aber kieck besser ma, woste hinrennst!“ Er sah dem Jungen nach. „Dit Klause wird immer jrößer. Bald wird da die lange Hose fällich, ick muss ma mit dit Mutter reden. Is ja doch meene Olle, ooch wenn det Steppke nich von mir ist.“
„Jo, wie alt ist det Klause eigentlich? Vierzehn? Momang!“ Atze Friedmann hielt einen Mann auf. „Haben se een Ausweis?“
„Hab ick, aba warum, Herr Schutzmann?“
„Weilste der Fünfte mit Brille und Zylinder bist, der mir heute üban Wech läuft. In Ordnung, der Herr. Danke schön!“ Er gab den Ausweis zurück. „Wünsche noch een schönen Tach!“ Atze tippte an den Schirm der Pickelhaube. Laut, so dass der eben kontrollierte Mann es hören konnte, sprach er weiter. „Also, Manni, ist det Klause vierzehn?“
„Bald fünfzehn“, antwortete Manni Jankowsky. „Mit dit Grete bin ick jetzt dreizehn Jahre zusammen, und da war det Kläuschen schon fast zwee! Hallo, Hanna. Wie jehts der Familie?“ Manfred tippte an die Haube.
„Jut, jut, Manni. Danke dir!“ Eine ältere Frau mit einem jungen Mädchen, das eine große Einkaufstasche trug, beide in der Uniform von Dienstboten gekleidet, eilte an den Beiden vorbei.
„Also Atze, wat hab ick übasehen. Warum hast du nach det Ausweis von dem Typ jefracht?“
Alexander Friedmann nahm die Pickelhaube ab und kratzte sich am Kopf. „Na, wie du mit dit Klause gesprochen hast, habe ick jesehen, wie dit Männecken bei der Kosaken-Kathi aus dem Haus heraus jekommen ist.“
„Und? Wer ist er, Atze“, fragte Manni gespannt.
„Dit müssen wa heraus bekommen, Manni. Een jewisser Johannes Mohnkow. Aus Dresden. Det Name sacht mir aba nichts!“
„Dann werden wa wieder Akten wälzen dürfen“, murrte Manfred. „Ich sage es dit Grete, dass du nich Heim kommen kannst! Wann klingeln denn die Glocken zur Hochzeit?“
„Ach, halt doch die Schnauze, Atze. Se will mir noch nich heiraten, obwohl wa doch jetzt schon zwee Meechen miteinander haben. Aba verlobt, dit sin wir schon ma!“
„Kieck ma, Manni. Dit Wolfjang steht uff seinem Posten und behält dit Haus im Ooje.“ Die Uniformierten waren weiter geschlendert, auf der anderen Seite der Friedrichstraße sahen sie einen Kollegen aus einem anderen Bezirk in Zivil stehen.
„Der hat et jut. Darf in dit Sonne stehen und sich die Leute ankiecken, die bei dit Kosaken-Kathi vakehren. Also, ick würd mir ja langweilen, so janz aleene dort herumstehen und nich jemand zum schwatzen haben.“
„Ach, der wird bald wieder abjelöst, Manni. Sonst fallen die Leute noch uff. Ach, dort kommt ja schon Horst als Ablöse! Juten Tach, Herr von Hoesch!“ Beide Schutzmänner salutierten höflich.
„Guten Tag, Jankowsky, Friedmann. Passen sie mir nur gut auf unsere schöne Friedrichstraße auf.“ Ein gut gekleideter, ziemlich beleibter und jovialer Mann war aus einem der Häuser getreten. „Wie immer wartet eine Kanne Kaffee und ein paar Brote auf unsere wackere Polizei. Schönen Tag noch, meine Herren!“
„Danke, Herr von Hoesch! Ihnen och nen schönen Tach!“ Beide Schutzmänner griffen noch einmal an die Pickelhaube. „Dat ist sehr nett von ihnen!“
„Det ist ma ein juter Mann“, bemerkte Manfred, ehe er an die Tür klopfte.
„Ach, kieck ma an! Atze, Manni, kommt ma rin in die jute Stube. Der Muckefuck wartet schon uff euch, und ein paar Stullen werde icke euch wohl ooch schmieren können!“
„Dank dir Martha!“ Atze Friedmann nahm die Hand der Köchin in seine. „Und wann wird ma was aus uns zwee beede, meine Schönheit?“
„Wennste es jeschafft hat, mir een Balg zu machen, Atze, dann kannste mir heiraten. Aber mit Ring, Kirche und dit allet!“
„Dann sollten wa mal hinne machen, dat wa det Steppke mal hinkriechen.“ Er klopfte ihr auf das Gesäß.
„Erst die Stullen, Atze, damit der Manni ooch wat zu tun hat! Sei ma nich so egoistisch!“
„Na, nun macht doch schon hinne, ihr zwee“, grinste Manfred Jankowsky. „Det Atze kann doch schon jar nich mehr jerade uff die Beene stehn, so stramm sitzt ihm dit Bux schon. Ick nehm mir mal den Muckefuck und die Stullen schon selber.“
„Bist `n dufter Kumpel, Manni. Bis später!“
=◇=
Konstantinopel
„Was soll das heißen“, herrschte Sultan Abdülmecid seine obersten militärischen und zivilen Berater an. „Die große Festung auf Kreta ist gefallen? Wie konnte das geschehen?“
„Herr, das ist nicht so leicht zu erklären!“ General Ösöm Atamatür wand sich verlegen. „Aber wir haben zwei Kreter gefangen genommen. Sie sind mit einem Fischerboot bis hierher nach Stambul gesegelt, um mit den kretischen Vertretern in der Provinzkammer zu sprechen. Vielleicht können diese beiden Licht in das Verhalten ihrer Landsleute bringen!“
„Dann schlage ich vor, sie hier vor mein Antlitz zu bringen.“ Der Sultan hieb mit der flachen Hand auf seinen Schreibtisch, die Schreibfedern und Bleistifte sprangen beinahe aus ihren Ablagen. „Und wenn es nichts ausmacht, General…“ Er zog die letzte Silbe in die Länge. „…heute noch“, brüllte er dann unvermittelt los. „Jetzt! Sofort!“
„Sie warten bereits, Hoheit!“ Der General machte einige hektische Gesten, die Tür wurde geöffnet und Janitscharen führten vier gefesselte Männer in zerrissener kretischer Tracht vor, um den Hals bereits eine Seidenschnur gebunden.
„Also, warum habt ihr Hunde gegen euren rechtmäßigen Herrscher rebelliert“, brüllte Marschall Küplim die beiden Kreter an. „Er hat in seiner Weisheit und Güte beschlossen, euch ebenso zwei Plätze in der Volksvertretung zu geben, wie jedem anderen Verwaltungsbezirk!“
„Was nützen uns diese Sitze, wenn der Gouverneur die Steuern willkürlich erhebt und bewaffnete Soldaten ausschickt, um unsere Kirchen und Frauen zu schänden?“ Michalis Kakophonakis sah dem Sultan fest in die Augen. „Und wenn wir unsere Kirchen schützen wollen, so nimmt er fünfzig Geiseln und verurteilt sie zu einhundert Peitschenhieben und danach erdrosseln mit einer Schnur. Nackt, für alle sichtbar, zwischen zwei Pfähle gehängt! Es sollten zwanzig für einen toten Hauptmann sterben, und zehn für jeden Leutnant. Die Soldaten wollte er eins zu eins rechnen – all das haben wir bisher ertragen. Aber dieses Mal sollte die Hälfte der Geiseln aus Frauen bestehen, aus Frauen, die nach dem Gesetz des Sultans selbst noch nicht einmal für die Taten ihrer Männer haftbar gemacht werden können. Es gibt immer eine Grenze, über welche man niemanden treiben sollte, denn dann könnte der Sturm, der ausgesät wird, als Orkan zurückkehren!“
Der Sultan überlegte lange, dann nickte er. „Das kann ich sogar verstehen. Nicht gut heißen, aber verstehen. Warum seid ihr nicht zuerst zu mir gekommen, um mit mir darüber zu sprechen?“
„Wir haben es versucht, Pascha. Unsere Bitten und Forderungen haben wir, als wir in der Kammer kein Gehör fanden, schriftlich niedergelegt, aber dieser Müşir…“
Küplim schlug unvermittelt mit der Faust zu und traf Michalis auf den Mund. „Ihr habt keine Forderungen zu stellen, ihr Hunde. Ihr dürft bedingungslos kapitulieren, nicht mehr!“ Während Kakophonakis Blut und einen halben Zahn ausspuckte, hob Abdülmecid die Hand.
„Küplim, ich werde nachher selbst entscheiden, ob und wie ich vorgehe!“ Die Stimme des Sultans war klang leise und beherrscht, aber es lag eine deutliche Warnung, eine Drohung in ihr. Und im weglassen des Ranges, üblicherweise war der Sultan ein höflicher Mensch.
Jorgos Porgatakis ergriff das Wort, nicht minder stolz als sein Freund und Kamerad. „Wir wollen mehr Freiheit, Pascha! Wir sehen ein, dass Steuern sein müssen. Wir verstehen, dass eine Garnison und ein Flottenstützpunkt auf Kreta von Vorteil für das osmanische Reich sind. Aber wir wollen weder unseren Glauben aufgeben noch den Launen eines Oberst ausgeliefert sein! Und wir wollen nicht, dass unsere Frauen geschändet werden, weil sie für eure Matrosen Freiwild darstellen und diese Soldaten keine Strafen zu fürchten haben! Wir wollten diese Missstände immer wieder zu Gehör bringen, wurden aber…“
„Schweig, Hund!“ Marschall Küplim hob wieder die Faust, der Sultan wandte sich an den ranghöchsten Janitscharen, einen Leutnant, und wies auf Küplim.
„Mülasim! Wenn der Mir Alay Küplim, welcher sich derzeit die Schulterstücke eines Müşir anmaßt, noch einmal die Hand erhebt oder ein lautes Wort sagt, ziehen sie ohne Umschweife ihren Revolver und jagen ihm eine Kugel in den Kopf. Auf Geheiß des Sultans!“ Dann sah er den Kreter an. „Aber?“
„Man hat uns nie vorgelassen, Pascha. Die Wachen hatten strikten Befehl, niemand von den Inseln zu einer Audienz einzulassen!“
Der Sultan kniff die Augen zusammen und wandte sich an den Janitscharen. „Mülasim?“
„Das ist richtig, Pascha! Wir haben von Müşir Küplim den ausdrücklichen Befehl, nur Osmanen vorzulassen. Unter keinen Umständen sollten Inselgriechen den Palast betreten!“
„So?“ Der Sultan sah Küplim lange an. „Ich warte, Küplim, was sagen sie dazu?“
„Herr, warum solltet ihr von diesen doch nur ewig unzufriedenen Ungläubigen belästigt werden? Die Militärkommandanten hatten die Sache doch gut im Griff!“
„Das sehe ich!“ Abdülmecid verschränkte die Arme. „Und wie gut sie es im Griff haben. Man sieht es ganz deutlich an der Großen Festung auf Kreta!“
„Wir werden die Flotte aussenden und einige Armeen landen, damit treiben wir die Aufrührer wieder zurück.“ Küplim richtete sich hoch auf. „Und dieses Mal werden wir nicht genug Kreter übrig lassen, die sich auflehnen können. Und die Weiber gehen in die Sklaverei! Wo sie hingehören!“
„Ich sehe, es war ein Fehler, dich zum Mir Alay zu degradieren, Küplim!“ Der Pascha legte dem Offizier die Hände auf die Schultern, ein rascher Ruck, und er hielt die Rangabzeichen in den Händen. „Mülasim, erschießen sie diesen Verbrecher, der das osmanische Reich eines seiner schönsten Juwelen gekostet hat! Auf der Stelle!“ Der Janitscharenleutnant zögerte nicht den Bruchteil einer Sekunde. Sein Revolver knallte, und der ehemalige Marschall sank tot zusammen. „Diese Männer stehen unter Hausarrest“, befahl der Sultan danach, auf die vier Kreter weisend. „Gebt ihnen zu essen und zu trinken, lasst sie baden und verbindet ihre Wunden, mein Zahnarzt soll nach diesem Mann sehen. Und jetzt lasst mich allein. Ich möchte in aller Ruhe überlegen.“
=◇=
„Nun, Murad“, wandte sich Abdülmezid an seinen ältesten Sohn. „Was ist deine Meinung? Wenn du schon Aysun an meiner Stelle zu schwängern versuchst, kannst du auch beweisen, dass dein Kopf, auf dem der Turban sitzt, genau so stark ist wie der andere zwischen deinen Beinen!“
„Vater, ich bitte dich…“
Der Sultan hob die Hand. „Wirke ich, als wäre ich irgendwie zornig, mein Sohn? Ich bin vielleicht schon alt, aber mein Geist ist noch recht stark. Aysun ist eine junge Frau, und ich bin immerhin stolze 66 Jahre alt. Dank Allah noch bei recht guter Gesundheit, aber 45 Frauen sind mir da manchmal schon ein wenig zu viel. Nein, das ist falsch. Sie wären mir immer zu viel gewesen. Und wenn du Aysun jetzt schwängern solltest, ist das Kind ja doch von meinem Blut. Das Volk wird seinen Sultan feiern, der in diesem hohen Alter noch ein Kind zeugen kann. Also, strenge dich an, dass ich noch einen Sohn auf den Knien schaukeln kann. Und jetzt, was ist deiner Meinung nach zu tun? In Bezug auf Kreta, denn in Bezug auf Aysun werde ich weiterhin meine Augen geschlossen halten!“
„Ich kann nur hoffen, eines Tages deine Weisheit und Ruhe zu finden Vater!“ Murad schloss die Augen. „Wenn ich es richtig gehört habe, sind die Kreter durchaus bereit, weiterhin Steuern zu zahlen und Garnisonen zu dulden. Wenn sie sicher und in der gleichen Freiheit leben dürfen wie alle anderen Osmanen. Das macht den Ratschlag doch einfach. Mach es wie die Kakanier, Kreta wird ein selbstverwaltetes Sultanat mit dir als Sultan, die Kreter stellen selber Beamte, Matrosen und Soldaten für ihre Verwaltung und Verteidigung. Unsere türkischen Soldaten und Beamte werden, mit Ausnahme einiger Ausbildner, sofort abgezogen. Damit bleibt die Insel ein Teil des osmanischen Reiches, die europäischen Mächte müssen diese Lösung als Zeichen deiner fortschrittlichen Gesinnung loben und werden mit dieser Lösung einverstanden sein. Und sie werden ganz bestimmt das neu gegründete Sultanat nicht anzugreifen wagen. Aus Angst, nicht mehr als Befreier, sondern als Diebe und Aggressoren da zu stehen!“
„Wie ich sehe, wird das osmanische Reich auch nach meinem Tod einen klugen Sultan haben!“ Der alte Sultan schloss den Sohn in die Arme. „Ab dem heutigen Tag bist du mein Mitregent, mein Sohn. Ich werde es noch diese Woche bekannt geben und dann nach Kreta aufbrechen. Sobald die Beamten und Offiziere unseres Reiches auf dich eingeschworen sind!“
„Kreta ist gefährlich, Sultan. Wäre es nicht besser, ich unternehme die Fahrt“, zeigte sich Murad besorgt.
„Nein, wenn schon jemand in Gefahr gerät, dann besser der Ältere“, lehnte Abdülmezid ab. „Aber wenn mir etwas zustößt, Murad, dann musst du eine deiner eigenen Frauen schwängern. Ein Kind aus dem Grab – das hat man noch nicht einmal dem Propheten nachgesagt. Wie viel weniger würde man es von mir glauben.“
=◇=
Athen
Nordöstlich der Akropolis und der Plaka, der Altstadt Athens mit den engen, verwinkelten Gassen, lag der königliche Palast des Königreichs Griechenland gegenüber des Syntagma-Platzes. Der kleine, kahlköpfige Mann mit dem buschigen, über die Oberlippe hängenden Bart atmete noch einmal tief durch, ehe er den Palast betrat. Die Evzonen, die Palastgarden in ihren weißen Faltenröcken, den weißen Strumpfhosen mit schwarzen Bändern um das Knie, welche hinten in Fransen über die Waden hingen, den Schnabelschuhen mit den schwarzen Bommeln und der Schürze aus Seidenstreifen kannten den Premierminister Charilaos Trikoupis und präsentierten ihre langen Gewehre mit aufgepflanztem Bajonett. Diese Waffen sahen zwar äußerlich wie alte Musketen mit Steinschlössern aus, waren aber von der Schweizer Waffenmanufaktur als modernes Flechettegewehr gebaut worden. Auch die von Königin Amalie, der Ehefrau des ersten griechischen Königs Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach, entworfene und etwas seltsam, beinahe lächerlich anmutende Uniform durfte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei diesen ‚Leichtbewaffneten‘ um hervorragend ausgebildete Elitesoldaten handelte.
König Georg I von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, seit 1863 ‚Vasiléf ton Ellinon‘ oder auf Deutsch König der Griechen, war ein großer Mann, dessen Scheitel allmählich beinahe die Ohren erreichte, sein Schnurrbart war dafür umso ausladender gezwirbelt. Er kannte die Parlamentszeiten, und er kannte auch die Tagesordnung, der König erwartete also keine Überraschung bei diesem Besuch.
„Majestät!“ Der Premierminister beugte kurz das Haupt.
„Bitte nehmen sie Platz, Premier Trikoupis!“ Rituelle Worte, Woche für Woche, bei jeder Besprechung nach den Parlamentssitzungen.
„Wir waren selten einer Meinung, Majestät“, begann Charilaos Trimoupis.
„Ja, so könnte man es ausdrücken. Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie mir Tyrannei, Misswirtschaft, Korruption und allgemeinen Machtmissbrauch vorgeworfen“, bemerkte König Georg trocken.
„Ja, das habe ich“, bestätigte Charilaos. „Ich bin ein Feind ausländischer Herrscher und werde es immer bleiben! Und sie sind nun einmal ena Germanos!“
„Ich spreche griechisch, Premier, ich bin mit einer christlich-orthodoxen Frau verheiratet und erziehe meine Kinder in dieser Tradition. Meine Kinder werden echte Griechen sein.“
„Vielleicht, vielleicht auch nicht! Wir, also in diesem Fall mein Nachfolger und das griechische Volk werden es sehen und bewerten.“ Trikoupis winkte ab. „Jetzt aber geht es um Griechenland. Die Kreter haben rebelliert und Herakleion erobert.“
„Das habe ich gehört. Ich nehme an, sie erwarten jetzt von mir eine Kriegserklärung an das osmanische Reich?“
„Wäre es denn nicht an der Zeit, auch die restlichen Inseln, Makedonien und Ostthrakien wieder zurück nach Griechenland zu holen, Majestät?“
Georg I spielte mit einem Brieföffner aus Bronze in der Form eines hellenistischen Schwertes. „Sicher wäre es an der Zeit, Premierminister. Aber schaffen wir das auch? Noch ist das osmanische Reich ziemlich stark, und die Armee Griechenlands ist zwar modern ausgerüstet und besteht aus hervorragenden Soldaten, die sicher in der Verteidigung der Heimat durchaus zu siegen verstünden. Aber ist die Armee, ist die Flotte auch stark genug für einen Angriffskrieg? Auf einen starken und mächtigen Feind, ganz ohne internationale Unterstützung?“
„Majestät…“
„Nein, Premierminister, sagen sie jetzt nichts. Gestehen sie mir zu, dass ich mir die Sache dieser Tragweite noch ein wenig durch den Kopf gehen lasse. Aber was auf jeden Fall geschehen kann und muss ist folgende Sache: setzen sie sofort die Generalmobilmachung in Kraft, damit wir für alle Fälle gerüstet sind. Und schicken sie die SPARTA mit ihren Begleitschiffen in das libysche Meer. Auf Manöver. Die Flotte soll aber unbedingt derzeit noch in internationalen Gewässern bleiben!“
=◇=
Paris
Katharina von Medici hatte als Witwe von Heinrich II während ihrer Regentschaft für ihren Sohn, den französischen König Karl IX, den Palais de Tuileries in Auftrag gegeben, um die beiden Seitenflügel des Louvres miteinander zu verbinden. Während der Revolution, nämlich ab dem 5. Oktober 1789, war der König Ludwig XVI und seine Gemahlin Maria Antonia mit ihren Kindern hier untergebracht, bis zum August 1792. Napoleon I Bonaparte war, nachdem er sich selbst zum Kaiser Frankreichs gekrönt hatte, mit seiner geliebten Josephine de Beauharnais ebenfalls in diesen Palast eingezogen. Später hatte dann der Aigle Marie-Luise von Habsburg geheiratet, und diese hatte die Stelle Josephines eingenommen und dem Aigle endlich den ersehnten Nachwuchs geschenkt. Einen Sohn. Napoleons Frankreich ging in Europa im Norden bis Amsterdam, im Osten bis Nancy und im Süden von Lissabon über Rom bis Athen. Auf dem amerikanischen Kontinent war ein zweiter, von Napoleons Agenten geschürter Aufstand ausgebrochen. Der Aufstand von Neu Amsterdam, oder wie die Briten sagten, New York, gegen die britische Regierung war jedoch ebenso erfolglos wie der erste im Jahre 1770 in Boston verlaufen. Doch mit Hilfe einiger schwer gepanzerter, vom Deutschen Bund gekaufter Dampfschiffe gelang es den Franzosen immerhin, die dickbäuchige, schwerfällige britische Flotte im Atlantik zu besiegen und die canadischen Kolonien wieder zurück zu erobern.
Das Reich des Aigle, des Adler Napoleon Bonaparte zerfiel nach seinem Tod beinahe ebenso rasch wieder, wie es entstanden war. Außer Canada und den zwar riesigen, allerdings zu Hälfte aus Sand bestehenden nord- und zentralafricanischen Gebieten, welche im Laufe des 19. Jahrhunderts nach und nach erobert wurden, verblieben Frankreich nur noch einige Insel im indischen und im pazifischen Ozean. Über diese herrschte nun der vierte französische Kaiser Charles Josef Napoleon Bonaparte. Wenn die Volksversammlung es zuließ, was sie jedoch zumeist tat. Diese Versammlung war ausschließlich am europäischen Frankreich interessiert, die überseeischen Gebiete waren ihnen nicht sehr viel wert. Um einen Napoleon d’Or im Wert von 20 Franc konnte man, solange es um die Kolonien ging, jeden Beschluss von einem der Abgeordneten kaufen.
Jeder bei Hofe wusste, dass die eigentliche Macht des Hauses Napoleon derzeit in den zarten, umtriebigen Händen von Roxane Solange de Beauvoise lag, der Ehefrau des Kaisers. Während er sich mit einer Unzahl von Mätressen vergnügte, welche zumeist sogar von Roxane selbst ausgewählt waren, traf sie die Entscheidungen, welche er dann später als die seinen verkünden durfte. Die Franzosen störte das nicht sehr, sie hatten ein gewisses Verständnis für die Wünsche und Bedürfnisse des Kaisers, solange sie selber keinen Schaden davon trugen. Und Roxane Solange war eine ziemlich kluge Regentin, das Schicksal dieser österreichischen Prinzessin, die den letzten Louis geheiratet hatte, stand ihr jederzeit deutlich vor Augen. Auch wenn der technische Fortschritt in Frankreich bisher nur auf militärischem Gebiet Einzug hielt und das Volk allmählich zu murren und nach den neuen Techniken zu rufen begann. Noch leise, aber bereits deutlich hörbar. Doch Roxane hatte ihre Lektionen aus der Historie gelernt. Unter den Devisen ‚Brot und Spiele‘ sowie Divide et impera hatten schon die Konsuln Rom und den Mittelmeerraum beherrscht, nun setzte Roxane Solange de Beauvoise die selben Mechanismen ein. Bisher noch mit beachtichem Erfolg. Die Steuern im europäischen Teil Frankreichs waren halbwegs bescheiden, es gab, wenn auch nicht reichlich, so doch ausreichend zum Überleben Nahrung und bescheidenen Wohnraum. Ab und zu veranstaltete die Kaiserin ein kleines Spektakel. Eine Militärparade etwa, einen Feiertag mit Feuerwerk für die Pariser, sie unterstützte einige Revuetheater mit leicht geschürzten Mädchen. Und ab und zu wurde auch schon einmal auf dem Place de la Concord vor dem Palais de Tuileries ein Fallbeil für eine öffentliche Enthauptung aufgestellt.
Um einiges weniger zufrieden hätten Franzosen allerdings aufgenommen, von wem Madame des Beauvoise ihre Entscheidungen neuerdings bezog. Madelaine de Carteille war zwar bereits beinahe fünfzig, doch immer noch eine aufregend schöne Frau. Selbst jüngere Männer und auch nicht wenige Frauen, welche ihre Sitzungen besuchten, verfielen dem Charme und dem blendenden Aussehen dieser Frau. Auch dafür hätten viele Pariser noch halbwegs Verständnis aufgebracht, aber damit wäre es vorbei gewesen, hätten sie erfahren, dass Madelaines richtiger Name Khadija Lahsaini war und sie nicht aus Bayonne, sondern aus Alexandria stammte. Es wäre ein riesiger Eklat gewesen, wenn eine arabische Frau indirekt Teile Frankreichs regierte.
Roxane stieß die Tür zum Arbeitszimmer ihres Gatten auf und unterbrach sein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Volksversammlung.
„Gibt es eine Nachricht von François Louis?“ Sie war in diesem Moment allerdings nicht die kluge Staatsfrau, sondern nur noch eine Mutter.
„Madame, die AIGLE hat erst vor zwei Wochen Khartoum verlassen. Wenn sie den Nil wirklich halbwegs sorgfältig absuchen wollen, können sie weder sehr hoch noch sehr schnell fliegen, und südlich Khartoums sind Telegraphenstationen mehr als selten. Bitte haben sie noch etwas Geduld, Madame, ich bin sicher, ihr Sohn ist wohlauf! Auch der Commandant de Milfort, sein Adjutant, hat das bei seinem letzten Telegramm bestätigt. Der Prinz hat eine neue Liebschaft mit an Bord, eine Atrá Troudeaut! Vielleicht hat er es deshalb nicht ganz so eilig, seine zukünftige Braut und Mutter seiner Kinder zu finden!“
„Nun – dann bitte ich um Entschuldigung, dass ich gestört habe!“ Roxane ging wieder zur Tür.
„Madame haben überhaupt nicht gestört. Wir waren ohnehin bereits fertig. Sire!?“
Charles winkte bestätigend. „Er ist entlassen, und wir wollen jetzt nicht gestört werden.“ Nachdem die Tür ins Schloss gefallen war, sprang der Kaiser überraschend flink auf die Beine und öffnete eine Tapetentür. „Colette! Komm doch zu mir, mein kleines Mäusezähnchen!“
„Wieder eine Neue?“ Der Marquis de Lumrocheux nickte mit dem Kopf in Richtung des Zimmers, welches sie eben verlassen hatten.
Roxane Solange nickte. „Colette! Sie ist jung, naiv und teilt einige der Vorlieben meines Mannes. Ich stehe dem nicht im Wege.“
„Frankreich kann sich glücklich schätzen, dass die Macht in ebenso zarten wie fähigen Händen liegt!“ Der Marquis sah starr nach vorne.
„Sie Schmeichler! Und jetzt kommen sie in meinen Salon und berichten sie mir! Gibt es tatsächlich keine Nachricht von der AIGLE?“
„Madame, ich hätte es euch sofort mitgeteilt, auf der Stelle. Und das zentrale Nachrichtenbureau hat den Befehl, sofort euch zu benachrichtigen. Sogar noch ehe mich die Botschaft erreicht. Aber ich glaube wirklich, dass noch kein Grund zur Unruhe besteht. Ehrlich. Sicherheitshalber werde ich aber die JEANNE D’ARC in Marsch setzen lassen, um die AIGLE zu suchen. Ein entsprechendes Ansuchen für den Überflug ist bereits an die britische Regierung ergangen, die Überflugerlaubnis wurde bereits erteilt.“ Der Marquis verfiel in den typischen Tonfall des britischen Gesandten in Paris. „Premiereminister Robert Gascoyne-Cecil, third Marquess of Salisbury teilt zwar die Besorgnis der französischen Regierung bezüglich des Kronprinzen nicht, sieht aber die Sorgen einer Mutter als verständlich an und erlaubt der französischen Luftmarine daher die Entsendung des Luftschiffkreuzers JEAN D’ARC für eine Suche über dem Nil.“
„Mir ist völlig egal, was der Mann denkt“, beschied Roxane Solange. „Hauptsache, die JEANNE kann starten!“
„Morgen in aller Frühe, Madame, wird sich unser Luftschiff auf den Weg machen.“
„Gut Marquis, das freut mich zu hören. Ein Glas Champagner?“ Ein leiser Knall war zu hören, als Roxane Solange gekonnt eine bereitstehende gekühlte Flasche öffnete.
„Madame le Imperatrice sind zu gütig!“
Diese verschloss die Zimmertür, goss zwei hohe Kelche mit Champagner voll und reichte einen davon dem Politiker. „Und denken sie, eine Expedition nach Abessinien könnte sich lohnen?“ Nun wurde Roxane wieder die kühl kalkulierende Kaiserin. „Diese Waffe, mit der die Italiener zurück geworfen wurden, wäre für Frankreich doch ebenfalls sehr nützlich.“
„Wir stellen eben einige Leute zusammen, Madame. Die JEANNE D’ARC wird sie bei Kairo absetzen, von dort aus werden sie ein Luftschiff nach Josefshafen nehmen!“
„Gut so, Marquis. Ich sehe, wir verstehen einander.“
Lumrocheux ergriff die Hand der Kaiserin und küsste sie. „Wie immer, Gnädigste. Frankreich muss wieder zur Grande Nation werden!“
„Ich gestehe, dieser Gedanke, über halb Europa oder mehr herrschen zu können, hat für mich etwas durchaus Erregendes“, bekannte Roxane, wandte sich um und sah in einen Spiegel hinter einem Kartentisch mit einer Karte Europas. Sie sah, wie sich der Marquis näherte, fühlte seine Hände in ihren Ausschnitt fahren und ihre festen Brüste freilegen, spürte seine Lippen ihren Nacken berühren.

„Auch dies ist etwas, das wir durchaus miteinander teilen, Madame le Imperatrice“, bekundete der Regierungschef. Roxane Solange schloss ihre Augen und überließ sich ganz dem Spiel der erfahrenen Hände und Lippen des Marquis. Dann beugte sie sich über den Kartentisch, öffnete ihre Augen wieder und ihr Blick suchte Wien. Ihre Hand krallte sich in die Karte, als Lumrocheux ihre Röcke hob.
„Das erste Ziel, Marquis. Das erste Ziel“, stöhnte sie.
=◇=
Die JEANNE D’ARC war ein moderner Luftkreuzer ‚leichter als Luft‘. Die beiden Kasemattendecks mit je sechs 10,5 Zentimeter-Geschützen lagen beidseits des tragenden Rumpfes, bei dem drei Schalen ineinander gebaut waren, dünne, nach innen bewegliche Lamellen im Inneren der Gastanks dichteten durch den bestehenden Überdruck jedes Leck nach einem Treffer zumindest halbwegs ab. Auch waren die einzelnen Auftriebsballons so klein wie möglich gehalten, damit das Schiff auch bei mehreren Treffern noch immer schweben konnte. Oben waren in so genannten Barbetten zwei mal zwei 10,5 Schnellfeuerkanonen eingebaut, den Kiel schützten 4 Kanonentürme in einer speziellen Aufhängung. Die zwei Mal drei Propeller waren durch verstellbare Blätter von Druckschrauben im Vorwärtsflug zu Zugschrauben in der Retourbewegung umstellbar und konnten um 90 Grad geschwenkt werden, um überall landen zu können. Eines dieser Schiffe war, was die Größe seiner Kanonen und die Geschwindigkeit anging, nicht eben die kampfstärkste und schnellste Konstruktion am Himmel Europas. Aber sie war doch auf dem besten Wege, die am häufigsten Vertretene zu werden. Und eine Flotter solcher Kreuzer war sicher kein zu unterschätzender Gegner.
Verständlicherweise war Platz an Bord eines solchen Luftkreuzers Mangelware, einzig der Kapitän nannte eine eigene Kabine sein eigen. Die vier Offiziere mussten sich jeweils zu zweit ein Quartier teilen, ebenso wie die Ingenieure. Der Rest der Besatzung besaß enge Kojen entlang der Laufgänge in der Nähe ihrer Gefechtsstände, Platz für Munition, Lebensmittel und Wasser hatte nun einmal Vorrang vor dem für Personal. Capitaine Guillaume du Froid hatte persönlich das Ablegemanöver geleitet, und die JEANNE D’ARC von Paris zuerst südlich nach Montpellier steuern lassen und von dort den Kurs nach Südost nach Tunis und weiter nach Kairo befohlen. Meile um Meile trieben die starken Papin-Motore den Kreuzer über das Mittelmeer.
„Sehen wir zu, dass wir unsere Agenten unauffällig in der Nähe der Bahnlinie von Alexandria nach Kairo absetzen können. Weder die Rosbifs noch die Boches müssen etwas davon erfahren, dass wir Agenten nach Abessinien senden.“
„Ich denke, sowohl die Briten als auch die Kakanier können sich denken, dass Frankreich Agenten entsendet“, bemerkte Lieutenant Jean Goffei. „Dumm sind sie ja auch nicht.“
„Natürlich rechnen sie damit, Lieutenant. Aber wir müssen diesen arroganten, nationalistischen, britischen Chauvinisten doch nicht unbedingt auf die Nase binden, wer es ist!“
Es waren vier Männer, Lieutenant Leon Gaspares, Sous Lieutenant Charles Deville, Sergent Andreas Saint Germaine und Caporale Louis Hugo. Erfahrene Männer der Fluginfanterie, welche solche Einsätze in den Wüsten von französisch Nordafrica bereits oft und oft geübt hatten. Sie waren mit älteren Repetiergewehren ausgestattet, welche durch ihre einfache Konstruktion auch unter widrigsten Bedingungen noch funktionierten, ebenso unauffälligen Revolvern der FCP, der Fabrice Cartouche de Paris, in der zivilen 8,6 Millimeter Variante. Ihre Kleidung bestand aus der in Africa nicht untypischen Bekleidung, mir leichten Hosen, Westen und Burnussen, Großwildjäger, die sich den Bedingungen Africaas anpassen wollten eben. In Kairo wollten sie ihre Kleidung wechseln, als Weltreisende im Safarianzug das Luftschiff nach Port Helene besteigen, um dort wieder in anderer Tracht unterzutauchen.
=◇=
Kairo
„Ob uns die Froschschenkelfresser tatsächlich für so dumm halten?“ Der britische Generalkonsul in Kairo, Sir Evelyn Baring, 1st Earl of Crommer atmete das Aroma seines Brandys tief ein. „Ein köstlicher Tropfen!“
„In der Tat, Sir Evelyn.“ Auch Kitchener schnupperte an seinem Weinbrand. „Und ich fürchte, die Franzosen halten uns für so dumm. Sie sind allesamt arrogante, hochnäsige Chauvinisten!“
„Sie sind also überzeugt, dass die JEANNE D’ARC Agenten absetzen wird“ vergewisserte sich Sir Evelyn.
„Sie können gar nicht anders, Sir.“ Kitchener stellte sein Glas ab und trat an das Fenster, unter dem britische Unteroffiziere mit ägyptischen Truppen exerzierten. „Die Leute werden bald soweit sein, damit wir den Sudan von den Mahdisten zurück erobern können. Aber zurück zu unseren französischen Freunden! Sie wollen diese Waffe sicher genau so heftig wie wir, der schnellste Weg von Paris nach Abessinien geht nun einmal über Kairo, selbst der Seeweg nach Eritrea dauert sehr viel länger. Und sie müssten auch da durch ägyptisches Gebiet. Nein, ich denke, sie werden hier auftauchen und als Jagdgenossenschaft getarnt ein Fortbewegungsmittel zu beschaffen versuchen, um nach Gonder zu kommen. Vielleicht auch mit einem Luftschiff nach Khartoum und den blauen Nil hinauf, aber das halte ich für sehr riskant, nicht nur wegen der Mahdisten!“
„Und wenn sie nach Port Helene fliegen, Kitchener?“
„Dann macht das auch nichts, Sir Evelyn. Unsere Expedition hat einen guten Vorsprung. Der gute Captain McIvor ist einen Tag nach der italienischen Landung aufgebrochen. Schneller kann es gar nicht gehen. Was mich aber wundert, dass nach dem Vorfall keines von den in Port Helene oder Josefshafen stationierten Panzerfahrzeuge aufgebrochen ist! Ich meine, die Kakanier müssten doch auch ganz massives Interesse an einem derart machtvollen Gerät haben! Was wissen die, das wir nicht wissen, Sir Evelyn?“
„Sie meinen, diese Österreicher könnten bereits im Besitz des Geheimnisses sein? Kitchener, dann könnten sie unsere Flotte praktisch neutralisieren! Mit ihren verdammten Flugschiffen, die schneller und weiter fliegen als alles, was wir in die Luft bekommen und noch dazu stärker bewaffnet und gepanzert sind!“
„So weit möchte ich nicht gehen, Sir. Aber was ist, wenn sie andere Mittel und Wege haben, den Weg dieser Trommel zu verfolgen?“
„Liebe Güte, Kitchener! Sie werden doch nicht an Kristallkugeln glauben. Und für Vampire dürfte es in Abessinien eindeutig zu viel Sonne geben.“ Der Generalkonsul wieherte über seinen schlechten Witz, und der Sirdar quälte sich ein Lächeln ab. „Nun, Kitchener, sie werden sicher noch dahinter kommen. Halten sie mich bitte auf dem Laufenden!“
„Selbstverständlich, Sir. Ich werde sofort wieder an die Arbeit gehen. Wenn sie mich bitte entschuldigen wollen, Sir Evelyn?“
„Selbstverständlich, Kitchener!“
—●○⊙○●—
Josephshafen
Die große Freihandelszone bei Josephshafen in Eritrea war nicht nur Umschlagplatz für Waren aller Art, sondern auch Umstiegspunkt vieler Reisender auf Schiffe nach Mombassa oder Daressalam, von wo es in das Innere des africanischen Kontinents ging. Manche heuerten gleich hier Leibwächter und Guides für die Reise an, die Vermittler in Assab hatten durchaus einen vertrauenswürdigen, guten Ruf. Die meisten Länder nützten auch den gesetzlichen Ausnahmestatus der Zone für die Informationsbeschaffung und den -Austausch. Einfacher ausgedrückt, die Freihandelszone Assabs war DIE Drehscheibe internationaler Spionage in Africa.
Zwischen der alten Stadt Assab, welche auf dem von den Österreichern gekauften Gebiet lag, und der von der ÖDLAG angelegten Hafenstadt Josephshafen mündete ein kleines Flüsschen, welches von einigen winzigen Quellen am Fuße eines 300 Meter hohen vulkanischen Hügels gespeist wurden und zumindest den Trinkwasserbedarf des Hafens decken konnte. Assab bezog sein Wasser außerdem aus zwei halbmondförmigen Hügel, wo es einige unterirdische Kavernen gab, von denen einige Bewohner früher ihr Frischwasser mit Eimern holen mussten. Die ÖDLAG hatte bald eine zentrales Wasserversorgungsanlage gebaut, welche jeder Person ein berechnetes Quantum Wasser zukommen ließ. Gleichgültig, ob weißer Millionär oder schwarzer Handwerker, jeder bekam den gleichen Anteil an diesem lebensnotwendigen Element. Es war nicht so, dass die ÖDLAG überaus sozial eingestellt war, aber sie benötigte die Handwerker noch mehr als die reichen Europäer, welche den Hafen zumeist sowieso bald wieder verließen. Auch wurden tiefe Bohrungen in Assab vorgenommen, um einige geschützte Zisternen anzulegen, in welchen das Wasser kühl gehalten wurde. In diese wurde das entsalzte Meerwasser geleitet, welches an den flachen Küstenstellen durch aufgefangenen Dunst gewonnen wurde, das Wasser des Flusses, welcher etwas weiter südlich in das rote Meer geflossen war und natürlich das Regenwasser, welches spärlich, aber doch immer wieder in den Sommermonaten fiel.
Der von der ÖDLAG gekaufte Küstenstreifen war zwei englische Meilen breit, während die bereits in metrischen Maßeinheiten rechnenden Österreicher drei Kilometer für sich abgesteckt hatten. Die Differenz von 218,6 Metern zwischen den Messungen ergab ein Niemandsland, für das sich weder Österreicher noch Briten verantwortlich fühlen wollten. So war hier ein etwa 50 Kilometer oder 31 Meilen langer Streifen Landes entstanden, in welchem nun ganz eigene Gesetze galten. Nämlich jene der Söldner, welche hier einige Zeltlager errichtet hatten. In der Freihandelszone gab es Büros, in welchen man ganze Einheiten komplett mit Offizieren und Unteroffizieren anheuern konnte, wie etwa Colonel Albert Faukners ‚Wild Ducks‘. Oder man begab sich einige Schritte von der Grenzstation entfernt zu einem Tisch, wo ein alter, invalider ehemaliger Söldner saß und bei der Zusammenstellung einer individuellen Einheit half. Er wusste immer, wer verfügbar war. Ein lautloser Killer mit einem Bogen? Ein Sprengstoffspezialist? Ein Mann mit Wüstenerfahrung oder für den Urwald? Feldwebel Ralph Körner stellte das richtige Team zusammen. Nicht ganz selbstlos natürlich.
Siegfried Krause war ein gebürtiger Sachse und arbeitete für die Kolonialimport Lange und Söhne als dem in Josephshafen vor Ort lebenden Juniorchef direkt unterstellter Assistent. Tag für Tag sah man ihn tagsüber am Hafen und nachts in den Kneipen und Bordellen. Man kannte und achtete ihn, er war ein fleißiger Arbeiter für seinen Chef, der eben auch gerne Gesellschaft hatte. Wer konnte es ihm schon verdenken, wenn er ein wenig Spaß haben wollte? Er war ein junger Mann, Mitte Zwanzig etwa, da hatte man Bedürfnisse, man musste sich in dem Alter schon mal die Hörner abstoßen. Manchmal ging er auch hinaus zu dem alten Feldwebel am Rekrutierungstisch, oder setzte sich zu einigen der wartenden Männer. Dort hörte er sich ihre Geschichten an, machte sich eifrig Notizen und fragte den Söldnern Löcher in den Bauch. Wie lebten sie, wie bestimmte wer ihre Offiziere, wo kam ihre Ausbildung, wo ihre Ausrüstung her. Wer kam für die Uniformen auf, wie weit würde ein Söldner gehen? Wie sah es in Abessinien, wie im AOI und wie in den britischen und deutschen Kolonien aus.
„Ich möchte ein Buch schreiben“, erklärte er. „Einen Abenteuerroman, der in Ostafrica spielt. Da muss ich doch einiges wissen! Keine großen Geheimnisse, die ihr nicht verraten könnt und dürft, natürlich. Aber Hintergründe. Gibt es die Diamanten des König Salomon wirklich? Könnte man in dieser Jahreszeit durch Kenia marschieren? Wie funktioniert eigentlich so ein Absetzen von einem Luftschiff, oder habt ihr so etwas noch nie gemacht? Wie stellt man eigentlich fest, ob man schon in Deutschland oder noch in Britannien ist? So mitten im Urwald muss das doch sehr schwer sein.“ Siegfried war auch dort gut bekannt, die Wachposten an den Toren der Stadt winkten ihn einfach weiter, wenn sie ihn sahen. Wenn sich ein neues Gesicht unter die Söldner mischte, bürgten die Alteingesessenen für den jungen Schreiberling, er war harmlos. So harmlos, dass das Geheime preußische Amt in Berlin sein Gehalt zahlte, wovon außer Adolf Lange in Berlin niemand etwas wusste. Selbst Adolf Junior, der Vertreter der Firma in Eritrea und ältester Sohn des Firmeninhabers nicht.
Im April 1889 sah daher der Juniorchef der Kolinialimport ziemlich erstaunt auf eine Plankette, welche den schwarzen, rot bewehrten Adler Preußens zeigte. Zugleich mit dieser legte Siegfried Krause ein Telegramm des Vaters Adolf Lange Junior vor, welches die sofortige Freistellung des Angestellten Krause von jeder Arbeit befahl und die Bereitstellung von drei der dampfbetriebenen geländegängigen Lastkraftwagen mit Fahrer forderte, welche rasch mit zwei Reihen Bänken ausgestattet wurden. Damit fuhr Siegfried Krause ins Hinterland, keine Seltenheit für die Fahrzeuge eines ein Handels- und Transportunternehmens. Dann kehrte er zu Fuß in die Söldnerstadt zurück und heuerte fünfundzwanzig bereits vorher ausgewählte Söldner an, Uniformen und Ausrüstung warteten bereits bei den Dampfwagen.
„Auf geht’s, Leute, die erste Etappe ist das Hochland über dem italienischen Gefangenenlager!“
„Ei, suche mer etwa diese Riesentrommel?“ Der zum Leutnant ernannte Alfred Dengler nickte. „Wolle mer se uns für den Kaiser hole, das ist ja direkt ei patriotische Tat. Fahre mer los, euer Gnaden!“
=◇=
Abessinien
Als die Wände der Schluchten endlich zurück wichen und die grüne, breite Hochebene mit dem riesigen See sichtbar wurde, fächerte die Kolonne aus und die drei Husaren blieben neben einander hinter dem Windhund stehen. Die österreichischen Dragoner stiegen aus den Fahrzeugen und sicherten die Umgebung, ehe die Erzherzogin mit ihren Begleitern die dampfelektrisch betriebenen Radpanzer verließen, um sich ein wenig die Beine zu vertreten. Die im Westen nicht mehr sehr hoch stehende Sonne spiegelte sich in dem ruhigen Wasser des Sees und zeichnete eine flimmernde Straße auf dem Wasserspiegel. Ringsum hörte man nur das Säuseln des leichten Windes und die Stimmen der Reisegesellschaft, ansonst herrschte hier Ruhe. Sie waren von Lalibela zuerst südwestlich gefahren, da sie von den Einheimischen erfahren hatten, dass auf dem direkten Weg zur Stadt Gonder eine tiefe Schlucht lag und ein kleiner Umweg angezeigt war. Die Nacht hatte Maria Sophia mit ihrer Entourage und der Eskorte im Han des kleinen Ortes Debre Tabor verbracht und am Morgen ihren Weg fortgesetzt. Nun waren sie nach einer ereignislosen Fahrt in der Nähe von Taygur angekommen und überblickten eine immer breiter werdende Ebene.
„Nach der Karte ist das der Tana-See“, bemerkte Carl Friedrich Maerz und wies auf einen entsprechenden Eintrag auf der Landkarte, welche er mit kleineren Steinen beschwert auf einem flachen Felsen ausgebreitet hatte. „Etwa 30 Kilometer nach Nordwesten ist der Pass, über den wir müssen!“ Er richtete den Kompass aus und wies mit der Hand in die angegebene Richtung.
„Melde gehorsamst, das ja! Aber es ist sich vielleicht besser zu fahren zuerst an See und machen voll wieder alle Tanks mit Wasser! Bitte um Entschuldigung, kaiserliche Hoheit“, rapportierte Wachtmeister Janosch Pospischil.
„Nun, das ist ein Umweg von vielleicht zwei oder drei Stund‘n, wir hab’n heut‘ den fünfzehnten und sollt’n erst am achtzehnten April in Gonder sein. Also, ja, fahr’n wir in Gottes Nam’n halt runter ans Wasser und tank’n nach“, entschied Maria Sofia.
„Sehr gute Idee! Man sollte bei jeder Möglichkeit für genügend Vorräte sorgen“, bemerkte Maerz.
„Was in der Llano Estecado richtig ist, kann hier ja nicht falsch sein! Man sollt‘ wirklich immer ein paar Reserv‘n hab’n“ Maria hatte den Feldstecher vor die Augen genommen und betrachtete den Weg. „Fahr’n wir. In einer Stund‘ etwa können wir an Strand sein!“
Wirklich trafen die Wagen kaum eine Stunde später am Ufer des Sees ein. Die Besatzungsmitglieder begannen sofort mit der Befüllung der Tankanlagen, während die abgesessenen Dragoner wieder einen Schutzkordon um die Fahrzeuge bildeten.
„Wir sind hier schon in der Provinz Gonder“, bemerkte Maerz, der wieder die Karte studierte.
„Irgend was stimmt da nicht!“ Elisabeth von Oberwinden sah sich aufmerksam um und nahm auch das Fernglas zu Hilfe.
„Stimmt. Es ist zu ruhig!“ Auch der Oberst Wilhelm Graf von Inzersmarkt war misstrauisch geworden und beäugte wachsam die Umgebung.
„Dort drüb’n ist ein Dorf, aber keiner rührt sich und kommt nachschau’n. In der Lalibela-Provinz sind die Leut‘ immer gleich ang’rennt, wenn wir in die Nähe von denen ihre Ortschaft’n kommen sind. Und da? Alles still“, überlegte Elisabeth laut.
Maria Sophia traf eine Entscheidung. „Dann geh’n halt wir einmal nachschau’n!“
„Bitte einen kleinen Moment Geduld, Hoheit“, bremste der Oberst. „Vizeleutnant Smetana, nehm‘ er fünf Mann als Bedeckung und komm‘ er mit! Kampfbereitschaft ist herzustellen!“
Der fast zwei Meter große und bullig gebaute Unteroffizier salutierte! „Zu Befehl, Herr Oberst!“ Dann begann er fünf Namen zu rufen, die Träger derselben lösten sich aus dem allgemeinen Kordon und nahmen um die Gesellschaft Aufstellung.
„So, Hoheit, jetzt können wir geh’n“, bemerkte Inzersmarkt. Die Erzherzogin nickte nur, hier war Vorsicht wohl wirklich der bessere Teil der Tapferkeit.
„Danke, Oberst. Sie hab’n ja Recht. Meine Damen und Herren, ohne Schritt marsch!“
Mit schussbereiten Waffen näherte dich die Gruppe dem Ort am Ufer. Es war ein typisches abessinisches Dorf, die zumeist runden Häuser mit Ziegeln gebaut, welche aus Lehm und Stroh bestanden, die spitzen Dächer mit Schilf oder ebenfalls Stroh gedeckt. Gespenstische Stille ruhte über dem Dorf. Es war kein Wort, kein Geräusch außer dem sanften Wind zu hören, keine Bewegung zu sehen. Sie bewegten sich durch eine wahre Geisterstadt.
„Meldung!“ Einer der Soldaten in der sandfarbenen Africauniform der kaiserlich-königlichen Armee hatte die Hand erhoben. „Eine Tote! Vermutlich erschossen!“
„Erschoss’n? Eine Frau? Und einfach liegen g’lassen?“ Der Oberst hob indigniert eine Braue, während Maria Sophia zu dem Soldaten eilte.
„Das kommt in den besten Städten vor, Oberst!“ bemerkte Lisi von Oberwalden. „Erinnern sie sich an den Fall Karačev? Da hat ein Kammerdiener die Gschpusi von seinem Herrn liquidiert. Eine nach der ander’n.“
„Ja, aber das ist ja – nein, ist gar nichts ander’s“ gab der Oberst zu.
„Sie haben recht, Korporal, bei dem Loch im Hinterkopf kann man von einer Schussverletzung als Todesursach‘ ausgeh’n“, bestätigte Maria Sophia, die sich über die Leiche gebeugt hatte. „Eine Africanerin, vielleicht dreißig Jahre alt. Was ist denn da passiert?“
„Sieht aus wie ein aufgesetzter Schuss!“ Maerz war neben der Leiche in die Knie gegangen und betrachtete die Wunde genauer. „Verbrennungen rings um die Eintrittswunde und eine ringförmige Verbrennung. Ein schweres Kaliber, ein englisches .44 oder .45er, aber relativ wenig Durchschlagskraft, es gibt keine Austrittswunde. Ein ziemlich alter Revolver, wahrscheinlich.“ Langsam gingen sie weiter, dabei stets wachsam bleibend.
„Scharly, schau‘ einmal!“ Maria Sophia hatte während des Gehens den Boden betrachtet und war an einer Stelle in die Hocke gesunken, ihre Finger zeichneten etwas auf dem Boden nach, dann ging sie noch ein Stück weiter und wiederholte die Handlung. Und noch einige Male in einer Linie. „Zwanzig Reiter, die ungefähr fünfunddreißig, vierzig Leut‘ zu Fuß wegtrieb’n haben.“
„Da liegt noch ein Toter“, rief der Oberst Inzersmarkt. „Aber für den braucht‘ man einen wirklich stark‘n Mag’n. Dem muss man den Lauf vom Revolver zwischen die Zähn‘ zwungen hab’n, bevor man abdrückt hat! Der halbe Kopf fehlt ja dem armen Kerl.“
„Meldung! Hier liegt noch jemand! Diesen bedauernswerten Mann muss man vorher auch noch kräftig verprügelt haben!“
Dann, der Warnschrei eines der Soldaten! „BEWEGUNG!“ Die Soldaten rissen ihre Waffen wieder in Anschlag, gingen in die Knie, um kleinere Ziele zu bieten, Vizeleutnant Smetana sprang ebenso wie Oberst von Inzersmarkt zur Prinzessin.
Die nächsten Worte brachten wieder eine kleine Entspannung. „Meldung! Ein Kind, versteckt hinter einem Holzstoß!“
„Acht Europäe und dreizehn Arabe“, dolmetschte Henrietta Jones aus dem Amharischen die Worte des total verängstigten Mädchens. „Sie wollte wisse, wo die große Trommel is, welche die Soldate aus dem Meer getötet hat. Nachdem niemand etwas wusste, habe sie zuerst zwei Leute, eine Frau und einen Mann erschosse und einen dritte brutal geprügelt, ehe sie ihn ermordeten. Dann habe sie alle zusamme getriebe und geschrien, dass sie in Gondar schon das Geheimnis erfahre würde!“
„Einundzwanzig Reiter, Mary, nicht zwanzig!“ Maerz nickte. „Aber sonst – nicht schlecht aus den alten Spuren auf dem steinigen Untergrund heraus gelesen.“
„Gonder! Ich glaub‘, wir sollt‘n einmal richtig Dampf aufmachen und uns die Verbrecher vorknöpf’n“, entschied Maria Sofia. „Geh‘n wir z’rück zu den Wagen. Und das Kind nehmen wir einmal mit nach Gonder!“
„Ich schlagert vor, wir bleib‘n bis beinah‘ Weynha am Seeufer, Hoheit. Es ist nur ein g‘ringer Umweg, aber in der Ebene können wir die G’schwindigkeit von die Husaren voll ausnützen. Die paar Hügerln sind doch schnell umfahr’n.“
„Die Überlegung hat `was für sich, Oberst!“ Maria Sophia blieb kurz stehen und spähte nach Norden. „Außerdem ist das eine wahrscheinliche Marschroute für die Verbrecher, hoffentlich hol’n wir’s g‘schwind ein. Solche G’fraster dürf’n einfach nicht ung’straft davon kommen! Signal zum Aufsitzen!“
Mit beinahe achzig Stundenkilometer jagten die Husaren hinter dem Windhund her nach Norden, das ebene Gelände am Seeufer nutzend. Die Fahrzeugführer kannten den vorgegebenen Weg und hatten eine recht gute Karte in der Steuerkanzel, die Sichtluken waren derzeit weit geöffnet. Der Kommandant stand im Luk des Windhundes hinter dem üsMG und hatte den Feldstecher vor den Augen. Ständig suchte er damit die vor den Fahrzeugen liegende Gegend ab. Unermüdlich mahlten die hohen Räder über das felsige Ufer des über 2.000 Quadratmeter großen Hochlandsees, Kilometer um Kilometer legten die vier vaporelektrischen Radpanzer zurück. Noch war keine halbe Stunde vergangen, als hinter einem Hügel eine Ortschaft sichtbar wurde, ein winziges Fischerdorf mit sechs Häusern am Ufer. Ein Mann in einem Kleidungsstück, das wie ein indischer Sarong aussah, über dem er eine ärmellose Weste auf dem Oberkörper und ein schirmloses Käppchen auf dem Kopf trug, winkte ihnen von Bord seines kleinen Bootes freundlich zu. Er hatte eben ablegen wollen, sprang aber wieder an Land und rief etwas, das die Menschen in den Kettenfahrzeugen natürlich nicht verstehen konnten.
„Signal an alle Fahrzeuge, äußerte Wachsamkeit. Geschütze und Maxim-Gewehre bemannen! Sechs Mann Eskorte zum Husar zwo!“ Der Oberst begann jene Befehle zu geben und über die Lichtsignalanlage übermitteln zu lassen, die ohnehin bereits besprochen waren und welche sogar im Handbuch der Dragoner im Falle der Anwesenheit eines Mitglieds der allerhöchsten Familie standen. Schon seit Dampffahrzeuge die Rösser abgelöst hatten. Aber – das Militär wäre eben nicht mehr das Militär, wenn man alles Unnötige streichen würde, und so warf der Oberst eben wieder mit seinen Befehlen um sich. „Also, Orville, können’s mit einem Maxim umgeh’n? Dann besetzen’s Nummero Drei. Waffen durchladen und sichern. Hoheit, wir sind bereit!“
„Dann machen’s doch endlich das blöde Tür’l auf! Entschuldigung, öffnen sie bitte das Luk, Oberst. Meine Eskorte steht eh schon drauß‘n bereit und sichert das Gelände!“
„Wollen Hoheit nicht lieber doch…“
„Hoheit steigen jetzt aus, Oberst. Kommen’s mit? Und was ist mit euch, Lisi, Scharly?“
„Wie könnte ich dieser ungemein herzlichen Einladung widerstehen“, bemerkte Maerz trocken und erhob sich, Elisabeth von Oberwinden konnte sich ein
„Trau‘ dich doch und geh‘ ohne mich! Die nächst’n Tag wirst nicht sitzen können!“ nicht verkneifen. Der Oberst verdrehte die Augen nach oben, diese Prinzessin mit ihrem Hang, immer selbst mitten in die Gefahren zu springen. Aber Befehlen oder Verbieten konnte er ihr halt auch nichts. Nicht wirklich. Nur sich Sorgen machen und für größtmögliche Sicherheit sorgen, was eben in manchen Situationen nicht sehr viel war. Trotz seiner Sorgen öffnete der Oberst die Heckklappe und Maria Sophia sprang aus dem Fahrzeug, gefolgt von der Baronesse, dem sich immer noch besorgt umsehenden Inzersmarkt und dem deutschen Autoren. Die Soldaten unter Vizeleutnant Smetana umringten die kleine Gruppe sofort, ihre halbautomatischen Karabiner waren schussbereit und wiesen nach allen Richtungen. In der Zwischenzeit hatten sich die Dorfbewohner auf dem Platz zwischen den runden, strohbedeckten Hütten eingefunden, und ein alter Mann mit weißem Bart und Haupthaar, an den Schläfen die orthodoxen jüdischen Locken, kam ihnen langsam und würdevoll entgegen. Er war in einen weißen Kaftan mit zwei blauen Streifen von der Schulter bis zum Saum gehüllt, auf dem Kopf trug er ein weißes Scheitelkäppchen, wie es Juden und Moslems ebenso wie christliche Kleriker zu tragen pflegten.
„Selami!“ Er hob segnend die Hände. „Igizi’ābihēri yit’ebik’ihi!“
„Das hab‘ ich jetzt wieder erkannt! So haben’s uns in Lalibela auch begrüßt! Ich glaub‘, das heißt etwas mit Frieden, Gott und beschützen!“ Dann, die wenigen Brocken Amharisch zusammen suchend und mit Gesten unterstützend. „Danke, Friede mit dir.“
Derweil hatte einer der Dragoner kurz hinter alle Hütten geblickt und auch einige kurze Blicke in die Hütten geworfen. „Keine Pferd‘, Hoheit, nur drei kleine Esel“, meldete er. „Es dürft‘ diese Raubkarawane hier nicht durchkommen sein.“
„Danke, Korporal!“ Dann winkte sie zu den Husaren. „Henny, komm‘ her, wir brauch’n einen Dolmetsch‘!“
Langsam kam Henrietta Jones auf die Gruppe zu, die Soldaten waren immer noch misstrauisch, die Maxim-Gewehre waren auch nach hinten gerichtet und sicherten alle Anmarschwege. Konteradmiral Fürst von Kaltenfels, der Kommandant von Port Helene hatte erfahrene, gute Leute für dieses Kommando abgestellt. Nicht die allerbesten Soldaten, wenn man nach dem Führungszeugnis und der Formalausbildung ging, aber Leute, welche Überfälle er- und natürlich auch überlebt hatten. Männer, die vielleicht nicht immer nach den Buchstaben der Dienstanweisungen handelten und lebten, die aber loyal den Donaumonarchien und ihren Kameraden gegenüber waren. Leute, die einem hübschen Mädchen schon einmal hinterher pfeifen und sie auch gerne begaffen, aber niemals belästigen würden. Männer, die auch schon einmal respektlose Worte zu ihren Vorgesetzten sagen konnten und nicht immer den besten Schuhputz aufwiesen, welche aber die besten Schießergebnisse vorweisen konnten. Wie einer einmal seinen Vorgesetzten frech gefragt hatte:
„Wollen’s Kämpfer oder Uniformständer? Killer oder Gigolos?“ Es war also kein Wunder, dass außer dem Vizeleutnant Smetana, dem Stabswachtmeister Loibner und den Wachtmeistern als Fahrzeugkommandanten nur Gefreite, Korporäle und Zugsführer anwesend waren.
„Also, Henny, was können uns die Leut‘ sag’n?“
„Über die Leute von der Karawane leider nichts, Mary. Hier ware sie nicht. Aber sie sind ganz durcheinander wege diese Trommel. Sie könne nicht sagen, wo sie ist, aber sehr wohl, was.“
„Also, ich hör‘ gut zu!“ Und der alte Rabbi des Dorfes erzählte, von Henrietta Jones übersetzt.

„Was ich jetzt erzähle, ist kein Geheimnis, hier kennt jeder Mann, jede Frau und jedes Kind diese Geschichte.“
》Im Norden des gelobten Landes Israel lebte dereinst einer der zwölf Stämme des Auserwählten Volkes GOTTES, der Stamm Daniel. GOTT, der Gerechte hatte diesem Stamm zur Aufbewahrung eine große, eine mächtige Waffe anvertraut. Eine sehr, sehr mächtige Waffe, welche erst zum Gebrauch hervorgeholt werden sollte, wenn das ganze Volk Israels und die Stadt Jerusalem in Gefahr seien. Die Menschen nannten diesen Gegenstand den Bundesring, denn es war ein mit Leder bespannter Reifen aus Holz. GOTT selbst, so sprach die Überlieferung, würde ein deutliches Zeichen senden, wann es soweit sei, den Bundesring einzusetzen. Die Kinder des auserwählten Volkes GOTTES jedoch gerieten in Zwist und Hader untereinander, einer gönnte dem anderen nicht einmal das Brot zum Essen und das Wasser zum Trinken, vom Fleische und Weine ganz zu schweigen. Sie raubten einander das Vieh und die Frauen, die Ernte und die Kinder. Und sie alle bestürmten die Enkel Daniels, sie mögen mit dem Bundesring den Kampf beenden und ihren Stamm als den der Könige einsetzen, auf dass ein Stamm herrsche über das heilige Land GOTTES. Der Stamm Daniel aber sollte dafür das beste Stück Land erhalten. Doch Ehud der Weise, der oberste Rabbiner und Richter der Nachkommen Daniels befragte zuvor noch den HERRN im Gebet, und der GOTT unserer Väter fragte Ehud wider:
„Ehud, Ehud, habe ich dir ein Zeichen gesandt? Hat die Trommel gesungen, ist ein Vogel verkehrt geflogen, ein Blitz aus wolkenlosem Himmel zur Erde gefahren? Wenn du nichts dergleichen gesehen oder gehört hast, wie kannst du glauben, ich wolle, dass einer regiere in diesem Land, der kein wirklich Gerechter ist. Und ist ein wirklich Gerechter einer, der dich bringen will zu handeln gegen GOTTES Gebot?“ Da nahm der Weise Ehud die Enkel Daniels zur Seite und sprach zu ihnen folgendes:
„Lasset uns verlassen dieses Land, welches jetzt noch das Gelobte genannt wird. Doch ich glaube, GOTT der Gerechte wird jene bestrafen, welche sich hier als erhaben über andere dünken und freveln wider SEIN Gebot. Wir wollen gehen, damit der Zorn GOTTES nicht auch uns trifft, und wir wollen wiederkehren, wenn das Volk Israels wieder einig geworden ist.“ Und die Kinder Daniels zogen hinaus, um sich dem Kriege zu entziehen und dem Willen des HERRN zu gehorchen. Und sie kamen in das Land Amhara, wo sie siedelten und wohnten. Eine kleine Gruppe jedoch zog mit dem Ring des Bundes dahin. An einem See, dessen Wasser bitter und salzig waren wie die Tränen der Gerechten, warden sie und der Ring zuletzt gesehen, dann waren sie verschwunden auf immer!《
„So ist das auch geblieben bis vor kurzer Zeit. Denn was ihr da erzählt, das muss der Ring des HERRN gewesen sein, und ich finde es Besorgnis erregend, dass es jetzt geschehen konnte! Hat Gott ein Zeichen gesandt? Ich habe keines gesehen, aber bin ich ein Heiliger? Nein, ich denke nicht. Aber wenn die Thora Recht hat, dann hat der HERR seinem auserwählten Volk verziehen und möchte es wieder in seinem heiligen Land sehen. Und das macht mir Angst. Große Angst sogar, denn freiwillig werden die Osmanen unsere Heimat nicht räumen. Es wird Krieg und Tote geben. Viel zu viele Tote.“
„Und wenn Gott wirklich kein Zeichen gesandt hat“, wollte Maria Sophia wissen.
„Dann sind die Hüter des Ringes einer Versuchung erlegen und haben eigenmächtig gehandelt. Vielleicht haben sie beschützen wollen unsere neue Heimat gegen die neuen Römer – aber richtig war es trotzdem nicht. Nicht ohne das Zeichen! Und – wie ihr erzählt, es rächt sich doch schon. Und diese Horde wird nicht die einzige sein, die nach dem Ring sucht. Es werden weitere kommen, und freundlich fragen werden sie wohl alle nicht. Es wird vielleicht mehr Opfer geben unter der normalen Bevölkerung als bei einer erfolgreichen Invasion! Am besten wird es sein, wir ziehen dort hinüber auf eine Insel, bis die Gefahr vorüber ist.“
„Dem ist nicht zu widersprechen, Rabbi. Wir danken dir!“ Maria Sophia faltete die Hände und neigte höflich den Kopf, eine Geste, welcher der abessinische Rabbiner ebenso höflich erwiderte.
„Na gut, also hier am Ufer sind’s nicht g’fahren. Danke, Scharly!“ Sie hielt das Ende ihrer Cohiba an das Feuerzeug, welches ihr Maerz entgegenhielt und paffte an ihrem blonden Zigarillo, bis es zufrieden stellend glühte. „Aus irgendeinem Grund hab‘n sie sich für die schwere Route entschied‘n.“
„Vielleicht weil sie diese Orte hier noch überfallen wollten!“ Maerz hatte seine Karte hervorgezogen.
„Ich blödes Rindviech!“ Mafia Sophia schlug sich mit dem Handballen gegen die Stirn. „Natürlich! Wenn’s keine Angst vor Gonder hab’n, warum sollten’s dann nicht da auf’m Weg noch mehr Geiseln nehmen. Die sind nicht den leichtest‘n Weg gangen, sondern den über den Pass!“
„Aber das konnten‘s doch nicht vorherseh‘n, Prinzessin! Wir waren doch alle der Meinung, die geh’n am Ufer lang.“ Oberst von Inzersmarkt hatte seinen Hut abgenommen und kratzte sich den kahlen Scheitel.
„Stimmt.“ Elisabeth von Oberwinden trank rasch noch einen Schluck von dem Tee, den man ihnen angeboten hatte. „Wir sind alle dieser Meinung gewesen. Weil wir dacht hab’n, die Hundsviecher woll’n auf’m schnellst’n Weg nach Gonder. Also, Maria, aufsitzen?“
Die Prinzessin warf den Stummel des Zigarillos von sich und trank ihren Tee aus. „Nein! Schau dir die Sonn‘ an, in einer halben Stund‘ ist pechschwarze Nacht. Wir übernachten in dem Dorf hier und machen uns in aller Herrgottsfrüh‘ auf die Socken. Außerdem würd‘ ich sagen, wir ändern unser‘ Rout‘n. Gleich jetzt von da nach Norden, über den Pass bei Emfraz. Vielleicht können wir dort noch irgend was retten. Und jetzt, gute Nacht, und schaut’s, dass morgen ausg’ruht und frisch seid’s!“
„Das sagt jetzt grad‘ die Richtige“, frotzelte Elisabeth. „Befolgst du dein eigenen Rat auch selber?“
„Schau’n wir einmal.“
=◇=
Der Tanasee liegt 1.750 Meter über dem Meeresspiegel auf dem Hochland von Abessinien und hat einen prominenten Abfluss. Den Blauen Nil, welcher am südlichsten Ende dem See entspringt und nach vielleicht 30 Kilometer bei Tis Issat einen über 40 Meter tiefen und manchmal 400 Meter breiten Wasserfall bildet und danach durch ein System von Schluchten, welches sich nicht selten über 1.200 Meter tief in die Bergwelt Äthiopiens eingegraben hat, dem weißen Nil zufließt und sich bei Karthoum mit ihm vereint. Am westlichen Ufer des Sees hatte sich in Jahrmillionen eine von nur wenigen Hügeln durchbrochene Hochebene gebildet, an diesem Ufern liegen mehrere kleine Fischerdörfer mit üblicherweise nicht mehr als zehn, zwölf im typischen runden Stil der Gegend gebauten Hütten. Von Lalibela gibt es über Gashena, Filakit, Nefas Meewcha, Debre Tabor und Wereta einen markierten Handelsweg zum See, der zumeist von Eselkarren benutzt wird, deren Schluchten aber breit genug für die Fahrzeuge der österreichischen Dragoner waren. Einige Kilometer vor Wereta öffnete sich dann das Schluchtsystem zu der erwähnten Hochebene zum See, und die Straße teilte sich in diesem etwas größerem Dorf. Südwestlich nach Bahir Dar, wo der Blaue Nil aus dem See entstand, nordöstlich über Addis Zemen, Gazara und Emfraz nach Gonder.
Am Morgen des 16. April 1889 hatten die kakanischen Radpanzer jenes winzige Dorf am Ufer des Sees in Richtung Emfraz verlassen, dessen Rabbi ihnen die Geschichte der Trommel Dans erzählt hatte. Maria Sophia hatte von der Wirkung des Instrumentes bereits gehört, als sie in Lalibela mit Wien kommuniziert hatte. Eine machtvolle Waffe, unbestreitbar, und in den falschen Händen könnte diese eine große Bedrohung werden. Wobei sich die Erzherzogin tief im Herzen gar nicht sicher war, wessen Hände denn nun eigentlich die richtigen waren. Im Husar II wurde gerade genau über dieses Thema gesprochen, während Frantischek Wropaschalek den Wagen auf Kurs hielt und Janos Pospischil die Umgebung aufmerksam beobachtete.
„Wenn wir diese Waff‘n in die Hand bekommen könnt’n, würd es niemand mehr wag‘n, Österreich zu überfall‘n!“ Die Augen des Oberst Wilhelm Graf von Inzersmarkt leuchteten, als er von dieser Möglichkeit sprach. „Das würd‘ sich jeder zwei Mal überlegen müssen, ob er so ein Risiko wirklich eingehen will! Wir sollt‘n uns wirklich bemüh‘n, dieses Artefakt für Kakanien sicher zu stellen, Hoheit!“
„Ja? Wirklich?“ Maria Sophia brummte es einsilbig.
„Aber natürlich, Hoheit“ begeisterte sich der Oberst, sein Zeigefinger strich über seinen buschigen Oberlippenbart. „Die Vereinigten Donaumonarchien wär’n dann die stärkste Macht…“
„Und könnt’n allen ander’n Ländern sagen, wo’s lang zu geh’n hat?“ Elisabeth von Oberwinden hatte die Unterarme auf die Knie gelegt. „Wie lang würd’s denn gut gehen, mein lieber Herr Oberst? Bis sich genug Länder verbünd’n, um Österreich trotz der Trommel so richtig den Arsch aufzureißen. Weil’s von unserer Bevormundung endgültig genug hab’n? Dann sind wir weg vom Fenster, endgültig, dann heißt es gute Nacht, schöne Großmutter! Oder, wie die Piefke sagen ‚Schicht im Schacht‘. Dann können wir uns doch gar nicht warm genug anzieh‘n.“
„Mit dieser Waffe in unser’m Besitz würd‘ sich doch niemand mehr trau’n, uns anzugreifen“, argumentierte der Oberst. „Das könnt‘ sich keiner mehr leisten! Allein die Drohung der Vereinigten Donaumonarchien, diese Waffe einsetzen zu können, würde den Frieden auf der ganzen Welt sichern.“
„Nehmen wir an, das stimmt!“ Maria Sophia brach ihr Schweigen. „Es hat zwar auf längere Zeit noch nie funktioniert, den Frieden mit überlegener militärischer Macht erpress‘n zu wollen, aber gut, nehmen wir der Diskussion halber einmal an, es könnt‘ so einfach hinhau’n, wie sie jetzt sag‘n, Oberst. Meine Mutter als Regentin der Vereinigten Donaumonarchien würd‘ das Ding wahrscheinlich wirklich nur defensiv einsetz‘n, der Franz Rudolph vielleicht, vielleicht sag ich, auch noch. Was ist mit seinem Erben, wer immer das ist. Und mit dem seinem Nachfolger. Sehen sie, Oberst, das wirklich Blöde ist, dass irgendwann unweigerlich ein total machtgeiles oder wahnsinniges Arschloch an die Macht kommt. Ein Mensch, der mit der Trommel wirklich alle ander’n erpressen möcht‘, dass sie nach seiner Fiedel Walzer tanzen. Zehnausende, hunderttausende, dann vielleicht schon mehrere Millionen Tote in einer Großstadt sind schon ein beeindruckendes Druckmittel, natürlich. Irgendwer ist sogar schon dahinter her, um dieses Machtinstrument in die Finger zu krieg’n. Und wahrscheinlich ist diese Saubande, von der nicht wissen, in wessen Auftrag sie steht, nicht einmal die einzige. Es sind ganz sicher schon Agenten von jedem europäischen Reich in Abessinien unterwegs. Die Engländer könnten von Ägypten ganz leicht ins Land, die Franzosen hätten‘s von Französisch Somaliland bei Dschibuti auch nicht wirklich schwer, und wenn die Katzelmacher nicht schon von Baylul oder Italienisch Somaliland aus einen Trupp losgeschickt haben, dann dürft’s mich da…“, sie zeigte auf ihre Halsschlagader, „…mit einem ganz groß‘n Messer einestechen!“
„Außerdem haben so sicher wie das Amen in der Kirch’n alle Mächte ihre Agenten in Josephshafen sitzen, auch die Deutschen, Russen und Skandinavier“, führte Lisi weiter aus. „Die Türken sowieso auch, keine Frag‘. Und wenn’s irgendwo auf dieser Welt genug Söldner zum anheuern gibt, dann um Josephshafen herum!“
„Und das heißt, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit noch jede Menge Leute hier treff‘n werden, die alle gegeneinander kämpfen werden, weil’s alle auch hinter dem blöden Ding her sind.“ Maria Sophia seufzte. „Sogar in unserer Grupp‘n gibt’s doch noch ganz andere als kakanische Interessen. Also, versteh‘ mich jetzt bitte nicht falsch, Scharly, ich vertrauert dir persönlich mein Leben und noch viel mehr an, das weißt du ja. Auch dir, Henny und Orville natürlich auch. Aber wenn wir die Trommel jetzt wirklich da irgendwo finden? Wird’s euch passen, wenn Österreich tastsächlich ein derart mächtiges Terrormittel hat, oder hört die Freundschaft dann ganz plötzlich auf? Wird in Carl vielleicht der Deutsche erwachen, oder unter Umständen sogar noch der Sachse, der die Preußen in’s zweite Glied vergattern will?“ Carl Friedrich Maerz machte mit entsetzter Miene eine zugleich wegwerfende und abwehrende Handbewegung. „Nicht jetzt gleich abwink’n, Herr Major der Reserve Carl Friedrich Maerz vom sächsischen Gardebataillon Kurfürst August. Wir steh’n noch nicht vor dem Ding, wir wissen nicht, wie wir reagieren werd’n! In Orville erwacht dann vielleicht der Brite. Oder aber möglicherweis‘ der amerikanische Freiheitskämpfer, der endlich ein von Britannien freies Amerika will. Hat’s schon zweimal geb’n. Nein, Orville, ich weiß nichts von modernen Unabhängigkeitsbestrebungen der Kolonisten und will auch nichts wiss‘n. War nur theoretisiert. Und zu guter Letzt, was wird in Henny aufwach’n? Die steht dann plötzlich allein zwisch‘n den Fronten, halb deutsch, halb britisch, von persönlichen Sympathien gar nicht zu red‘n. Eine besch…eidene Lage!“
„Das – ich möchte mir das gar nicht vorstellen, aber… Orville, du bist mein Mann, ich – ich würde natürlich dir folgen. Aber…!“ Henrietta liefen die Tränen über die Augen.
„Aber leicht würde es meiner deutschen Frau nicht fallen, das kann ich mir schon denken!“ Die Arme Orvilles umschlangen seine Frau. „Ich selbst wäre gefangen zwischen persönlicher Loyalität der Prinzessin, ach was, der Freundin Maria Sophia und dem Rest dieser Gruppe auf der einen Seite, und der Treue meinem Vaterland gegenüber auf der anderen. Auch wenn Britannien nicht perfekt ist, es ist meine Heimat!“
„Ich sag’s ganz offen, ich hab‘ direkt Angst davor, dass wir Erfolg haben könnt’n! Am liebst‘n würd‘ ich in einem solch’n Fall ein Magazin von Scharlys Flechetteg‘wehr durch des Fell jag’n, den Rahmen in die Luft sprengen und was übrig bleibt auch noch verbrennen und die Asch’n über’m Meer verstreu‘n!“
„Damit könnte ich eigentlich auch ganz gut leben!“ bekundete Maerz. „Wenn niemand diese Trommel haben kann, wird sich auch niemand mehr darum streiten können! Und niemand kann versuchen, jemand anderen damit zu erpressen!“
„Aber dieses wundervolle Stück Geschichte, dieses – dieses spirituelle und materielle Wunder der Geschichte einfach zu zerstören, das wäre ja ein richtiges Sakrileg“, stöhnte Orville verzweifelt. „Man kann doch so ein Wunderwerk der Wissenschaft nicht einfach vorenthalten!“
„Lieber das, als das Leben von wer weiß wie vielen Menschen opfern, Schatz!“ Henrietta legte ihrem Mann die Hand auf den Unterarm. „Menschen sind so viel wichtiger als ein neues Buch, als der Beweis einer Geschichte, die schon endlos lange vorbei ist. Wir alle müssen doch für eine lebenswerte Gegenwart sorgen, und wir müssen auch Henry die Möglichkeit geben, noch in einer halbwegs freien und friedlichen Welt zu leben.“
„Das stimmt. Das stimmt, ja gut!“ Orville Jones atmete tief durch und hob die Hände in Schulterhöhe. „Ich ergebe mich doch schon! Also, ich bin einverstanden. Wir vernichten die Trommel, sobald wir sie finden, dann hat sie einfach niemand! Aber ein paar Photos müsst ihr mir einfach erlauben“, jammerte er. „Ich habe erst vor kurzem eine von den ganz neuen Goertz-Patent-Anschütz Handkameras mit automatischem Verschluss erworben, da muss ich nicht einmal mehr ein Stativ aufbauen.“ Die Reisegruppe lachte.
„Wenn wir genug Zeit hab‘n, klar, dann darfs’t auch deine Bilderl schießen“, versprach Maria Sophia, und der Oberst von Inzersmarkt hob ebenfalls beide Hände und gab auf.
„Na schön, also, wenn’s wirklich niemand kriegt, soll’s auch gut sein. Ein bisserl technischen Vorsprung hat die österreichische Armee ja noch, damit hab’n wir ein bisserl Sicherheit! Auch ohne dieses magische Klimbim. Obwohl…“ seine Stimme bekam einen verträumten Klang. „Solche Trommeln in unser‘n Küstenstellungen. Wir bräucht‘n uns keine Sorgen mehr mach’n!“
„Da wär‘ ich mir jetzt nicht so sicher“, überlegte die Erzherzogin. „Österreich hat viel mehr Landgrenzen als Küst‘n. Und auch nur für unsere Haf’nstädte bräucht’n wir eine ganze Menge solcher Trommeln. Allheilmittel ist’s also auch nicht wirklich, das Ding halt‘ ich persönlich eher für ein Werkzeug zum Verbreiten von blankem Terror!“
„Wenn wir die Vernichtungskraft von der Trommel bedenken – ein Aviso-Luftschiff könnt‘ Paris, London, Berlin oder Wien in kürzerster Zeit dem Erdboden gleichmachen.“ Elisabeth von Oberwinden verbarg ihr Gesicht in den Händen. „Ich will’s mir gar nicht vorstellen, nicht so genau. Natürlich kann ein Bombardement aus einer Flotte Luft- oder Flugschiff‘n ein ganz ähnliches Ergebnis erziehl’n. Aber wie viele Tonnen an Sprengmittel bräucht‘ man dafür, und wir müsst’n dafür unsere sämtlichen Flugschiff‘ von überall auf der Welt zusammenhol’n. Ich hoff‘ nicht, dass sich das zu meinen Lebzeit’n noch ändert!“
„Dann wollen wir unseren Beitrag dazu leisten!“ Maerz hieb Orville auf die Schulter. „Du kriegst deine Photos und dann eliminieren wir das dumme Ding! Endgültig!“
=◇=
Unermüdlich bewegten die modernen Teslamotore den Windhund und die Husaren ziemlich genau nordwärts der Höhenkette zu, dort würden sie bei dem Ort Emfraz wieder auf den beschilderten und ausgefahrenen Handelsweg treffen. Eine kleine, eine sehr kleine Hoffnung hatten sie noch, vielleicht doch noch rechtzeitig einzutreffen zu können. Aber so wirklich rechnete mittlerweile niemand aus der Gruppe mehr damit. Aber vor Gonder wollten sie die Banditen nach Möglichkeit schon noch einzuholen, ehe sie wieder mordeten und folterten. Es war ihnen völlig egal, um welche Gruppe es sich handelte und in welchem Auftrag sie unterwegs war, man wollte einfach nur weitere Verbrechen verhindern.
„Melde gehorsamst, Emfraz kommt gleich in Sicht, Hoheit!“ Janos Pospischil hatte sich umgedreht und rapportierte kurz, während die Fahrer der vier Fahrzeuge diese zum Stehen brachten. Die vor der Abfahrt bereits ausgegebenen Befehle kamen nun zum Tragen, in allen drei Husaren entstand eine kurze Unruhe. Die kurzen, metallischen Klickgeräusche verrieten, dass die Dragoner den Zustand ihrer Gewehre von ‚halbgeladen‘ zu ‚geladen und gesichert‘ änderten.
„Danke, Wachtmeister“, nahm die Erzherzogin die Situation zur Kenntnis. Die drei Dragoner an Bord von Husar II besetzten das vordere Maxim-Gewehr und diejenigen an den Flanken, ebenso die eingeteilten Schützen in den anderen Wagen. Die Richtschützen der 3 Zentimeter Maschinenkanonen in den Türmen luden mit den langen Hebeln der Handspannvorrichtung ihre Waffen durch, klappten ihre Visiere herab und lösten die Bremsen, richteten die Rohre dorthin, wo hinter der nächsten Biegung die Stadt auftauchen würde. Aus dem Husaren III stiegen der Vizeleutnant Smetana und drei seiner Soldaten, sie pirschten vorsichtig einen seitlichen Hügel hinauf, um Emfraz zuerst aus der Entfernung zu beobachten.
Wie die meisten nordafricanischen größeren Städte bestand auch Emfraz aus einer ummauerten Medina mit extrem schmalen Gassen, welche noch mit Sonnenschutz aus Stoffbahnen versehen waren. In den Gassen dieser abgeschlossenen Siedlungen gab es ewiges Dämmerlicht, doch diese Bauweise hielt die Hitze des Tages ebenso von den Bewohnern fern wie die Kälte der Nacht. Eine Baumethode, welche sich bereits seit einigen Jahrhunderten bewährt hatte. Aber diese Bauweise hielt leider auch die neugierigen Blicke von den Hügeln herab vom Inneren der Stadt ab. Trotzdem gab es einige Anzeichen, die auch schon aus dieser Entfernung verrieten, dass in Emfraz etwas ganz und gar nicht stimmen konnte. Vizeleutnant Alexander Smetana war ein altgedienter, erfahrener Soldat, sozusagen mit allen nur erdenklichen Wassern gewaschen. In einem kleinen Nest im Waldviertel Niederösterreichs aufgewachsen, wollte er nicht wie sein Vater ein Saisonarbeiter für die Ernte bleiben, ein sogenannter Erdäpfelbehm. Der baumlange Alexander strebte nach höherem, nach einer festen Anstellung. In der dortigen ländlichen Gegend war dieser Wunsch fast unmöglich zu erfüllen, also fasste er sich eines schönen Tages ein Herz und wanderte zu Fuß bis Krems an der Donau. Dort meldete er sich kurzerhand in der örtlichen Dragonerkaserne. Der beinahe 2 Meter große, stämmig gebaute und mit kräftigen Muskeln ausgestattete Freiwillige wurde getestet, genommen und ausgebildet. Jetzt, mit fünfundvierzig Jahren, war er als Vizeleutnant bereits auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Nun, vielleicht konnte er irgendwann noch Fähnrich werden, die Chancen standen für ihn aber eher gering. Möglicherweise noch als Präsent zur Pensionierung, ein Titel ohne Mittel also. Allerdings war Alexander Smetana mit seinem Leben durchaus zufrieden. Der Dienst hatte ihn innerhalb der Donaumonarchien schon beinahe überall hin geführt, zuletzt eben nach Africa, nach Port Erzherzogin Helene. Er war immer gut mit den Einheimischen ausgekommen, für ihn war dunkle Haut einfach dunkle Haut und kein Qualitäts- oder gar Wertmerkmal, ebenso wenig wie blonde oder schwarze Haare. Seine Frau Kamaea kam aus der Gegend des Sees Taupo nui a Tia auf der nördlichen Insel des Māui-Landes und war halbe Maori, er hatte sie dort während seiner Stationierung kennen und lieben gelernt. Dank der Armeereform von Kaiser Franz Karl von 1857 konnte sie ihn auch zu seinen neuen Kommandos begleiten und jetzt mit ihm in einem kleinen Häuschen in Port Helene wohnen.
Im Moment aber konzentrierten sich alle Sinne des Waldviertlers auf die Stadt vor ihm, auf Emfraz, die er durch seinen starken Swarovski-Feldstecher beobachtete. Es war seltsam ruhig dort unten, und er war sich beinahe sicher, auf eine leere Geisterstadt hinab zu blicken. Beinahe reichte ihm aber dieses Mal nicht, denn es ging immerhin um die Sicherheit der Erzherzogin. Selbst wenn sie sich auf den letzten Platz der Thronfolge zurückstufen hatte lassen, sie war immer noch eine Prinzessin aus dem Herrscherhaus der Donaumonarchien, und er trug keine geringe Verantwortung. Eine Verantwortung, der er sich auch durchaus bewusst war.
„Weber, Morawicz, gedeckter Erkundungsmarsch“, befahl er leise. „Schauen’s einmal nach, ob dort unten noch jemand ist, der uns g’fährlich werden könnt‘. Ich behalt‘ euch und die Umgebung gemeinsam mit dem Czojka im Auge!“
„Zu Befehl!“ Auch die beiden Korporäle waren keine grüne Jungen mehr, sie hatten im Dienst für die Donaumonarchien bereits einige Erfahrungen gesammelt. Statt also aufzustehen und einfach auf die Stadt zuzulaufen, machten sie einen Umweg, der ihnen eine halbwegs passable Deckung versprach. Gemeinsam mit der hellen Sandfarbe ihrer Uniformen hofften sie, so zumindest einen großen Teil der Strecke ungesehen voranzukommen. Falls ja doch noch jemand in der Stadt war und etwas gegen die Annäherung von Fremden hatte. Cojka brachte in der Zwischenzeit sein langes Scharfschützengewehr in Anschlag und beobachtete das Tor und die Mauern durch das Zielfernrohr von Zeiss in Jena auf seiner Waffe. Wieder und immer wieder schweifte sein Blick über die Stadt, seinem geübten Auge sollte keine noch so kleine Bewegung entgehen. In der Zwischenzeit waren auch die sieben Dragoner von Husar 1, in dem Josepha Müller und Horst Komarek die beiden Maxims an der Flanke übernommen hatten, und die restlichen drei von Husar 3 abgesessen und waren ausgeschwärmt. Maria Sophia und Oberst von Inzersmarkt gingen geduckt bis zum Vizeleutnant vor, immer in guter Sichtdeckung bleibend.
„Schon was zu seh‘n, Vizeleutnant?“ Auch die Erzherzogin hatte ihren starken Swarovski Feldstecher vor die Augen genommen und suchte konzentriert die Stadtmauer ab.
„Nicht das geringste, Hoheit! Aber die Korporäle Weber und Morawicz sind recht gute Männer. Sie können vielleicht nicht ordentlich salutieren, aber sich beinahe unsichtbar machen, darin sind’s gut.“
Maria Sophia nickte nur. „Ich pfeif‘ auf’s ordentliche Grüßen, wenn’s im Einsatz gute Männer sind!“
„Dann haben Hoheit die Creme de la Creme der Garnison Zula mit. Eine batzen Schnadder’n, die’s auch ständig aufreiss’n, aber gute und erfahrene Kämpfer!“
Gute Soldaten, das waren die zwei Korporäle wirklich. Wäre jemand auf den Mauern oder an den Toren der Medina von Emfraz gestanden, hätte er die beiden Späher tatsächlich erst bemerkt, als sie schon beinahe an der Mauer standen. Rasch und trotzdem vorsichtig liefen sie nahe an der Mauer entlang in die Richtung des Tores, wobei sie ständig die das Gelände im Auge behielten. Sie vertrauten Smetana und Czojka, dass von eventuellen Personen auf der Mauer keine Gefahr für sie ausging. Wie um diese Tageszeit nicht anders zu erwarten war, stand dieses Tor sperrangelweit offen, doch ein Blick dahinter offenbarte nichts anderes als leere Gassen. Kein Mensch war zu sehen, aber Gewürze waren ausgekippt auf dem Boden, die Behälter lagen neben dem Tisch des Verkaufsstandes. Einige magere Hunde saßen in der Nähe eines Fleischerladens und hatte einige Brocken ergattert, wahrscheinlich von einem in der Gegend gezüchteten und geschlachteten Schaf. Brotlaibe, Teeblätter, Früchte, alles war auf den Boden geworfen, die Tische umgestoßen, die Tücher zum Teil abgerissen.
„Schaut gar nicht gut aus“, flüsterte Morawicz. „Bleib‘ an der Tür und gib mir Deckung! Ich schau mal, ob ich von der ander’n Seit‘n mehr seh‘!“
Weber klopfte seinem Freund auf die Schulter. „Auf drei?“
„Wie immer!“ Die zwei Korporäle nahmen ihre Karabiner mit den kurzen, nur 38 Zentimeter langen Läufen und den 25-Schuss-Magazinen feuerbereit mit der Mündung nach oben zur Hand, dann zählten sie.
„Eins!“ begann Morawicz.
„Zwei!“ ergänzte Weber, sie nickten einander zu.
„Drei“, sagten sie im Chor, ein gut eingespieltes Team. Morawicz lief los, hetzte am offenen Tor vorbei, das Innere der Medina soweit möglich im Auge behaltend, während Weber um die Ecke sprang und die Fassaden und Straßen absuchte, wobei der Lauf seines Gewehres ständig den Augen folgte.
„Nichts“, rief Morawicz und schreckte damit die Hunde auf, welche mit ihrer Beute davon liefen.
„Nichts“, antwortete Weber. Dann verständigten sie sich noch mit einigen kurzen taktischen Handzeichen, nickten einander einmal mehr zu und sprangen durch das Tor. Es blieb immer noch ruhig, kein Mensch war zu sehen, gespenstische Ruhe lag über der gesamten Szene.
„Zu schpät g‘kchommen?“ Trotz der geringen Lautstärke hallte Webers Frage durch die Stille.
„Verdammt, ja, schaut so aus!“ Morawicz war frustriert. „Aber lass‘n wir nachrücken, vorher sollt’n wir net weitergeh’n. Wenn ich an die Medina bei Port Helene denk‘, find’n wir nie wieder raus, wenn wir jetzt zu zweit reingeh’n.“
„Eine Schtafette? Gute Idee, Kchurtl.“ Sie verließen die Stadt wieder, und Morawicz pumpte mit der rechten Faust zweimal in der Luft.
„Alsdann!“ Vizeleutnant Smetana drehte sich um. „Fahrzeuge langsam vorwärts, Infanterie folgt. Gefechtsbereitschaft herstellen, und dann pack‘n wir’s!“
Auf dem Vormarsch blieben die kakanischen Soldaten wachsam, doch es geschah während des gesamten Vormarsches genau nichts. Gar nichts, wenn man von einigen Windböen absah, welche lange Staubfahnen quer zur Marschrichtung der Dragoner wehten.
„Gute Entscheidung!“ Smetana hatte sich gemeinsam mit der Erzherzogin, dem Schriftsteller, der Baronesse und dem Oberst den Rapport angehört.
„Jetzt bräuchten wir einen Ariadnefaden!“ brummte Maerz. „Aber ich glaube, dass wir kein Seil haben, das lange genug wäre!“
„Das fürcht‘ ich auch“, stimmte Smetana zu.
„Ein Stückerl weit hab’n wir schon so was ähnliches!“ Elisabeth von Oberwinden deutete nach oben. „Zumindest das Büro vom Wilczek seine Leut‘ müsst’n wir find’n können!“
„Besser wie nichts“, bestätigte Maria Sophia. „Geh’n wir. Vizeleutnant, lass‘ er die Husaren und den Windhund die Stadt umfahr’n und auf der ander’n mit dem Heck zusammen Aufstellung nehmen. Zehn Dragoner geh‘n mit uns, der Rest bleibt als Bedeckung bei den Wagen! Vielleicht sollt‘n wir auch die Henrietta mitnehmen. Wegen dem Amharisch. In Lalibela sind wir mit englisch ja ganz gut auskommen, aber da am Land redet kein Mensch mehr was ander’s als diese Abart vom Hebräischen. Wie bei uns, in einem Tiroler Nest mitten in die Dolomiten musst auch froh sein, wenn’st die Leut‘ überhaupt verstehst!“
„So schlimm ischt’s auch wieder nischt, Hoheit. Unsch Tirrooler verschteeht mån doch bescher ålsch ålle ånderen Öschterreicher“, verteidigte Weber seine Heimat. „Hoheit entschuldigen scho bitte!“
„Ålsch Tirroolerr scho, åber ålsch Schåltschburcherr håscht in Scherrb’n auf, und was die Xiibärrgärr ångääht, die schoon wie die Schwizrr rädä tuun, då håt’s månchmål no mähr Probläämä! Åbär där Punkt ischt – ist, dass in Hinterpfuiteufel an der Steinleith’n auch kaum ein Mensch englisch kann, in Vorarlberg vielleicht noch ein paar Brocken französisch, in Transalpinien italienisch und krowodisch. Und da hier in Abessinien in den relativ kleinen Nestern beherrscht sicher auch kaum einer eine von den europäisch‘n Sprach‘n, nicht einmal das Pidgin-English wird allgemein verbreitet sein. Aber, Korporal, wenn er Amharisch kann…“
„Melde gehorschåmst, dåsch nein“, bekannte Weber
„Das ist auch überhaupt keine Schand‘, Korporal“ betonte die Erzherzogin. „Wir können’s ja auch nicht, außer der Frau Jones. Darum beschützt er mir die Henrietta ganz besonders. Bis wir aus der Medina wieder draußen sind, weicht er nicht von ihrer Seite. Wenn’s unbedingt pinkeln muss, dann darf er sich umdreh’n, aber Henny“, wandte sie sich an die Freundin. „Es wär‘ wirklich viel besser, du könntest es dir bis nachher aufheben. Wenn‘s denn unbedingt sein muss, dann redest mit dem Korporal, ohne Punkt und Komma, und wenns‘t ihm des kleine Einmaleins aufsagst. Klar? Weil, wenns’t still bist, wird er sich umdrehen und schauen, obs‘t noch da bist und lebst! Und wenn er dann dein‘ Mond oder dein‘ Busch’n zum sehen kriegt, musst halt damit leben können! Stimmt’s Korporal?“
„Zu Befehl, Hoheit!“ Weber tippte an seine Mütze. „Frau Jones, schie kchönnen schich auf mich verlåschen, ich werd‘ wirklich nur schauen, wenn schie nichts mehr sågchen!“
„Ich werd rede wie e Wasserfall“ versprach Henrietta. „Aber ich bin doch ganz froh über die abg‘schotteten Toilette an Bord von die Fahrzeuge, drei Wänd und e Vorhang. So viel Luxus bei einem Militärfahrzeug? Das hätte ich ja gar nicht vermutet.“
Maria Sophia zuckte mit den Schultern und grinste schief. „Die feindlich‘n Scharfschütz‘n haben uns halt am Anfang die Leut‘ viel zu oft beim wischerln derschossen. Seit wir die Klos in den Wagen hab’n, geht das nicht mehr. Zuerst waren es ja ganz einfache Klappen, einfach zum drüber stellen oder hocken. Ganz besonders beliebt bei Unteroffizieren, die eine besonders ungustige Strafarbeit für disziplinarische Maßnahmen g’sucht hab‘n. Wenn einer Dünnpfiff g‘habt hat, und der Wagen war im schwer‘n Gelände unterwegs – na ja, sagen wir, die Leut‘ haben zum Glück mit’n G’wehr besser `troffen. Außerdem ist’s im Winter arschkalt – im wahrst’n Sinn des Wort‘s – durch den Abortdeckel reinkommen. Seit dem zweiten Modell gibt’s jetzt die normale Klobrille mit der Trennwand zum Abstützen und ein g’schlossenes System. Irgendwie wird die Sach‘ mit Druck dehydriert und dann genau so wie das Wasser irgendwo als Dünger in der Botanik verstreut. Genaueres kann dir sicher der Pospischil erzähl’n, der weiß da bestimmt ganz genau Bescheid!“
„Nein“, wehrte Henrietta Jones ab. „Nein danke, so genau – ich muss nicht alles wissen!“
=◇=
Überall in Emfraz bot sich das gleiche Bild der Verwüstung und Zerstörung. An manchen Stellen lagen tote Bewohner in ihren Läden oder auf den Straßen, umgestürzte Karren, erschossene Esel, zerdroschenes, verbeultes Geschirr, in den Staub geworfener und zerfetzter Stoff.

„Die hab’n schlimmer g’haust wie die Vandalen“, bemerkte Elisabeth. „Die wollt’n ganz massiven Terror unter den Leut‘ verbreit’n, damit alle Überlebend‘n gusch‘n und nicht mehr aufmuck‘n.“
Maria Sophia nickte und ging neben einem am Boden liegenden Kind in die Hocke. „Zwölf, dreizehn Jahr. Einfach in den Rücken g’schossen, wahrscheinlich wie er abpasch’n wollt‘. Wer macht denn so etwas?“
„Acht Europäer und dreizehn Araber, Mitzi,“ bemerkte Elisabeth von Oberwinden staubtrocken, ebenso trocken, wie sich ihre zugeschnürte Kehle anfühlte. Sie versuchte zu schlucken und sah durch die Häuser und die Stadtmauer hindurch in eine weite, unbekannte Ferne.
„Wenns‘t nichts dagegen hast, lach‘ ich später d’rüber, Lisi.“ Die Prinzessin erhob sich. „Geh’n wir weiter.“
„Schon ein Glück im Unglück, dass die Verbrecher solche technischen Nackerpatzeln sind!“ Zugsführer Reinhard Vogl zog rasch noch eine Schraube an. „Sie hab‘n so gut wie alles zertrümmert, aber wenn man ein bisserl technisches Wissen hat, funktioniert das Graffel noch immer. Man muss nur die Verbindungen wieder herstellen und den Taster neu verdrahten, die Werkzeug‘ dafür haben’s noch nicht einmal mitg’nommen, sondern nur einfach auf den Boden g’schmissen. Depperte Wappler miteinander halt! Fertig, Hoheit können jederzeit Verbindung nach Port Helene oder Lalibela aufnehmen!“
„Ich dank‘ ihm, das hat er gut gemacht, Zugführer.“ Maria Sophia setzte sich an den Telegraphen, stülpte sich die Kopfhörer über und versuchte, die Station in Gonder zu erreichen und die Leute zu warnen. „Keine Chance, ich fürchte, die sind schon dort!“ Sie schüttelte das Handgelenk aus und kreiste kurz mit den Schultern, dann begann sie mit der Übertragung der Situation nach Port Helene. Dorthin gab es keine Übermittlungsprobleme, das Kabel war also nicht durchgeschnitten worden.
„Mich wundert es, dass nirgendwo Überlebende sind“, überlegte Maerz. „Einundzwanzig Leute können doch ein solch großes Gemeinwesen nicht derart auslöschen. Hier haben doch sicher ein paar hundert Menschen gelebt!“
„Und da in der Gegend sicher nicht nur Unbewaffnete“, stimmte der Oberst zu. „Wir haben ja auch fast nur Frauen und Kinder g’funden, und auch wenn’s zu viele sind, weil jede einzelne Leich‘ eine zu viel ist, es können nicht alle Leut‘ sein, die da g’wohnt haben. Und wo sind all die Männer? Es müssten doch viel mehr da sein, nicht nur steinalte und halbe Kinder.“
„Vielleicht an der Front, bei Buur Cukur“, mutmaßte Smetana. „Oder unterwegs nach Baylul gewesen und noch nicht wieder zurück.“
„Geh’n wir!“ Die Übertragung war beendet, Maria Sophia hatte über den Draht noch einige Neuigkeiten erfahren und Befehle erteilt. Jetzt erhob sie sich und ging zur Tür hinaus. Dem Telegraphendraht folgend, der nach Gondar weiterlaufen sollte, schritten sie durch die verwaiste Stadt und fanden schließlich die Mauer auf der Nordseite des Stadt und das Tor.
„Weiter! Ich hab‘ der Abessinischen Verwaltungsstell‘ in Bahir Dar die Sache erklärt, die schicken einen Trupp Polizisten und auch Leut‘, die sich um die Beerdigungen kümmern sollen.“ Die Prinzessin drehte sich um und sah noch einmal mit zusammen gekniffenen Augen hinter ihrer getönten Sandbrille zu der Stadt zurück.
„Hoheit?“ Inzersmarkt berührte die Prinzessin am Ellenbogen, Maria Sophia nahm die Schutzbrille und wischte die Feuchtigkeit heraus.
„Tut mir leid, Oberst“, sagte sie mit belegter Stimme. „Ich hab‘ schon Leut‘ erschossen oder aufhängen lass’n, eigentlich sollt‘ mir der Tod nicht mehr ganz so nahe geh’n!“
„Das ist ein Unterschied wie zwischen preußischen Knobelbechern und den Schnürstiefeln in unser’m Heer, Hoheit. Wenn mich oder jemand unter meinem Schutz einer angreift, dann hat er sich dazu entschloss‘n, dass ich ihn umbring‘n kann und vielleicht sogar muss. Dann begeht er praktisch Selbstmord, es heißt er oder ich, und er tut mir kein bisschen Leid. Aber diese Leut‘ hab’n niemand was getan, sie wollt’n nur ihr kleines, bescheidenes Leben führ’n. Keine großen Reichtümer, kein überzogener Luxus, einfach ihren alltäglichen Geschäften nachgehen. Dann ist jemand daher gekommen und hat’s verhindert. Einfach so!“ Der Oberst schippte mit den Fingern. „Sehen’s, deswegen bin ich auch Soldat worden, Hoheit! Ich wollt‘ helfen, dass so was nicht zu oft passiert und nicht ung’straft bleibt!“
„Sie haben Recht, Oberst!“ Die Erzherzogin schüttelte das Haar aus und den Kopf wieder frei. „Dann sorg‘n wir halt dafür, dass es wirklich nicht ung’straft bleibt. Aufsitzen lass‘n, Oberst! Und – danke!“
„Immer wieder gerne zu Diensten, kaiserliche Hoheit!“
=◇=
Es waren nur 54 Kilometer von Emfraz bis Gonder, und hier bei der ehemaligen Königsstadt war rund um die alte Medina bereits eine offene, eine neuere Stadt mit einigen Annehmlichkeiten der neueren Zeiten entstanden. Vor den Toren der Altstadt gab es einen großen Platz, der als Wochenmarkt genutzt wurde und von den umliegenden Bergen durch die Feldstecher der Dragoner gut einsehbar war, ebenso wie der Exerzierplatz der nahen Kaserne.
„Ich versteh’s nicht“, stöhnte von Oberwinden. „Gut, es sind da jetzt mehr als die zwanzig, die das Dorf überfallen haben, da unten rennen mindestens fünfzig oder sechzig herum. Aber trotzdem, in Gonder leben gut zweitausend Leut‘. Wie können die paar Hanseln so viele Einwohner überwältigen? Auch wenn die meisten Soldaten grad mit dem Negus unterwegs sein sollten, um den Itakern eine auf’s Dach’l zu geb’n, so um die hundert Soldaten sollten ja doch noch da sein.“
„Betäubungsgas, Fräulein Elisabeth.“ Von Inzersmarkt wischte sich die Stirn mit einem Taschentuch in der Farbe der Africauniformen der Vereinigten Donaumonarchien und den drei goldenen Sternen auf silbernem Grund, dem Rangabzeichen eines österreichischen Obersten ab. Ein Geschenk der Frau Oberst von Inzersmarkt, damit er sie auch im Feld nicht vergessen sollte. „Wir haben ja auch ein paar Kubikmeter davon in unseren Arsenalen. Schwerer als Luft, von einem Zeppelin absetzen, danach zwei, drei Stunden warten und man braucht die Bewusstlosen nur noch einsammeln und fesseln.“
„Sie woll’n mir sagen, die Verbrecher verfüg‘n über moderne Kampfmittel und ein Luftschiff? Dann sind das da unt’n ja vielleicht auch noch ausgebildete Soldat‘n“, fragte Elisabeth überrascht.
„Mit soldatischer Ausbildung, vielleicht, aber Soldat’n, echte Soldat’n geb’n sich zu so was nicht her“, stritt der Oberst eine militärische Intervention von Soldaten ab.
„Täuschen’s ihnen nicht, Oberst!“ Maria Sophia setzte den Feldstecher ab und rieb sich die Augen. „Die Historie ist voll von Gräueltat‘n, die von Soldat‘n begangen word‘n sind. Es braucht nur den richtig’n Auslöser!“
„Trotzdem, ich stimme dem Oberst in diesem speziellen Fall zu“, bemerkte Maerz. „Ein Luftschiff könnten sie gehabt haben, das ist sogar wahrscheinlich. Aber ich tippe wenn, dann auf eine billige, eiligst zusammengestellte Söldnertruppe. Seht einmal genauer hin! Uneinheitliche Kleidung und Bewaffnung, aber vor allem nicht sehr professionelles Handeln. Und jetzt treiben sie ihre Gefangenen auf den Exerzierplatz, die werden streng bewacht. Aber ich sehe nirgendwo Wachposten nach außen, als wären sie sich völlig sicher, dass sie aus der Stadt oder gar von außerhalb niemand überfallen kann. So, als gäbe es in Bahir Dar keine Garnison, der das Schweigen ihrer Kameraden in Gondar auffallen könnte!“
„Bis zu meinem Telegramm ist ihnen ja auch wirklich nichts aufg’fallen, Scharly“ Die Erzherzogin sah wieder durch das Glas.
„Eine komische Dienstauffassung“, schnaubte der Oberst.
„Na ja, alle geb’n ihre Statusmeldungen zu einer bestimmten Uhrzeit ab, und Gondar ist erst am späten Abend dran“ erzählte Maria Sophia. „Drum hat Adis Abeba noch keine Alarmmeldung losg’schickt, weil gestern Abend ist der Rapport ja noch eing’angen. Ein wengerl schwerfäl… verdammt!“
„Was ist?“ Carl Friedrich Maerz riss sein kurz abgesetztes Glas wieder an die Augen.
„Da unten, da schleicht dieser Ahmad al Massud mit ein paar Leut herum. Und wie G‘fangene schau‘n die jetzt nicht grad aus!“
„Im Ernst? So eine Scheiße!“ Elisabeth von Oberwinden schluchzte beinahe. „Was mach‘n wir denn jetzt? Wir brauch‘n doch das Pulverl für dich, Maria!“
„Nein!“ Maria Sophia atmete tief durch. „Nein, jetzt ist Schluss! Endgültig! Ich spiel‘ nimmer mit und schau mir das auch nicht länger an. Oberst Wilhelm Graf von Inzersmarkt, sind sie bereit, sich weiter meinem Befehl zu unterstellen?“
„Selbstverständlich! Und wenn ich sagen darf, niemals mit mehr Stolz auf mein Herrscherhaus als heute, Hoheit. Verfügen Hoheit über mich und die Dragoner!“
Maria drehte den Kopf und wandte sich an Elisabeth von Oberwinden. „Lisi? Stehs’t du auch hinter mir?“
„Mitzi, ich… Hoheit! Natürlich, Hoheit, gar keine Frage. Bis zum bitteren Ende. Es war mir eine Ehre, deine Hofdame und Freundin g’wesen zu sein, Maria!“ Sie wischte sich über die Augen. „Verdammter Wind mit dem Sand!“
Die Erzherzogin drehte sich um zu Carl Friedrich Maerz. „War nur ein kurzer Spaß mit uns, Scharly, und das tut mir aufrichtig leid. Aber jetzt mach ich Schluss mit dem Scheißspiel. Ein paar hundert unschuldige Leute zu opfern, nur dass wir…, also, dass ich noch ein Monat länger nach dem seiner Pfeif’n tanzen darf, das mag ich nicht und das schaff‘ ich nicht. Jetzt nicht mehr. Wir greifen ein und an, und machen diesem Schweinehund und seine Freunderln fertig. Die soll sehen, dass eine Prinzessin aus dem Haus Habsburg durchaus zu sterben versteht, wer will denn schon ewig leb’n.“
„Mitzi, ich, also, du sollst wissen, ich werd‘ alles dransetz‘n, die Hinterleut‘ von dieser Saloumne und diesem Ahmad zu finden und fertig zu mach’n“ versprach Elisabeth. „Hoffentlich bevor noch jemand zu Schaden kommt!“
„Ich werd‘ die Baronesse dabei unterstütz‘n. Und ein Inzersmarkt hält sein Wort! Immer!“
„Danke, Freunde! Also dann, pack’n wir’s an. Gefechtsbereitschaft herstellen“, befahl die Prinzessin. „Oberst, welches Vorgehen schlagen sie vor?“
„Wir gehen diesen Weg da hinunter, da kommen wir ziemlich unsichtbar in die Neustadt.“ Inzersmarkt gab seine Einweisungen mit ruhiger Stimme. „Dann folgen wir rechts dieser Straße bis vor die Kaserne. Da sollten wir diesen Giftmischer mit seinen sechs Habschis unterwegs aufklauben können. Dann sperren wir die Haderlumpen mit zwei Mann Bewachung und ordentlichen Achtereisen in einem von den Häusern ein und kümmern uns um die Typen in der Garnison. Wir haben drei Leute mit Alpinausbildung, die werden dafür sorgen, dass wir in die Garnison kommen, mit etwas Glück sogar ohne gesehen zu werden. In zwei Stunden brechen die Husaren und der Windhund auf und brechen einfach durch diese Tür, wenn wir sie nicht vorher öffnen.“
„Alles klar, so machen wir’s“, stimmte Maria zu. „Henny, Orville, ihr bleibt‘s im Wagen beim Henry. Lisi, meine Herren, es war sehr schön, es hat mich aufrichtig gefreut, mit euch unterwegs gewesen zu sein. Und jetzt – Abmarsch!“
Die zwanzig Soldaten gingen in einer Reihe den Abhang hinunter, während oben immer noch einige Kammeraden und die Besatzungen der Husaren die Stadt im Auge behielten. Besonders Janos Pospischil hatte seiner Erzherzogin bittere Tränen nachgeweint, jetzt aber war er voll auf seine Aufgabe konzentriert. Unten angekommen teilten sie sich auf und hasteten, möglichst immer in der Deckung der Fassaden bleibend, durch die Straßen, dem Fort der Garnison zu.
„Da müsste dieser Ahmed mit seinen Leuten gleich vorbeikommen. Dann haben wir ihn in der Zange.“ Carl Friedrich Maerz lauschte angestrengt. „Ich höre sie schon kommen! Ich danke Gott für den Oberst Inzersmarkt, der wird wie ein gutes Uhrwerk funktionieren, da wette ich die Tantiemen einer ganzen Auflage darauf!“
„Da halt‘ ich nicht dagegen, Scharly“ bemerkte Maria Sophia. „Mit dem Mann hat uns der Slatin einen wirklich guten Rat geb’n!“
„Achtung, jetzt!“ Von beiden Seiten sprangen die Prinzessin und Maerz mit ihren zehn Dragonern auf die Straße, der Trupp von sieben Arabern stoppte abrupt, wandten sich um und sahen sich Elisabeth von Oberwinden und dem Grafen von Inzersmarkt mit elf Dragonern gegenüber.
„Ah, Prinzessin!“ Ahmad al Masud el Allah ed Dhin trat vor seine Leute und sah Maria Sophia ins Gesicht. „Ihr kommt zu früh, Hoheit! Viel zu früh! Ihr solltet doch erst übermorgen kommen, dann hättet ihr vielleicht auch gleich erfahren, wo sich die Trommel Dans befindet!“
„Warum sollt‘ mich interessier’n, wo eine Trommel von ein paar alten Juden liegt, Achmed, Mohammed oder wie immer du g’rad heissen willst!“ Maria Sophia hatte die Stirn des Mannes genau im Visier. „Und deine Freunde sollten die Waffen hinlegen und in den Himmel greifen, bevor meine Dragoner einen unruhigen Zeigefinger bekommen“, setzte sie in französischer Sprache hinzu, um von allen verstanden zu werden.
„Das wäre aber glatter Mord, Hoheit“, lächelte Ahmend. „Wir sind hier nicht in Wien, wo ihr unbestreitbar einige Befugnisse hättet!“
„Es wäre sogar hier durch eine Nothilfesituation gedeckt, Sindbad, der Lügner“, erklärte Maria. „Aber, nachdem ich schon von euren Terroraktionen gehört und auch die Opfer gesehen hatte, habe ich von Emfraz aus nach Addis Abeba telegraphiert und dort, ja, was soll ich sagen, der Negus Negest hat mich doch glatt zum äthiopischen Yepolīsi Kolonēli, also zum Polizeioberst ernannt. Meine Dragoner sind außerdem als freiwillige Polizeihelfer vereidigt, also – irgendwie vertreten wir jetzt doch das Gesetz in dieser Gegend! Sozusagen mit Brief und Siegel sogar! Also, weg mit den Waffen, die Hände hoch, oder des kracht jetzt ganz gewaltig! Und zwar in die Knie. Wir wollen doch den Henker von Bahir Dar nicht um seine Prämie bringen. Von den Einnahmen vom Verkauf einiger benützter Hanfkrawatten als Amulett ganz zu schweigen. Also, hoch die Hände! Jetzt, sofort!“
„Vergessen Hoheit nicht eine Kleinigkeit?“ fragte Ahmed auf Deutsch.
„Da hat er jetzt aber ein ganz großes Pech, Aladdin“, bedauerte die Erzherzogin ostentativ. „Weil ich nämlich lieber umesteh‘, als dass ich mir da noch länger so ein Gemetzel anschau‘! Da hüpf ich lieber mit ruhigem G‘wissen in den Holzpyjama, stell‘ die Patsch’n auf und schau mir die Erdäpfel von unten an, bevor ich mit einer solchen Schuld weiterleb’n möcht‘. Aber ich versprech‘ ihm, er gehst noch vor mir, und wenn’s des letzte ist, was ich mach‘. Solche Leut‘ wie er und seinesgleichen hab’n auf der Welt nichts verlor’n. Also, kommen wir zu einem End‘.“ Sie hob die Hand. „Gebt…“
„Moment, Hoheit“, gab der Orientale nach. „Bitte, meine Männer legen die Waffen nieder und ergeben sich, wenn ich nachher noch mit euch sprechen kann!“
„Von mir aus, dann hängen euch halt die Abessinier nach einer Gerichtsverhandlung auf. Ist mir auch recht! Also, Fesseln, einsperren und dann weiter!“
Zugsführer Hannes Idinger war ein schlanker, hoch aufgeschossener Mann, gerade Mitte dreißig, einer der drei Soldaten mit einer alpinen Zusatzausbildung. Er war in Tirol aufgewachsen, die Berge vor seiner Haustür, und vertikale Gehwege waren im vertrauter als horizontale. Jetzt warf er nur einen Blick nach oben und holte zwei Steigeisen und zwei Pickel aus seinem Rucksack.
„Dåsch wirrd jetscht ein Schpåß, dåsch ischt jå eine Wånd für’d Kchindrr“ befand der Innsbrucker. „Wenn’sch wenigschtens verreischt wär, åberr so?“
Auch Korporal Weber, der zweite Tiroler, machte sich fertig. „S’sch gchröschte Probleem werd schei, dåsch må unsch nit hörrt!“
„Ihr habt’s ja g’seh’n, die konzentrier‘n sich ganz auf das, was unten g’schicht. Ganz schöne Dodeln, aber uns kann‘s nur recht sein“, meinte Gefreiter Jakob Maria Walzer. Er war ein richtiger Flachlandtiroler gewesen, also, natürlich nicht wirklich aus Tirol, denn dort gibt ja es kaum eine flache Stelle. Aber so nannte man in Kakanien halt jene Leute aus dem Flachland, welche mit Halbschuhen oder Sandalen auf die Berge gehen wollen. Und das vielleicht auch noch, wenn die Einheimischen in ihren Häusern bereits Schutz suchen, weil sie wissen, dass aus dem noch blitzblauen Himmel in weniger als einer Stunde ein heftiges Unwetter kommen kann. Ein Idiot und Besserwisser eben. Walzer war nur ein halber Idiot gewesen. Er wollte eine Bergwanderung machen, seine Lackschuhe waren frisch geputzt, und dann hatte ihn die Kräuterwawerl angesprochen, eine junge Kräutersammlerin, zu der das ganze Dorf in den Dolomiten um Medizin für alles mögliche kam.
„Bleder Bub, wennsch’t iatzat då aufi gehscht, kimmscht nimmer z’ruckch“, hatte sie gerufen. „Nia nimma net! Bleib‘ då, Bua, kimm eina und trinkch a Glaserl mit mir. Wånscht in aner Schtund nu aufi wüllscht, såg ich kein Wort mehr!“ Nun, er hatte das Glas Schnaps angenommen, und eine Viertelstunde später goss es wie aus Kübeln. Also war er noch etwas länger geblieben, hatte gut nachgedacht und sich dann zur Armee gemeldet. Zu den Alpinjägern. Er wurde drei Mal befördert, jedes Mal zum Gefreiten. Dann war das Fernweh gekommen, er hatte um Versetzung zu den Dragonern angesucht und sein Vorgesetzter hatte schneller den Überstellungsbescheid unterzeichnet, als Jakob gedacht hatte. Und hinter dem Abreisenden noch rasch drei Kreuze geschlagen, froh, den Unruhestifter endlich los zu sein.
„Schtimmt scho!“ Idinger kontrollierte noch einmal die Ausrüstung des kleinen Trupps. „Auf geht’sch, Månder! Und zeigt’sch, dass kchane Franzosen und Bayern nit seit’sch.“
„Wås håst denn gegen d‘ Bayern? Wir g’hören immerhin jetzt auch dazu. Sogar die Regentin von Kåkånien ist aine unsrige!“
„Fragscht in Tirrooler oder in Menschen, Passauer“, lachte Idinger, bereits anderthalb Meter hoch hinunter.
„In Kletteråffen!“ krakelte Ludwig Gmeiner aus Passau den Kletterern leise hinterher.
Oben hob der Zugführer vorsichtig seinen Kopf über die Brüstung, er konnte einfach nicht glauben, dass wirklich niemand auf dem Wall Wache stehen sollte. Das war doch die einfachste, die grundlegendste aller militärischen Regeln. Gib immer auf deinen Rücken acht, sonst wird aus dem Jäger ganz schnell ein Gejagter. Idinger vermutete eine Falle, dafür hatte er einen Riecher, und er vertraute darauf. Dort, da war wirklich ein Posten, aber seine Aufmerksamkeit war ausschließlich auf den Hof gerichtet, der Dragoner konnte sein Glück kaum glauben. Ein wenig seitwärts noch, hier über den Wall klettern, ungesehen von dem Posten. Jetzt, ein schneller Sprung, die Hand Idingers legte sich auf Mund und Nase des Postens und erstickte den Schrei des Unvorsichtigen im Ansatz. Der 16 Zentimeter lange und rasiermesserscharfe Kommandodolch des Zugführers durchschnitt die Kehle des in einen Wüstenburnus gekleideten Mannes und setzte seinem Leben völlig lautlos ein Ende. Währenddessen waren auch die beiden Korporäle auf den Wehrgang gekommen, Walzer huschte sofort die Treppe des Torhauses hinunter, um die restliche Truppe einzulassen, während die anderen Beiden ihre Gewehre in Stellung brachten, um von oben im Notfall Feuerschutz geben zu können.
Die Dragonerregimenter der k.u.k. Armee waren keine ausgesprochenen Eliteeinheiten, sie waren per Definition ‚nur‘ berittene Infanterie. Natürlich waren sie in der Praxis schon lange auf die motorisierten Panzerwagen umgestiegen, auch wenn jeder Dragoner noch immer auch eine grundlegende Reitausbildung zu absolvieren hatte. Man konnte ja nie wissen, was im Feld einmal geschehen würde. Allerdings schickten die Dragoner ihre Soldaten nach der Grundausbildung zu anderen Einheiten wie etwa den Alpinjägern oder zur Scharfschützenausbildung in die kaiserliche Fasangartenkaserne. Oder sie besuchten einen Artillerielehrgang in der Kaserne neben dem Schloss Neugebäude, andere lernten mit Booten und kleineren Schiffen umzugehen oder an Landeunternehmen aus Luft- und Flugschiffen teilzunehmen. Es gab keine Supersoldaten in ihren Reihen, die mit jeder Situation fertig wurden und alles konnten. Aber als Einheit waren sie auf beinahe alles vorbereitet.
Nicht vorbereitet waren sie allerdings auf das Bild, das sich ihnen auf dem Exerzierplatz bot. Zwei bärenstarke Männer in bereits blutigen Burnussen hielten einen dritten an dem Armen fest, während ein riesiger Beduine den Kopf des Festgehaltenen an den Haaren in den Nacken zwang und ein krummes Messer an seine Kehle hielt. In der Nähe dieser Gruppe lagen bereits einige Tote mit durchschnittener Kehle in ihrem Blut, Fliegen hatten sich bereits darauf versammelt.
„Also“, rief der Hüne. „Mir macht es nichts aus, einem nach dem anderen von euch allen die Kehle durchzuschneiden! Will mir immer noch niemand sagen, wo die Trommel des Stammes Dan ist? Nein, dann gut!“ Mit einer raschen Bewegung durchschnitt er die Kehle seines Opfers. „Bringt mir als nächstes eine Frau, vielleicht löst das ihre Zungen schneller. Und vielleicht sollten wir auch die Peitsche aus Flusspferdhaut ins Spiel bringen!“ Auf dem Wehrgang erschienen jetzt die Soldaten aus den Donaumonarchien, verteilten sich und brachten ihre Waffen in Anschlag. Dann trat die Prinzessin mit ihrer schweren Pistole in der Hand an die Kante vor und zielte auf den Wortführer.
„Das wäre eine ganz schlechte Idee, Beduine. Es macht mir gar nichts aus, auch Verwundete zu hängen, und du hast wie hier alle, die Wahl zwischen schnell und halbwegs schmerzlos oder erst nach einigen Schmerzen zu hängen. Aber baumeln werdet ihr, das verspreche ich euch!“ Die 23 halbautomatischen Waffen der Kakanier sprachen eine ziemlich deutliche Sprache, auch wenn mehr als 50 Männer auf dem Exerzierplatz standen, so waren sie doch mehr als überrascht. Sechs von den Wüstensöhnen und zwei Europäer versuchten zwar noch, ihre Gewehre in Anschlag zu bringen, aber die Geschoße aus den Rückstoßladern waren schneller und stießen die Männer mit schmerzhaften Treffern in den Schultergelenken zu Boden. Einer der Europäer schüttelte den Kopf und legte sein Gewehr ab.
„Na schön, wir ergeben uns! Also, zumindest ich ergebe mich, es hat ja doch keinen Sinn mehr, jetzt noch zu kämpfen!“ Mit diesen Worten schnallte er seinen Revolvergürtel auf und ließ ihn zu Boden gleiten, ein weiterer folgte seinem Beispiel, dann nach der Reihe alle.
„Oberst Inzersmarkt, sie übernehmen das“, bat Maria. „Sperren sie die Verbrecher irgendwo sicher ein, und geben’s dem Ahmed dann eine eigene Zelle. Eine, wo ich in Ruhe mit ihm reden kann. Aber erst später. Jetzt steht mir der Sinn nach etwas anderem, viel Zeit hab‘ ich ja wohl nicht mehr.“
„Gerne Hoheit! Also, die Europäer und die Araber in die Mitte des Exerzierplatzes, die Dorfbewohner verlassen jetzt die Garnison und gehen draußen beiseite. Es werden gleich ein paar Radpanzer aus den Bergen kommen, die müsst ihr durchlassen. Mayer, nehm‘ er seinen Spiegel und geb er den Husaren Bescheid.“
Die Prinzessin hatte Carl Friedrich Maerz an der Schulter berührt und zum mitkommen aufgefordert. „Komm mit, Scharly. Ich brauch‘ jetzt ein bisserl Trost und Beruhigung, bevor ich bereit bin, mit dem Kerl zu parlieren. Lisi, bitte entschuldige uns, hilfst du dem Oberst? Und sag‘ der Henny, sie soll den Leuten klar mach’n, was los ist. Am besten, die hauen sich für eine Zeitlang ganz über die Häuser, weil es werden ja noch mehr solcher Gruppen in die Gegend kommen, wir hab’n schon d’rüber g’redet. Die anderen sind ja auch nicht blöd, und die Existenz von der Trommel der Danieliten ist ja kein wirkliches Geheimnis.“
„Na, eh klar, geh nur, nutz die Zeit“, antwortete Elisabeth. „Wir kümmern uns um alles.“
„Das werd‘ ich. Komm endlich, Scharly, das ist eine Garnison, da sollt’s ja wohl genug Betten geben“, zog die Prinzessin den Autoren mit sich.
„Bist du sicher, dass du…“ Maerz folgte dem Zug der Erzherzogin etwas zögerlich.
„Ja, verdammt! Ich will – ich möcht‘ doch noch ein wenig Spaß haben, so lange ich’s noch erleb‘. Keusch kann ich dann in der Kapuzinergruft noch lang genug sein, also streng dich ein bisserl an und mach mir gefälligst noch ein paar schöne letzte Stunden!“
=◇=
Ahmed al Massud el Allah ad Dhin saß in einem fensterlosen Raum im Keller der Garnison, eine Wand desselben bestand aus einem durchgehenden Gitter mit der Tür. Zusätzlich hatten die Posten ihn an Armen und Beinen mit Ketten gefesselt, und dass sie dabei nicht zimperlich gewesen waren, zeigten außer den Veilchen unter seinen Augen auch einige andere blaue Flecken.
„Schon allein für das, was du unserer Prinzessin an‘tan hast, könnt‘ ich dich Gfrast mit nassen Fetzen derschlagen“, hatte der Vizeleutnant Smetana den Gefangenen angebrüllt, als er ihn hier in diesen Raum stieß. „Also sei froh, dass du noch Luft verschwenden darfst und halt nur ja dein frechen Schlapf’n, sonst dreh‘ ich dir ein G’wind in Arsch, dass du nachher nur mehr Schrauberln scheisst.“ Der Ägypter hatte all das stoisch über sich ergehen lassen und sich danach an der Wand dem Gitter gegenüber nieder gelassen. Als sich die Tür öffnete und die Erzherzogin durch die Tür in die andere Hälfte der Tür trat, erhob er sich, blieb dem Gitter jedoch fern und musterte sein Gegenüber mit stechenden Blicken. Er sah eine ruhige, stolz aufgerichtete Frau in der sandfarbenen Africauniform Österreichs, das mahagonirote Haar wallte über die Schultern, ihr Blick war unverwandt auf ihn gerichtet. Es lag keine Anspannung oder gar Furcht in ihren Augen oder in ihrer Haltung, und auch die Stimme war ruhig, wenn auch eiskalt.
„Also, red er schon oder scheiß er Buchstaben, ich hab‘ meine Zeit ja nicht g’stohlen. Das war schon er, der mir ein paar Jahre g’nommen hat!“
„Hoheit, es musste sein. Ihr müsst verstehen, dass es nötig war, dass ihr euch mit eurer Sterblichkeit auseinandersetzen musstet! Ihr musstet lernen, dem Tod direkt ins Auge zu blicken, aber ich kann euch versichern, es gibt kein mir bekanntes Gift, welches durch monatliche Einnahme eines Gegenmittels neutralisiert wird. Die einzige Dosis, welche wirklich nötig war, hat euch der Hofarzt in Wien bereits übergeben, und auch dort wäre euer Leben nicht ernsthaft gefährdet gewesen. Wir benötigen euer Hoheit nämlich!“
„Da schau her! Und deswegen schleift er mich durch halb Africa, der Slatin und die Lichtenbach sind tot, ein ganzes Dorf ist zerstört, die Leut‘ umbracht oder verschleppt, kleine Kinder erschossen – aber ich werd‘ jetzt natürlich durch seinen Reifen springen. Weil, er braucht mich ja!“ Maria Sophia schlug mit der Faust gegen das Gitter. „Das klingt, mit Verlaub, als hätt‘ ihm einer in’s Hirn g’schissen! Da fallt‘ das mit’m Gift gar nicht mehr so sehr stark ins G‘wicht!“

„Hoheit, weder der Tod der Tod der Gräfin Lichtenbach noch der des Oberstleutnant Slatin waren eingeplant gewesen“, erklärte Ahmed. „Die Dörfer und dieses Gemetzel gehen auch nicht auf das Konto unseres Ordens, bitte, das müsst ihr mir einfach glauben! Wenn der Orden der Trommelwächter mit diesem alten Artefakt nicht den italienischen Angriff zurück geschlagen hätte, könnten wir uns mit einer unauffälligen Suche sehr viel mehr Zeit nehmen. So müssen wir sie rasch finden, ehe sie der anderen Organisation in die Hände fällt. Jenen Leuten, welche Söldner wie jene da draußen für ihr Sache morden lassen!“
„Ach so, ja, eh klar! Das entschuldigt dann wohl auch das Abschlachten der unschuldigen Leut‘ in den Dörfern der Umgebung?“, echauffierte sich Maria, allerdings blieb ihre Stimme dabei eiskalt. „Ich sag’s ihm ganz ehrlich, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich jetzt grad kotzen möcht‘!“
„Hoheit, wir haben keines dieser Dörfer überfallen“, versuchte Allah ad Dhin seine Schuld abzustreiten. „Alle diese Taten hat der Orden der Yegēt Lijochi, welcher hinter dem Goldenen Frühling steht, zu verantworten, nicht wir. Und ihr müsst an euer Volk…“
„Ja verdammt noch einmal, jeder redet dauernd von meinem Volk!“ Maria Sophia ballte die Rechte zur Faust. „Erstens einmal heißt es schon noch Völker – die Donaumonarchien sind immer noch ein Vielvölkerstaat und stolz d’rauf! Und außerdem sind’s, wenn überhaupt, die Völker vom Franz Rudolph, nicht meine! Ich steh‘ momentan an letzter Stelle der Thronfolge. Auf eigenen Wunsch, wohlgemerkt!“
„Diese Völker sind nicht gemeint, Hoheit, obwohl wir damit rechnen, dass ihr als die Auserwählte auch sie beschirmen werdet!“
„Wovon redet er da?“, fragte Maria erstaunt. „Welche Auserwählte denn? Das ist doch blanker Unsinn!“
„Hoheit stammen aus der Blutlinie des Messias ab“, erklärte Ahmed. „Des Lehrers und Predigers Isa ben Marjam aus dem heiligen Land.“
„Jetzt ist mir alles klar, er g’hört in den Narrenturm am Steinhof g’worfen und bis zu seinem seligen End‘ dort behalten, unter die ganzen ander‘n Wahnsinnigen“, bemerkte Maria und fuhr mit der offenen Hand vor ihrem Gesicht hin und her. „Meine Stammväter hab’n sicher jede Menge Bastard‘ in der ganzen Welt hinterlass‘n, vielleicht, nein, sehr wahrscheinlich auch im heilig‘n Land oder in Ägypten. Aber dass einer eine Frau von dort g’heiratet hätt, wär mir neu. Na ja, vielleicht hat schon eine von den Ehefrauen der Habsburger einmal einen feschen Ägypter oder Israeli als Diener g‘habt und ihn drüber lassen, aber offiziell – nein, da gibt’s nichts!“
„Ich versichere euer Hoheit, es gibt ein untrügliches Zeichen! Ich besitze ein Amulett, welches in der Gegenwart eines Abkömmlings des Lehrers zu leuchten beginnt“, beharrte Ahmed al Massud.
Maria Sophia griff zu einer Schachtel und kippte den Inhalt auf den Tisch. „Da leuchtet aber gar nichts!“
„Gar nichts?“ Ahmed schlurfte mit klirrenden Ketten näher.
„Null, nada, nix!“ Ein Stück nach dem anderen hob die Erzherzogin hoch.
„Das ist das Amulett“, rief Ahmed. „Nicht das geringste Glimmen?“
„Nicht das geringste, also, such er sich gefälligst eine andere Ausrede!“
„Aber Hoheit, ich schwöre…“
„Was ist ein Schwur von einem wie ihm denn schon wert?“ Die abgrundtiefe Verachtung in der Stimme der Prinzessin ließ Ahmed zurück taumeln.
„Aber Hoheit, selbst wenn wir für die Massaker verantwortlich wären, was wir Wächter nicht sind, wäre es nicht besser, wenige sterben, als dass viele stürben?“
„Und wer sucht die wenigen aus?“ Maria spuckte die Worte beinahe aus und verzog angeekelt das Gesicht. „Die Priester, welche damit ihre Macht festigen, indem sie von notwendigen Opfern sprechen, aber seltsamerweise selber nie Schaden nehmen!“
„Ich bin zu jedem…“
Das Öffnen der Tür unterbrach den Ägypter, und ein Gefreiter trat ein und salutierte. „Hoheit, eine Polizeitruppe aus Bahir Dar ist eingetroffen!“
„Danke, Gefreiter. Ich komme hinauf. Keine Sorge, Sindbad al Kadhaab, ich halte mein Wort. Er wird mir schon noch sagen dürfen, was er auf seinem schwarzen Herz‘n hat!“
Der Keller mit den Zellen war nur über eine schmale Treppe mit den restlichen Räumen der Kaserne verbunden und hatte keine Verbindung zu den unter den anderen Gebäude liegenden Vorratskellern der Garnison Gonder. Die Erbauer dieser alten Festung hatten diese Anlage ganz bewusst so angelegt, um ein Entkommen der Gefangenen zu erschweren. Von hier aus hatten ganze Generationen von Fürsten über Abessinien geherrscht, ehe sie Adis Abeba zu ihrer Königsstadt erhoben. Seit ihrer Erbauung war die Garnison restauriert, umgebaut und modernisiert worden, und das mehr als nur einmal. Doch die Zellen und die Treppen blieben. Neue Türen und Schlösser wurden eingebaut, die Zellen mit Gittern und einem Abtritt versehen, die Treppe und das Wachzimmer am oberen Ende wurden kaum angetastet. Auf dem Treppenabsatz musste Maria Sophia kurz stehen bleiben, ihr wurden die Knie weich und sie musste sich kurz an Wand lehnen. Gab es noch Hoffnung, eine Zukunft für sie? Warum sollte der Mann in Bezug auf das Gift lügen? Wenn sie doch am Gift starb, verlängerte er mit der Lüge sein Leben vielleicht um drei, vier Tage. Dann würde er mit einem Strick um den Hals ‚zwischen Himmel und Erde‘ baumeln, wie es Richter gerne immer noch in ihre Urteile schrieben. Sie riss sich nach kurzer Schwäche wieder zusammen, aus der Frau wurde die beherrschte und rationale Erzherzogin.
„Majestät“, wurde Maria Sophia von einem dunkelhäutigen Abessinier in einer blütenweißen Uniformbluse über einer schwarzen Hose mit zwei breiten goldenen Streifen angesprochen, als sie aus dem Wachzimmer trat. „Ich bin Polizeimajor Willem Okomaratu“, salutierte der Mann.
„Sehr gut, Herr Major!“ Die Prinzessin erwiderte den militärischen Gruß, ehe sie ihm die Hand reichte. „Ich würde ja sagen, willkommen, aber eigentlich ist es ja ihr Land. Also, wie lauten ihre Vorschläge?“
Willem Okomaratu zog ein Papier aus der Tasche. „Maria Sophia von Österreich, ich wurde beauftragt, euch diese Bestallung auszuhändigen. Es freut und ehrt mich, dass sie meine Meinung hören wollen, aber sie sind meine Vorgesetzte, kaiserliche Hoheit! Ich unterstelle mich mit meinen 30 Männern ihrem Befehl!“ Die Erzherzogin entfaltete das Papier, es war ihre Bestallungsurkunde mit der Ernennung zum Oberst der abessinischen Polizei.
„Major, ich gedenke mir hier keinerlei Hoheitsrechte anzumaßen“, sagte sie langsam und klopfte mit der wieder zusammen gefalteten Urkunde in ihre linke Hand. „Auch wenn sie sich mir unterstellen, möchte ich sie zuerst einmal über den derzeitigen Stand der Dinge informieren, und dann möchte ich ihre ehrliche Meinung hören. Abgesehen davon, ich hoffe, dass der Bürgermeister, der Staatsanwalt und der Richter sich bald wieder hier einfinden, wenn ihre Polizisten doch bitte einmal durch die Stadt gehen könnten, um die Herren einzuladen? Immerhin sind es ihre Landsleute!“
Der Major salutierte mit nach vorne gedrehter Handfläche wie ein Franzose. „Natürlich, He… – ich meinte natürlich Frau Oberst! Entschuldigen sie bitte!“
„Selbstverständlich“, lächelte die Erzherzogin. „Frauen im militärischen Sektor sind eben immer noch sehr ungewöhnlich. Das wird sich aber noch ändern, glauben sie es mir, Major.“ Maria Sophia blickte kurz auf ihre Armbanduhr, der Major tat es ihr gleich. „Wollen wir uns in – sagen wir einmal dreißig Minuten im Wachzimmer zum Gefängniskeller treffen?“
„Gerne, Frau Oberst! Dreißig Minuten“, bestätigte Major Okomaratu und salutierte kurz.
„Danke, Major. Bis später.“ Maria Sophia erwiderte den Salut, dann wandte sie sich an einen Posten. „Hat eigentlich jemand die Baronesse von Oberwinden gesehen?“
=◇=
„Wer ist das?“ Ahmed hob den Kopf und durchbohrte Willem Okomaratu mit stechenden Blicken.
„Das, Ali Baba, ist der jetzt für Gonder zuständige Polizeimajor“, erklärte Maria Sophia. „Ich habe ihn als Zeugen mitgenommen, er soll ruhig sehen, wer die Dorfbewohner massakriert hat! Und sprech‘ er französisch, damit der Major unserem Gespräch folgen kann!“
„Ich habe Hoheit auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass die Awlad Alrabi nicht über die Trommel Dans verfügen dürfen, da die ganze Menschheit leiden wird, wenn dessen Pläne wahr werden“, beharrte Ahmed auf seinem Standpunkt. „Die Inquisition wird im Vergleich zu den Säuberungen dieser Fanatiker ein laues Lüftchen gewesen sein, und sie wollen die ganze Welt in einen Krieg stürzen, um Jerusalem für den neuen Messias zu erobern! Es wird viel, sehr viel Blut fließen!“
„Und das von jemandem, der wahllos etlichen Dorfbewohner die Kehle durchschneiden hat lassen, Frauen und Kinder einfach erschießen, von den zerstörten Dörfern wollen wir gar nicht reden!“ Die Prinzessin schlug mir der flachen Hand auf ihren Oberschenkel. „Er ist um nichts besser als die Leute vom Frühling und deren Hintermänner, die er so verteufelt!“
„Und ich versichere noch einmal, nichts mit den Massenmorden und den Entführungen zu tun zu haben. Ich bitte sie, fragen sie die Dorfbewohner, wir wollten eben versuchen, den Bewohnern Hilfe zu bringen“, bat Ahmed inständig.
„Oh, das werden wir“, versprach Willem Okomaratu. „Wir sind hier in einem Land, wo Recht und Gesetz herrschen. Wir knüpfen niemand ohne ein rechtsgültiges Urteil auf. Und zu einem solchen gehört auch ein Prozess mit Richter, Geschworenen, Zeugen und Anwälten. Auch sie werden einen Verteidiger bekommen, das verspreche ich ihnen!“
„Es nähert sich jemand! Wer ist es? Das Amulett, sehen sie, Hoheit, es beginnt zu glimmen! So sehen sie doch!“ Der Wekil wurde ganz aufgeregt. „Bitte, so sehen sie doch hin, ich flehe sie an!“
„Tatsächlich! Es beginnt ein wenig zu leuchten! Was ist ihre Meinung, Major? Kann sein, dass ein Stein reagiert, wenn jemand von einer bestimmten Blutlinie in die Nähe kommt?“
„Ich bin überzeugt, Frau Oberst.“ Der Major rieb sich den Nacken. „Ich habe schon davon gehört, ein guter Priester, Rabbiner oder Imam kann solch eine Verbindung herstellen. Wenn er Blut einer Person zur Verfügung hat, wird ein bestimmter Stein die Nachfahren dieser Person erkennen!“
Maria Sophia sah ihm ins Gesicht. „Auch die Blutlinie des Gesalbten Joshua?“
„Also, theoretisch – warum nicht?“ Willem Okomaratu zeigte seine Handflächen. „Wenn damals ein Rabbi Blut vom Lehrer zur Verfügung hatte, sehe ich kein Problem dabei. Ich würde allerdings eine Reaktion dieses Steines nicht wirklich als Beweis sehen, denn wie kann man sicher sein, auf welche Blutlinie der Stein wann geeicht wurde? Vielleicht erst vor zehn Tagen auf die Familie eines beliebigen Ziegenhirten.“
„Ich verstehe! Ja, bitte? Was gibt es, Lisi?“
„Die Gendarmen vom Major haben den Richter aufgetrieben“, rapportierte die Baronesse von Oberwinden. „Er hat sich gerade am Tor der Garnison gemeldet! Was ist denn mit deinem speziellen Freund los, der schaut mich an, als wollte er mich fressen!“
„Haben will er dich wirklich, wenn auch nicht unbedingt verspeisen“, beschied Maria Sophia. „Du musst dir vorstellen, das Amulett soll anzeigen, wenn jemand aus dem – wie haben sie es in Lalibela ausgedrückt? Aus dem Samen Davids, dem Schoss Benjamins und dem Geist Gottes… also kurz und gut gesagt, das Ding soll zeigen, dass du vom Lehrer abstammst.“
„Witzig!“ Elisabeth lachte laut. „Aber, na ja, also wenn ich mich recht erinnere – 1461 hat ja einer meiner Ahnen wirklich aus Alexandria eine christlich getaufte Mamelukin geholt und geheiratet. Das war damals unter dem dritten Kaiser Friedrich. Die Männer von meiner Familie haben halt schon immer für exotische Frauen geschwärmt. Meine Mutter ist ja das beste Beispiel dafür!“
„Soll ich jetzt Euer Heiligkeit zu dir sagen“, schmunzelte die Erzherzogin.
„Gesalbte Befreierin, wenn schon“, grinste Lisi zurück. „Glaubst du, ich begnüge mich mit dem Stellvertreter, wenn ich der Chef sein kann?“
Ahmed war auf die Knie gesunken. „Auserwählte, mein Leben gehört dir allein, ich unterwerfe mich dir!“
„Ein guter Versuch, aber das funktioniert so nicht, verdammtes Connard“, Elisabeth von Oberwinden schlug gegen das Gitter. „Meine Treue gehört meiner Prinzessin, und du wirst uns nicht auseinander bringen können. Selbst wenn ich vom Lehrer abstammen sollte, macht das für mich überhaupt keinen Unterschied. Ich habe keine Ambitionen, ins Herrscher- oder Messiasgeschäft einzusteigen. Gar keine!“ Elisabeth ging vor der Erzherzogin das Knie und beugte das Haupt. „Hiermit erneuere ich meinen Lehenseid als Erbin der Baronie Oberwinden dem Haus Österreich gegenüber und gelobe der Erzherzogin und Prinzessin Marie Sophia, die hier in Vertretung meines Lehensherrn steht, meine absolute Treue und Loyalität, solange ich lebe!“
„Das ist mir aber so was von klar gewesen, Lisi!“ Maria zog die Baronesse in die Höhe und umarmte sie. „Ich habe doch nie auch nur eine Sekunde an dir gezweifelt. Weder an der Treue der Baronesse an den Donaumonarchien noch an der von meiner besten Freundin mir gegenüber! Aber“, wandte sie sich wieder an Ahmed. „Selbst wenn das alles stimmen sollte – warum sucht euer Orden denn jetzt grad in Österreich eine Nachkommin aus der Blutlinie des Lehrers? Habt ihr denn keine eigene mehr?“
„Saloumne, die große Mutter, kann die heiligen Artefakte nicht benutzen. In ihr ist zu viel Zweifel an ihrer Mission und vor allem an ihren Fähigkeiten.“ Ahmed kniete immer noch, jetzt senkte er den Kopf bis zum Boden. „Daher, Hoheit, ich flehe euch an, überlasst uns die Auserwählte!“
„Was bildet er sich denn eigentlich ein“, schrie ihn die Baronesse aufgebracht an. „Glaubt er denn, ich bin ein Pferd oder ein Hund, den man einfach hergibt? Merk er sich, ich gehöre mir und entscheide selber über meine Treue! Such er sich eine andere Auserwählte, bevor ich wütend werde. Denn das, so viel kann ich versprechen, das wird ihm nicht gefallen. Überhaupt nicht!“
„Er hat es gehört, Sindbad Albahaar“, bemerkte Maria Sophia mit einer abschließenden Handbewegung. „Wir machen jetzt einmal Pause. Wenn Major Willem Okomaratu einverstanden ist, werden wir dann erst einmal die anderen Verbrecher verhören, vor allem die Europäer und den Oberscheich der Beduinen. Gehen wir!“
Sudan
Das in den Staatsfarben des französischen Kaiserreiches, also mit blauem Bug, weißer Mitte und rotem Heck gehaltene Luftschiff AIGLE schwebte in langsamer Fahrt über dem Nil und näherte sich am 15. April 1889 gemeinsam mit dem schweren Kreuzer-leichter-als-Luft JEANNE D’ARC dem österreichischen Fort Dinka am weißen Nil. Fort Dinka war eine neue Siedlung etwa 1.200 Kilometer Luftlinie von Khartoum oder 2.800 von Kairo direkt nach Süden entfernt, die Windungen des Nil machten allerdings etwa das doppelte oder eher noch mehr an Flusskilometern daraus. Das Fort war 1867 als Zwischenstation für den Flugverkehr nach Südafrica entstanden, dieses Mal aber nicht bei einer bereits existierenden Stadt. Es gab einfach im Sudan südlich Khartums zu dieser Zeit keine größeren Ortschaften am Nil, also hatte die ÖDLAG einfach einen passenden Platz am Flussufer ausgewählt, ihn den Engländern und den hier ansässigen Stämmen abgekauft und eine veritable Festung an das westliche Ufer des Nil gebaut, ein ziemlich regelmäßiges Sechseck mit einer Fläche von fast einem halben Quadratkilometer. Sechs Bastionen und ebenfalls sechs Raveline trugen die Artillerie, welche sowohl gegen Angriffe von Land, vom Wasser oder aus der Luft ausgelegt war. Auch der Luft- und der Flusshafen der Österreicher waren gut durch Bastionen geschützte Anlagen, welche natürlich Schiffen und Luftschiffen aller Länder zur Benützung offen standen. Das Fort war nach einem der größten dort ansässigen Stämme benannt und hatte in den zweiundzwanzig Jahren seiner Existenz bereits einige Siedler aus den verschiedensten Ländern angelockt, welche sich in geringer Entfernung zur Festung etwas stromaufwärts angesiedelt hatten. Der bereits hier lebende britische Abenteurer und Großwildjäger Henri Haggerty Ryder, dessen Haus auf Stelzen gleich neben dem Fort der k.u.k. Garnison erbaut war, hatte die Siedler dazu überredet, ihre Ortschaft ebenfalls zu befestigen. Da aus den nördlicher gelegenen Kalifaten immer wieder vom Mahdi sanktionierte Sklavenjäger auftauchten, war eine starke Verteidigungsanlage kein Luxus, und nun konnten beide Festungen einander im Ernstfall unterstützen. Die ÖDLAG hatte den Siedlern zu diesem Zweck auch einige leichte Infanteriekanonen samt Munition günstig überlassen. Es waren sogar relativ moderne Hinterlader mit gezogenem Rohr und langem Rücklauf. Im Hinterland der beiden Festungen weideten die Rinder der Dinka, hier hatten die Österreicher als Bezahlung für das Land der Festung eine Be- und Entwässerungsanlage gebaut und schützten das Dorf nicht nur vor Überfällen von Sklavenjägern, sondern sorgten auch mit Gegenständen des täglichen Bedarfes wie Nähnadeln, Scheren und Metallgeschirr, aber auch mit Messern und Gewehren für ein zumindest etwas besseres Leben des hier ortsansässigen Stammes. Allerdings galten die Dinka rechtlich gesehen nicht als Österreicher, sondern nur als Vertragspartner, denn ausschließlich die Festung war von den Briten, denen das Land offiziell gehörte, als österreichisches Hoheitsgebiet mit allen Rechten anerkannt. Trotzdem hatte ein österreichischer ökumenischer Missionar eine Schule eröffnet. Von Montag bis Freitag brachte er jedem Lernwilligen lesen, schreiben und rechnen bei, am Sonntag wurde das Gebäude zur Kirche. Mann muss allerdings auch dazu sagen, dass die Dinka mehr an der Bildung als am Wort Gottes interessiert waren.
Hier im Fort Dinka endete auch das Kabel des Grafen Wilczek und begann erst wieder runde 3.500 Kilometer südwestlich in Windhuk, von wo dann die Verbindung bis nach Südafrica reichte. Das Königreich Neuhochadlerstein war leider ebenfalls noch nicht an das europäische Telegraphennetz angeschlossen, ebenso Madagaskar. Zwischen Dinka und Windhuk beziehungsweise Neuhochadlerstein gab es zwar einige starke Forts, damit es im Falle eines Falles eine Zwischenstation für die Luftschiffe gab, die man für eventuelle Reparaturen und Ergänzung diverser Verbrauchsgüter anlaufen konnte. Die Nachrichtenverbindung zu diesen Festungen verlief jedoch ausschließlich über schnelle Avisoluftschiffe. Diese waren relativ klein, schnell und wendig, konnten aber außer ihrer Besatzung kaum Last befördern. Auch die Nachrichten zwischen Windhuk und Fort Dinka wurden von diesen Schiffen überbracht, die reine Flugzeit der 150 Stundenkilometer schnellen Kleinluftschiffen betrug beinahe 24 Stunden. Derzeit gab es leider keine schnellere Nachrichtenübermittlung vom und zum Südende Africas, und alle dort vertretenen Mächte vertrauten den schnellen, zuverlässigen Postschiffen der ÖDLAG ihre Depeschen an. Noch musste der umständliche Weg eingeschlagen werden, aber Heinrich Hertz war 1888 bereits die drahtlose Übertragung eines Signals über ganze 10 Meter gelungen, im Januar 1889 hatte er die Reichweite bereits auf beinahe einen Kilometer erhöhen können. Es stand also zu hoffen, dass die Lücken in den Kabelverbindungen bald geschlossen werden konnten. Mit den Hertz‘schen Wellen.
=◇=
Als die AIGLE näher kam, fiel der Brückenbesatzung am Nil die spezielle Hafenkonstruktion der Festung sofort ins Auge. Flussaufwärts war aus kristallinem Stahl und Beton ein breiter Pier zum Schutz des Hafens vor Schwemmgut während der Regenzeiten weit in den Fluss gebaut, davor brachen sich die Wellen an einer Aufschüttung, welche mit entsprechenden Wehrbauten an Ort und Stelle gehalten wurde. Gut geschützt schwammen dahinter die Anlegestellen, welche gut vertäut an der Kaimauer lagen und über bewegliche Rampen mit dieser verbunden waren. Einige britische Flussdampfer, Patrouillenboote der Kaimanklasse mit etwa 80 Meter Länge, dümpelten an den schwimmenden Molen, durch das Kalifat des Mahdi von Ägypten abgeschnitten. Mehr als eines dieser flachgehenden Schiffe war den Aufständischen bei einem Durchbruchsversuch bereits zum Opfer gefallen, jetzt hatten sie den Befehl erhalten, hier bis zum Gegenangriff auszuharren. Ihre Verpflegung ließ sich die Londoner Regierung einiges kosten, denn es musste alles entweder durch gesegelte und geruderte Nilboote oder aber von österreichischen Luftschiffen geliefert werden. Die Sudanesen des Mahdi hatten klar zu verstehen gegeben, dass englische Segel- und Ruderschiffe den Nil im Sudan passieren durften, bewaffnete Schiffe oder solche mit Dampfantrieb jedoch Freiwild waren. Und der Premierminister Robert Gascoyne-Cecil beugte sich dieser Forderung. Zumindest im Moment noch.
„Endlich wieder ein winziges Stück Zivilisation, Capitaine,“ freute sich François Louis, der Dauphin von Frankreich stand auf der Brücke und betrachtete die näher kommende Festung. „Auch wenn die AIGLE ja wirklich keinen Luxus vermissen lässt, aussteigen, die Beine vertreten, einige Stunden nicht die monotonen Geräusche der Papin-Motore hören. Frische Luft und nicht alles von oben sehen. Mon Dieu, ich bin ein Kavallerist, kein Flieger.“
„Mon Capitaine, wir sollen den roten Anlegemast nehmen!“ Signalgast Claude Tresivant hatte die Lichtsignale des Hafens gesehen und entziffert.
„Rudergänger, sie haben es gehört. Roter Mast!“

Seit vielen Tagen war die AIGLE dem Nil südwärts gefolgt und hatte jedes stromauffahrende Schiff überprüft.
„Ab hier suchen wir keine Dhau mehr, mon Dauphin“, hatte Capitaine de Rougeville eines Tages gesagt. „Wir nähern uns den Katarakten, hier können Dhaus nur noch in den Monaten der Überschwemmungen verkehren.“ Der Prinz hatte dann auch mit Atrá darüber gesprochen. Er vertraute dem Kapitän aus den canadischen Provinzen zwar, aber eine zweite Meinung war immer gut.
„Das stimmt“, bestätigte die Alexandrinerin. „Üblicherweise wird hier in Assuan die Ware in Dahabijes oder Noquer umgeladen, die dann auch noch den Nil noch sehr viel weiter nach Süden über Khartum hinaus passieren können. Früher war es auch möglich, mit den flachen Raddampfern der Briten und Österreicher bis nach Fort Dinka zu reisen, aber jetzt hat das Kalifat etwas dagegen. Also wird der Handelsverkehr wie früher mit Segel und Ruder abgewickelt!“
François hatte gestöhnt. „Wir können doch nicht jedes kleine Boot untersuchen. Das dauert ja ewig!“ Trotzdem hatten sie sich die stromauf fahrenden Nilboote angesehen, aber selbstverständlich erst, wenn diese die Stromschnellen überwunden hatten. Sie hatten natürlich nie jemand aus dem Gefolge der Erzherzogin oder gar sie selbst gefunden. Wie denn auch, wenn sich diese Gruppe mehr als hundert Lieues metrique weiter im Osten befand. François Louis Jean Napoleon Bonaparte war kein sehr geduldiger Mensch, er hatte es nie gelernt. Nie lernen müssen. In seiner Stellung als kaiserlicher Thronfolger Frankreichs hatte er nie lange auf die Erfüllung seiner Wünsche warten müssen, egal welcher Art sie auch sein mochten. So war es denn kein Wunder, dass er nach der elften erfolglosen Durchsuchung einer Dahabije ungeduldig wurde und die Untersuchung der offenen Feluken und Noquer ausschließlich seiner Mannschaft überließ. Doch sie fanden nicht einmal ein für den Sklavenhandel ausgerüstetes Schiff. Obwohl – bei dem einen oder anderen Flussfahrzeug hätte ein erfahrener Verbrecherjäger schon vielleicht misstrauisch werden können, aber diese Erfahrung fehlte der Besatzung der AIGLE nun einmal komplett. Sie waren gute Luftschiffer, die mit Unwettern und Motorschäden gut zurecht kamen. Und es waren einige gute Elitesoldaten zum Schutz des kaiserlichen Gastes an Bord. Aber niemand, der auch nur die geringste Ahnung vom Menschenhandel hatte. Oder auch nur haben wollte, denn was die Africaner am Nil machten, war den Franzosen ziemlich egal. Probleme ergaben sich bei den Unternehmungen nicht, die Sahibi Alsafina hatten sich der Untersuchung friedlich unterworfen, wenn das große Luftschiff aus dem Himmel sank und ihnen den Weg nach Süden versperrte. Damit hatten wohl auch die drei ziemlich gut sichtbaren Kanonen auf jeder Seite der AIGLE und später auch jene der JEANNE D’ARC zu tun, auch wenn sie ostentativ von den Nilbooten weggeschwenkt waren. Jeder konnte aber genau sehen, dass sich dieser Umstand auch ganz schnell ändern konnte, und die teilweise schon alten Schiffe mit den riesigen Segeln hätten selbstverständlich nicht die geringste Chance gegen die modernen Luftschiffe gehabt. Vor allem, weil ihnen jegliche Artillerie fehlte, und mit einem Gewehr nach einem solchen Tragkörper zu schießen, war absolut sinnlos. Um dem Auftriebskörper fühlbaren Schaden zufügen zu können, hätten schon einige Maxim-Gewehre einige Zeit im Dauerfeuer schießen müssen. Dennoch jagte eine Enttäuschung die nächste, und es wurde immer schwieriger, den Prinzen auch nur halbwegs bei Laune zu halten. Atrá wusste ein Liedchen davon zu singen. Sie bereute es bereits, sich selbst der Sache angenommen und es nicht ihrer Agentin Yasmin in Kairo überlassen zu haben. So hatte sie auch beschlossen, die AIGLE in Fort Dinka zu verlassen, eine Passage auf einem der Flugschiffe der ÖDLAG konnte sie sich immer noch leisten. Sie hatte auch schon jemand an Bord der AIGLE vom Traum des Frühlings überzeugen können, und dieser Mann würde im Ernstfall schon in ihrem Sinne zu handeln wissen. Hoffentlich!
Um der Wahrheit die Ehre zu geben, auch François Louis war der schönen Ägypterin bereits überdrüssig und wartete nur darauf, sie bald von Bord zu haben. Selbst wenn kein Ersatz vorhanden war, denn in oder bei Fort Dinka mochte es Bordelle geben, aber keine halbwegs längerfristige Gesellschaft für einen Dauphin. Egal, er konnte auf dem Rückweg die Geschwindigkeit der AIGLE ausnützen und in forcierter Fahrt nach Frankreich zurück kehren. Er würde einfach seiner Mutter mitteilen, dass Guilaume de Froid mit der JEANNE D’ARC die Suche fortsetzen würde, während er nach Paris flog. 5.620 Kilometer, das schaffte die Aigle mit forciertem Flug in nicht einmal ganz zwei Tagen, vielleicht drei, wenn er in Tunis sicherheitshalber einen Zwischenstopp einlegte. Und dann, das Moulin Rouge, das Casino de Paris, das Folies Bergère. Die besten Damen der Stadt, die Crème ihrer Profession, hatten die Erlaubnis erhalten, in angemessener Kleidung im Promenoir des Folies zu lustwandeln. Sie mussten frisch gewaschen sein, für diese hochklassigen Professionellen ohnehin eine Selbstverständlichkeit, und sich offensiver Offerte enthalten, doch aufforderndes Nicken war erlaubt. Die Damen und ihre Kunden entwickelten rasch einen dezent wirkenden, aber eindeutigen Zeichencode. Kein großartiges Gerede, ein Nicken, ein Hochziehen der Augenbrauen, für eine Sekunde die Zungenspitze sehen lassen, und der Eingeweihte wusste Bescheid. Und eingeweiht waren seit der Eröffnung des Folies Bergère 1869 alle Herren ab etwa fünfzehn. So mancher der heutigen Ehemänner hatte hier seine erste Erfahrungen gesammelt, während der Herr Papa, der die Sache eingefädelt hatte, sich nebenan mit einer Kollegin verlustierte. Endlich wieder Zivilisation, er, der Prinz, der Dauphin, der künftige Kaiser, er war einfach nicht für das große Abenteuer gemacht. Auch die Aktivitäten mit Atrá konnten hier keine Abhilfe mehr schaffen, allmählich kannte er all ihre Künste, ihr Aussehen bis zum Abwinken. Es wurde wieder einmal Zeit für eine Abwechslung, und wenn es nur die billigste Nutte im Hafenbordell war. Vielleicht keine schlechte Idee, ordinär und gewöhnlich, oder möglicherweise eine dunkelhäutige Gazelle. Ganz egal, der Dauphin wünschte endlich wieder einmal Abwechslung in seinem Alltag.
Und so, nachdem die AIGLE am roten und die JEANNE D’ARC am gelben Mast angelegt hatten, brachte er die nötigen Formalitäten wie das Abschreiten der Ehrengarde so rasch wie möglich hinter sich.
„Colonel Waldček, ich würde sie bitten, meinem Adjutanten Major de Milfort freien Zugang zu ihrer Telegraphenstation zu gewähren“, wandte er sich an den Kommandanten der österreichischen Garnison. Dieser verneigte sich militärisch kurz.
„Selbstverständlich, Hoheit“, antwortete Oberst Nepomuk Johannes Waldček, und auch François Louis Napoleon nickte zufrieden.
„Und Colonel“, die Lautstärke des Dauphin sank nur unwesentlich, es war ihm völlig egal, was diese Boches von ihm denken mochten. „Kann man sich hier vielleicht auch etwas vergnügen?“
„Unsere Militärkapelle sind zwar nicht die Wiener Philharmoniker, aber…“
„Ich meinte etwas weniger schöngeistige Vergnügungen, Colonel. Nicht der Esprit des Dauphins, sondern der Bite verlangt nach Spaß und Vergnügen. Gibt es hier ein Bouffeé?“
„Nun, ja, das gibt es tatsächlich, aber bin nicht wirklich sicher, ob es für den Dauphin Frankreichs das…“
„Wild, ungezügelt, hemmungslos? Primitiv und ohne große Ansprüche?“
„Das trifft es in etwa“, gab der Oberst zu. „Damen werden sie bei uns in diesem Etablissement kaum finden!“
„Dann ist es für diesem Moment genau das Richtige für meinen kleinen Prinzen. Entschuldigen sie mich, Colonel!“ Der Dauphin verbeugte sich kurz, ehe er sich auf den Weg machte.
=◇=
Der mit einer dunkelgrünen Schürze und einem Weinheber ausgestattete schwarze Läufer schlug den weißen Bauern, der eine dralle Schankmaid mit hervorquellendem Busen über einem Teller Schweinsbraten mit Knödel und Kraut darstellte.
„Dieser junge Bonaparte ist der beste Beweis, dass man eine Familie aus der Gosse, aber die Gosse nicht aus der Familie bringen kann.“ Oberst Nepomuk Johannes Graf von Waldček stellte die geschlagene Figur beiseite.
Henri Ryder Haggerty lachte auf. „Wie lange ist es her, dass ihre Familie einen Pflug hinter einem Pferdearsch hergeschoben hat, Nepomuk?“
„Das war noch nie der Fall, mein lieber Henri! Niemals“, widersprach der Graf ruhig.
„Niemals, Nepomuk?“, fragte Henri erstaunt.
„Nein, wirklich, niemals“, verkündete Nepomuk mit todernstem Gesicht. „In unserer Gegend waren es nämlich Ochsenärsche!“
Henri Ryder wieherte laut auf. „Okay, ihr habt also Ochsen an Stelle von Pferden zum pflügen verwendet! Aber sonst stimmt es doch, oder?“
„Ich denke, so ein paar hundert Jahre wird es schon her sein, dass meine Ahnen lieber in den öffentlichen Dienst gegangen sind“, bekannte der Oberst. „Zumindest seit dem späten Mittelalter, nach dem gigantischen Haufen von scharfem Metallspielzeug, dass sich bei uns zu Hause angesammelt hat.“
„Und, hast du die Gosse wirklich erfolgreich abgelegt?“ Henri ergriff einen als Geiger geschnitzten Bauern und stellte ihn ein Feld weiter vorne wieder ab.
„Natürlich nicht ganz! Wenn der kleine Oberst stramm steht, dann möchte er verständlicherweise auch nicht immer die Frau Oberst besuchen. Vor allem dann, wenn die Frau Oberst gar keine Lust auf einen solchen Empfang hat oder gerade lieber auf einem anderen Ball tanzt.“ Waldček schlug den Geiger mit einer jungen Tänzerin im steirischen Dirndl, ebenfalls ein Bauer. „Aber ich knöpfe mir doch nicht schon hier drinnen die Hose auf und lasse den Oberst gleich da im Salon, sondern erst an Ort und Stelle heraus. Diskret natürlich, und wenn ich einen von diesen jungen Leutnants von und zu Irgendwas erwische, dass er über eines der Mädchen lockere Sprüche führt, dann werden die Boys vergattert. Wie man bei uns sagt – nach Strich und Faden.“
Henri Ryder Haggerty zog mit seiner Dame, einem hübschen, schlanken Mädchen mit Fächer und einem Diadem im Haar. „Ich weiß. Aber, Nepomuk, ich habe auch keinen Titel!“
„Das beweist, dass ich richtig liege. Du hast keinen amtlichen Rang und trotzdem bist du ein Gentleman durch und durch. Zumindest hier im Fort und in Gesellschaft!“ Waldček spielte mit einem Läufer in Gestalt eines Jägers im eleganten Steireranzuges, dann setzte er ihn ab.
„Danke für die Einschränkung. Da draußen im Dschungel ist es nicht unbedingt von Vorteil, ein Gentleman zu sein. Um so mehr bemühe ich mich, wenn ich hier bin, zumindest einen zu spielen.“ Ryder zog einen Turm, welcher wie ein Weinfass aussah. „Und du bist matt, Nepomuk.“
„Was?“ Der Graf betrachtete die Stellung auf das Eingehendste. „Wirklich! Da hast du mir eine teuflische Falle gestellt, und ich bin blind wie ein Maulwurf hineingetappt. Gratuliere, Henri, gut gespielt!“
„Danke, Nepomuk. Wenn man bedenkt, dass ich noch nie ein Schachspiel in der Hand hatte, als ich zum ersten Mal hier ankam!“
„Stimmt. Eine ganz beachtliche Entwicklung!“ Der Oberst ging zur Anrichte und goss sich einen Fingerbreit Whiskey in einen großen Schwenker. „Für dich auch einen?“
„Ja, gerne. Auch etwas, von dem ich keine Ahnung hatte.“ Henri nahm sein Glas entgegen und schnupperte an dem feinen Bouquet. „Ich dachte immer, Whisky muss man eiskalt trinken, möglichst schnell, bevor er zu warm wird!“
„Vielleicht den billigen Fusel aus England oder gar den Kolonien“, spöttelte Waldček, der seinerseits das zarte Aroma genoss. „Bei gutem Irischen ist das ein Verbrechen, ja, sogar ein Sakrileg! Eine Zigarre?“ Oberst Waldček hielt Henri Ryder ein hölzernes Kistchen mit Zigarren entgegen, in dessen Deckel ein draller Frauenakt im Halbrelief geschnitzt war.
„Von den echten handgerollten Cubanischen? Natürlich, vielen Dank!“ Die Herren pafften, bis der Tabak zu ihrer Zufriedenheit glühte.
„Von Hand auf dem Oberschenkel einer Jungfrau gerollt! Das gibt ein besonders würziges Aroma im Nachgeschmack“, gab sich Waldček weltmännisch.
„Tatsächlich?“ Ryder betrachtete erstaunt seine Zigarre, vom Eingang kam eine belustigte Frauenstimme. „Glauben sie ihm bloß kein Wort davon, Henri. Schönen Abend, die Herren!“
„Guten Abend, Gabriela!“ Der Oberst erhob sich, legte seine Zigarre in den Aschenbecher und küsste seine Frau. „Ich hoffe, wir beide haben dich nicht gestört.“
„Nein, überhaupt nicht, ich war noch draußen auf dem Nil. Mit der Feluke, um genau zu sein, die Zugsführer Makatsch und Mayer haben mich ein wenig hinüber gesegelt, zu einer der Inseln am anderen Ufer, und da habe ich noch den Sonnenuntergang bewundert und die Abendkühle genossen. Dank sei Gott für die Moskitonetze über den Booten, ohne die wäre ein solcher Ausflug eine Qual, aber mit ihnen ein wahres Labsal!“
Auch Henri Ryder hatte sich erhoben und küsste nun die dargereichte Hand. „Wie wahr, meine teuerste Gabriela. Eine abendliche Nilfahrt hat ihre ganz eigenen Reize!“
„Dem stimme ich absolut zu“, lächelte Frau Oberst. „Wenn das Licht so rötlich und weich wird, auf dem Wasser diese Straße aus Licht entsteht und man die Boote und das Ufer nur nach als Schattenriss sieht! Es ist einfach herrlich! Vielleicht möchten sie mich einmal statt der Zugführer begleiten?“
„Einen Sherry, meine Liebe?“ Nepomuk war an die Anrichte getreten.
„Ach, nein danke, mein Lieber. Ich hätte gerne ein Glas von deinem Whiskey. Danke dir schön!“ Die nicht mehr junge, aber attraktive und sportliche Frau ließ sich in einem Fauteuil nieder, schlug die Beine übereinander, wobei sie erfreulich wohlgeformte Waden sehen ließ und nahm ihr Glas entgegen.
„Warum soll ich ihrem Mann denn nun nicht glauben, Gabriela?“, kam Henri auf ihre Aussage von vorhin zurück.
„Weil das mit den Oberschenkeln und der Jungfrau nur ein Märchen ist, welches man auf Cuba den Touristen gerne erzählt“, lachte der Graf. „Dann glauben sie es und bezahlen das doppelte, weil sie sich weiß Gott etwas davon versprechen.“
„Wahrscheinlich sind eure Zigarren von einer zahnlosen Negeroma gerollt worden, die froh über das wenige Geld war, das sie damit verdient hat! Auf einem Tisch, nicht auf dem Oberschenkel, wohlgemerkt.“ Gabriela schnupperte. „Hat dir Colonel Fitzmallon-Conderol-Smythe endlich wieder einmal eine Kiste geschickt? Köstlich, dieser frische Duft. Unverwechselbar.“
„Er hat tatsächlich wieder einige Flaschen übersandt, meine Liebe. Ein treuer Freund. Aber diese Zigarren haben keine Neger- oder Indioomas gerollt, wenn schon, dann Maoriomas oder -Opas. Sie kommen aus Māoiland.“
„So? Alle Achtung, den scharfen Geruch haben sie jetzt endlich wirklich gut wegbekommen. Wie steht es mit dem Geschmack?“
„Nun, Henri hat mir das Märchen von den Cubanischen abgekauft. Möchtest du kosten?“
Vorsichtig nahm Gabriela Waldček die dicke Tabakrolle an ihre Lippen und sog daran. „Steht den echten aus Cuba nicht nach. Da kann man den Leuten nur ein großes Kompliment aussprechen. Wo ist denn der Dauphin? Immer noch im Rivers End beim…?“ Sie deutete eine eindeutige Geste an.
„Immer noch. Man könnte meinen, es gäbe gar keine andere Beschäftigung mehr für ihn. Sein Major wollte ihm vorhin eine ganz wichtige Mitteilung machen, aber sein Herr und Meister hat ihn nur durch die geschlossene Tür angebrüllt, er solle gefälligst wieder verschwinden. Sofort. Vite, vite!“ Oberst Waldček rollte ein winziges Schlückchen des Whiskeys über die Zunge.
„Und, was war es für eine Nachricht?“ Ryder blickte durch das mit einem Moskitonetz bespannte große offene Fenster über den nächtlichen Nil. Das Empfangszimmer des Obersts lag weit oben und nahe der flussseitigen Mauer, sodass er einen schönen Ausblick genießen konnte.
„Keine Ahnung, sie kam in einem Code, den wir noch nicht kennen“, antwortete Nepomuk harmlos, der Brite lachte laut auf.
„Wenn dein Leutnant Marschik nicht schon an der Decodierung arbeitet…“
„Natürlich arbeitet der schon mit Hochdruck daran. Es wird halt trotzdem noch ein wenig dauern!“
=◇=
Direkt neben der Festung, in der Deckung der Geschütze, stand das Haus Henri Haggarty Ryders, und neben diesem hatte ein findiger Schotte eine Bar mit Restaurant und einigen Zimmern gebaut. Jason MacDome schimpfte zwar tagaus, tagein über das Wetter, über die Hitze, über die Dinkas und überhaupt über ganz Africa. Trotzdem war er noch immer hier und betrieb das Lokal weiter. Das Haus war früher einmal sehr gut besucht gewesen, zu jener Zeit, als noch jede Menge Schiffe den Nil befuhren, der Handel blühte und Passagiere auch einmal die grünen Ufer des weißen Nils bestaunen wollten. Das Rivers End als Bordell bezeichnen zu wollen, wäre allerdings übertrieben gewesen und auch an den Umständen vorbei gegangen. Es war einfach ein Hotel, in welchem man nicht nach dem Gepäck fragte und auf Wunsch eben auch schon einmal Stundenweise abrechnete. In der Bar trieben sich immer wieder Mädchen herum, zumeist Dinkas, Bari oder manchmal auch europäische Frauen, die irgend ein seltsames Geschick hierher verschlagen hatte. An diesen letzten Außenposten, beinahe an das Ende der Welt, welche man zivilisiert zu nennen pflegte. Niemand fragte diese Frauen, warum sie hier waren, wie sie hierher gekommen waren und wie es ihnen bei ihrer Arbeit erging. Sie waren da, das genügte den Männern der Garnison ebenso wie den englischen Matrosen und den Männern in der Siedlung. Man legte einfach einige Münzen auf den Tisch, wenn man ein Kopfschütteln erntete, legte man solange Geldstücke dazu, bis aus dem Schütteln ein Nicken wurde. Dann ging man auf eines der Zimmer und – nun, es geschah dann eben. Der gleich nebenan wohnende Henri Haggerty Ryder hatte eine ganz einfache Sichtweise auf diese Prostitution. Er hatte nichts dagegen, wenn eine Frau ihren Körper anbot und dafür Geschenke nahm, auch, wenn diese Zuwendungen monetär waren. Aber er hatte ein großes Problem mit Zuhältern, die Frauen oft mit roher Gewalt zu dieser Tätigkeit zwangen. Er konnte solche Männer einfach auf den Tod nicht ausstehen. Als einmal ein Mann im Rivers End die Jungfräulichkeit seiner Tochter meistbietend versteigern wollte, hatte Henri ihn einfach mit nach draußen genommen, ihn bewusstlos geschlagen und mit einem Seil an einem Ast des nächsten Baumes aufgeknüpft. Ganz formlos, ohne Trommelwirbel oder Verlesung des Urteils. Dann hatte er den Oberst Waldček gebeten, ob der nicht für das arme, verängstigte Kind etwas tun könnte. Das Mädchen Roberta ‚Bobby‘ Lee Bowers wuchs danach im Haushalt der Waldčeks als deren geliebte Nichte auf und den Eheleuten schon bald sehr ans Herz. Aus dem verschüchterten kleinen Ding wurde im Verlauf einiger Jahre eine selbstbewusste junge Dame, deren blonder Schopf im weiten Umkreis bekannt und beliebt war.
Das richtige, das ausgesprochene Bordell für die Soldaten und Unteroffiziere von Fort Dinka befand sich in der Festung, und hier war die Armee der Arbeitgeber. Also die Vereinigten Donaumonarchien. Interessierte Damen des einschlägigen Gewerbes sollten sich einer Annonce in verschiedenen Zeitungen nach in Kasernen in ganz Kakanien zum Dienst an den Soldaten des Vaterlandes melden, und sie meldeten sich ausreichend. Es war zwar vielleicht nicht die beste Arbeit, welche die Vereinigten Donaumonarchien anzubieten hatten, aber sie wurde doch relativ gut bezahlt. Nach dem Beamtenschema der Klasse B, worauf der Volksmund sofort die ‚Bienchenklasse‘ daraus machte. Zu der Bezahlung kamen wöchentliche ärztliche Untersuchungen, eine geregelte Arbeitszeit, Urlaubs- und Pensionsanspruch, freie Kost und Logis während eines Einsatzes in einer Garnison im Ausland und ihre Kunden wurden stichprobenartig vorher auf Sauberkeit untersucht – ein Soldat, solange er nicht im Feld, sondern in der Kaserne war, sollte ohnehin stets sauber und gewaschen sein. In der Eingangshalle der k.u.k. Dienststelle für Soldatenbetreuung waren Dienstleistungs- und Preislisten ausgelegt, der Soldat wählte die Art seiner Wünsche und kreuzte dieselben auf Formblatt 263b/78 an, steckte das Billett in ein Kuvert, das er in einen entsprechenden Korb mit dem Namen der erwählten Grazie legte. Dann trug sich für einen Termin am Kalender der Dame ein, der am schwarzen Brett des Gebäudes hing. So konnte er sicher sein, dass die entsprechende auserwählte Liebesdienerin für ihn bereit war, wenn er bei ihr eintraf. Sauber, parfümiert und bereits über etwaige besondere Wünsche informiert. Der Vorteil dieser Handhabung war, dass es keine halb verhungerten, ungewaschene Mädchen mit den schlimmsten denkbaren Geschlechtskrankheiten in schmutzigen, verlausten Absteigen gab, die ihren Lohn lieber für Rauschgift ausgaben.

Und natürlich, dass diese Frauen ihren Lohn auch wirklich regelmäßig selbst erhielten und nicht gezwungen waren, das Geld an einen ‚Beschützer‘ abzuliefern. Dafür mussten sie sich aber auch wie jeder andere Beamte der Donaumonarchien einer regelmäßigen Evaluierung stellen, etwa einmal jedes Halbjahr lag ein Fragebogen auf. Formblatt 1.294/P der Verwaltungsdienststelle Staatsdienst II b. Das Heeresamt hatte sich der Erkenntnis gestellt, dass es ohne spezielle Truppenbetreuung auf Dauer nicht ging, und hatte auf den Ausspruch des Kaisers Franz Karl ‚Wir sollt’n Beamte hab’n, die den jungen Buben in ihrer Not helfen‘ wörtlich reagiert. Mit durchschlagendem Erfolg, die Gesundheit der Soldaten war nie besser, da die ganzen Geschlechtskrankheiten weg fielen, und die Moral der Armeeangehörigen litt auch nicht eben darunter. Es war halt irgendwie wieder einmal eine typisch österreichische Herangehensweise – man löst ein Problem halt gerne mit Bürokratie und verbeamteten Leuten.
Dieses Etablissement hatte der Oberst dem französischen Dauphin allerdings mit Bedacht unterschlagen, denn der geregelte Ablauf der Dienststelle sollte nach Möglichkeit nicht gestört werden. Wenn sich etwa Schütze Müller A. bereits eine Woche vorher für die Johanna S. mit den dicken Dingern eingetragen hatte, dann sollte er sich auch darauf verlassen können, dass dieser Besuch zustande kam und nicht diesem reichen und hochnäsigen Franzosen den Vortritt lassen müssen. Also musste François Louis die Festung verlassen und das Rivers End aufsuchen. Als er in seiner Uniform des Pariser Garderegiments das Lokal betrat, sprang ein bereits etwas angeheiterter britischer Matrose von einem der Marineboote im Hafen hinten an der Bar von seinem Hocker auf.
„Three Cheers for the Queen“, brüllte er mit bereits schwerer Zunge. Ein dreifaches, aber leises „Hipp hipp hooray“ der Anwesenden war die Antwort, dann wandten sich alle lieber wieder ihren Gläsern zu. Sie waren hier, um sich zu amüsieren, nicht um etwaige patriotische Gefühle auszudrücken. Die meisten waren noch nicht einmal aus Britannien, sondern ein wilder Haufen Abenteurer aus aller Herren Länder, welche hier ein neues Leben aufbauen wollten, nachdem sie vor dem Mahdi geflohen waren. Aber nicht nur die englischen Matrosen von den Flussbooten hatten in den Toast ihres Kameraden geantwortet, sondern auch die Neusiedler, man lebte immerhin auf englischem Boden, also hatte man verdammt noch mal auch so etwas wie Brite zu sein. Übertreiben musste man es allerdings auch nicht unbedingt.
„Cognac“, bestellte François Louis bei Jason Mac Dome. Der nickte, zog unter der Theke eine verstaubte Flasche hervor und goss von der Flüssigkeit in einen Schwenker. „Mon Ami, ich trinke gerne mit dir auf deine Königin“, wandte er sich an den eifrigen Rufer von vorhin, sein Englisch war beinahe akzentlos. „Aber dann trinkst du mit mir auf den Kaiser von Frankreich!“
„Äh….“
„Auf Queen Victoria, möge sie noch lange leben“, hob François sein Glas und stürzte es hinunter. „Einen Cognac für jeden hier, der auf Karl Joseph Napoleon Bonaparte IV und seine bezaubernde Gattin Roxane Solange trinken möchte!“ Die Gäste des Rivers End ließen sich nicht zwei Mal bitten. Der Franzose hatte gezeigt, dass er bereit war, Britannien und der Queen Victoria seine Ehre zu erweisen, also warum nicht auch umgekehrt. Der letzte Krieg gegeneinander lag schon einige Zeit zurück, auf der Krim und in China war man Seite an Seite marschiert, und wenn dann auch noch ein Glas Cognac dabei heraussprang, konnte man schon den französischen Kaiser einmal hochleben lassen. Die sechzehn anwesenden Männer hoben ihr Glas dem Dauphin entgegen.
„Auf Charles und Roxane!“
Jetzt erst nahm sich François die Zeit, sich in dem großen Raum umzusehen. In der Mitte waren zwei Billardtische, einer für Pool, einer für Karambol aufgestellt, derzeit waren beide unbenützt. Etwa 40 Tische standen mit je vier Stühlen verwaist umher, denn die wenigen anwesenden Männer saßen eher an der Bar und stierten in ihre Gläser, unterhielten sich mit ihren Nachbarn oder hatten sich umgedreht und sahen zwei Mädchen zu, die eng umschlungen zu der Musik einer Schallplatte auf dem Grammophon in einer Ecke tanzten. Eines dieser Mädchen hatte die bei den Dinkas nicht unübliche pechschwarze Haut, sie war groß, maß beinahe zwei Meter, und war gertenschlank, eine Erscheinung, das Gesicht von der Natur ebenmäßig und schön modelliert. Die glänzend weißen Zähne setzten einen starken Kontrast zu ihren dunklen, nur leicht aufgeworfenen Lippen, die Haare waren zu kleinen Löckchen gedreht, ein Panther, eine Wildkatze, bei deren Anblick François der Atem stockte. Das andere tanzende Mädchen war etwas hellhäutiger, kleiner und zeigte wesentlich größere Rundungen. Es war ein lasziver, langsamer Tanz, der dem Franzosen die Schweißperlen auf die Stirne trieb und seine Hose zu eng werden ließ. Besonders, weil die Bekleidung beider Frauen nur aus einer Art buntem Poncho aus leichtem Stoff bestand, der um die Hüfte mit einer Schnur zusammen gebunden war und so den Händen der Tänzerinnen ungehinderten Zugang zum Körper der jeweils anderen erlaubte. Und dabei auch immer wieder dem Auge des Zuseher ganz erfreuliche Anblicke freilegten. Es dauerte gar nicht lange, und der Dauphin holte zwei Napoleon d’Or aus der Tasche und zeigte sie in der Luft her. Die große, geschmeidige Gazelle nickte ihm zu, löste sich von ihrer Tanzpartnerin und schritt als erste der Frauen mit einem geheimnisvollen Lächeln auf den Franzosen zu. Dass die anderen sechs Frauen im Raum ihr auf dem Fuß folgten, sah er zuerst nicht einmal, so sehr nahm diese eine Frau seine Sinne gefangen.
„Du hast dir viel vorgenommen!“ Ihr Englisch war für den Dauphin recht gut verständlich, auch wenn es einen gewissen Akzent hatte. „Bist du denn ein Schneider, der sieben auf einen Streich möchte?“
„Was? Warum?“ Der Prinz bekam große Augen. „Oh, dieses deutsche Märchen, jetzt fällt es mir wieder ein! Nein, ich bin kein Schneider, sondern der Dauphin von Frankreich!“
„Was ist denn das, ein Dofő?“ Aus ihrer Höhe sah die große Frau sogar auf den Prinzen herab und strich mit ihrem langen Zeigefinger seine Stirn und Nase entlang, zum Kinn über Hals und tiefer, der Prinz fühlte sich plötzlich wie gelähmt.
„Äh, ich soll einmal das Reich meines Vaters erben“, stotterte François, die Gazelle lächelte und nickte, nahm seine Hände und führte diese unter ihr Gewand.
„Ich verstehe, du bist der Sohn eines großen Häuptlings! Jetzt ist mir auch klar, warum du uns alle sieben haben willst! So sind die großen Könige, eine Frau ist ihnen nie genug!“ Die Rundungen der Frau schmeichelten sich in die Hände des Franzosen, der, obschon kein Neuling auf diesem Gebiet, nun noch etwas mehr durcheinander kam, besonders als sich ihre Hand ganz ungeniert auf die Beule in seiner Hose legte. Irgendwie verwirrte diese Frau mit ihrer ganzen Ausstrahlung, ihrer ruhigen, bestimmenden Selbstverständlichkeit seine Sinne.
„Hast du ein Zimmer“, forschte er mit trockenem Gaumen.
„Wenn ich eines brauche… Jason?“, wandte sie sich fragend an den Schotten.
„Na klar, mein kleiner Panther. Für dich doch immer. He, Franzose, möchtest du noch eine Flasche Rotwein auf das Zimmer?“
„Champagner?“, fragte François hoffnungsvoll.
„Tut mir leid“, schüttelte Jason den Kopf. „Wird zu schnell warm in dieser Gegend. Das hier ist nicht Paris, weißt du!“
„Wie wahr“, seufzte François. „Andererseits – nein, ich kann mich bei diesen Prinzessinnen wirklich nicht beschweren. Gut, Rotwein. Bordeaux?“
„Saint Laurent aus der Gegend von Wien. Ich beziehe die meisten von meinen Sachen von den Österreichern, das ist günstiger.“
„Also gut“, ergab sich François seinem Schicksal. „Ich wollte es wild, ungezügelt und ordinär, jetzt habe ich es. Also kommt, ihr sieben Grazien, verwöhnt zumindest ihr den großen Häuptling, wenn schon sein Gaumen zu kurz kommt!“
=◇=
„Madame, es – es tut mir aufrichtig leid, dass es so enden muss!“ Caitaine Phillipe de Rougeville salutierte. „Wollen sie die AIGLE wirklich hier in der Mitte von Nirgendwo verlassen? Ich bin sicher, seiner Hoheit wäre es ein Vergnügen…!“
„Nicht mehr, Capitaine. Und ich gestehe, mir auch nicht mehr.“ Atrá bint Selina war mit einer kleinen Reisetasche und einem Schirm in den Ausstiegsraum der AIGLE gekommen und zupfte ihre dünnen Zwirnhandschuhe zurecht. „Wenn sie die Güte hätten, mein Gepäck zumindest in die Halle des Hafens bringen zu lassen, von dort werde ich wohl jemand engagieren können. Sobald ich weiß, wo ich die Nacht verbringen kann.“
„Madame, es gibt bei jedem Flugschiffhafen der ÖDLAG auch ein kleines Hotel für Durchgangsreisende.“ Der Kapitän verbeugte sich vor der Alexandrinerin. „Nicht immer sehr luxuriös, aber für einige Tage sicher jedermann zumutbar. Bequeme und saubere Betten, dazu angemessene Verpflegung. Wenn sie bitte den Matrosen Marvelin und Simenon folgen wollen, wenn sie mit ihren Effekten eintreffen, die beiden Herren werden sie bis zu ihrem Appartement begleiten.“
„Zu gütig, Capitaine. Sie verkörpern ganz das Bild des Chevalier! Ich möchte ihnen noch viel Glück auf ihrer Reise wünschen!“
„Danke, Madame. Auch für sie viel Glück!“ Der Kapitän küsste noch einmal Atrás dargebotene Hand.
Das Hotel war wirklich wie von dem Kapitän beschrieben, nicht übermäßig luxuriös, und es fehlte an Pomp und Glorie. Doch Atrá erhielt ein Zimmer, dem zwar goldbestickte Damastvorhänge fehlten, dafür waren aber die Fenster mit feinster Gaze bespannt, welche die unangenehmen Stechmücken fern hielten und frische Luft ins Zimmer ließen. Ein Deckenventilator sorgte für ein wenig Abkühlung in dem nicht übermäßig großen Raum, und das Bett war, wie von Kapitän de Rougeville angekündigt, zumindest sauber und gemütlich. Es gab fließend Warm- und Kaltwasser, eine Dusche und als Krönung des Luxus ein Bidet. Durfte man hier am A – am Ende der Welt denn mehr verlangen? Das nächste Passagierluftschiff sollte in zwei Tagen seine Fahrt von hier über Khartum nach Kairo antreten, und Madame Troudeaut hatte ihr Ticket bereits in der Tasche. Seufzend setzte sie sich auf das Bett. Das war es wohl gewesen, sie hatte einen schlimmen Fehler gemacht. Sie war sich so sicher gewesen, den Dauphin um ihren Finger wickeln zu können. Es war ihr dann doch nicht komplett gelungen, und in den letzten Tagen war er ihr wieder völlig entglitten. Jetzt musste sich mit ihrem Versagen eben abfinden, was nicht ganz leicht für die vom Erfolg verwöhnte Frau war. Doch immerhin hatte sie geschafft, jetzt einen Agenten an Bord der AIGLE zu haben. Jemand, der bei Madaleine de Carteille bereits Frühlingsluft geschnuppert hatte und nun durch Atrá endgültig ein treuer Anhänger des Ordens geworden war. Bedachtsam zog sich Atrá die Handschuhe von den Fingern, schlüpfte aus ihrem Kostüm und trat unter die Dusche. Weg mit den letzten Tagen, weg mit den negativen Gedanken. Sie hielt ihr Gesicht in den heißen Wasserstrahl, spülte ganz bewusst ihren Frust und die Enttäuschung der letzten Tage von sich ab. Dann, ein Griff zum Wasserhahn, eiskaltes Wasser prasselte auf Atrá bint Selina nieder, erfrischte sie und weckte auch ihren Geist wieder zu neuem Leben. Morgen würde sie das Telegraphenbureau aufsuchen und nach Alexandria drahten, wo sie war, und wann sie nach Hause zu kommen gedachte. Nach der Dusche fühlte sie sich wieder weit besser, gut genug, um sich hübsch zu machen und das Restaurant aufzusuchen.
Verglichen mit der französischen war die österreichische Küche recht einfach. Schmackhaft, aber ohne große Raffinesse. Diese Erfahrung sah die Alexandrinerin nun bestätigt, die Küche an Bord der AIGLE würde sie wohl am meisten vermissen. Der Koch an Bord war ein wahrer Meister seiner Profession, und Atrá durchaus eine Freundin guten Essens. Auch, wenn sie von schlanker Figur war. Sie würde sich eben wieder an die übliche Kost gewöhnen müssen, sowohl in Alexandrien als auch in Kairo gab es überwiegend Beduinenkost oder bereits sehr stark anglisierte Küche. Im Vergleich dazu war das hier ganz bestimmt noch geradezu das Paradies. Die gefüllten Eier als Vorspeise waren nicht übel gewesen, die Suppe eine einfache Rinderbrühe mit zerschnittenen Palatschinken, welche auf der Menükarte als Frittaten firmierten. Aber das Huhn mit Paprika auf ungarische Weise, mit Sauerrahm verfeinert, tröstete sie ein wenig über den Verlust der Kreationen von Maître Albert Bocaise hinweg. Der Provenzale hatte stets für jeden an Bord ein kleines Häppchen bereit gehabt, manchmal süß, manchmal pikant, eine kleine, kalte Köstlichkeit.
Es war ihr durchaus bewusst, dass der Herr einige Tische weiter nicht zufällig und zu seinem Vergnügen hier speiste, auch wenn ihm das Menu durchaus zu munden schien. Aber alles an der Haltung, der Frisur, des Habitus schrie laut ‚Militär‘, auch wie er ganz ostentativ nie in ihre Richtung blickte. Ein Fähnrich, schätzte sie dem Alter nach, kaum mehr. Einerseits amüsierten sie die Bemühungen des Jungen, andererseits war sie schon ein wenig in ihrer Eitelkeit gekränkt. War sie nur einen Fähnrich wert? Einen Knaben ohne Erfahrung? Der Hafer begann sie wieder zu stechen, und nach dem letzten Gang, ein wenig Ziegenkäse mit Honig-Dressing, nahm sie ihr Sektglas und trat an den Tisch des jungen Mannes, der sofort auf die Beine sprang.
„Darf ich, Fähnrich?“ Forsch stellte sie sich vor einen der Stühle, so dass dem Offizier nichts anderes übrig blieb, als mit einer Verbeugung sein Einverständnis auszudrücken und ihr den Sessel zurecht zu rücken. Dann schlug er knallend die Haken zusammen und klappte in der Mitte zusammen.
„Mit ihrer Erlaubnis, Madame, mein Name ist Friedrich Johann Stiegwitz, Fähnrich beim königlich sächsischem Leibregiment Friedrich August III. Darf ich Madame fragen, ob sie einen Wunsch hat?“
„Oh ja, Fähnrich, den habe ich, aber vorher nehmen sie doch bitte wieder Platz. Mein Name ist Atrá Troudeaut.“
„Wenn es mir möglich ist, werde ich ihnen gerne behilflich sein!“ Der junge Soldat hatte sich wieder gesetzt.
„Als erstes könnten sie uns noch eine Flasche von diesem Schlumberger Sekt bestellen. Er schmeckt überraschend gut. Und dann erklären sie mir, warum sie mich die ganze Zeit anstarren!“
„Oh, sie haben es bemerkt!“ Der Fähnrich errötete bis über beide Ohren. „Sie müssen mir glauben, Madame Troudeaut, ich wollte nicht aufdringlich sein, es ist nur – sie sind eine schöne Frau, Madame. Eine sehr schöne. Schon seit langem habe ich keine – entschuldigen sie, das ist ungehörig. Wissen sie, ich komme eben mit einem Aviso-Luftschiff aus Deutsch-Ostafrica und soll von hier das turnusmäßige Schiff nach Hause nehmen, welches in zwei Tagen fährt. Und in meiner letzten Garnison waren wir in der Mitte von Nichts, keine Menschen, wenige Tiere, die einzige Abwechslung war die Nachschubslieferung einmal im Monat. Entschuldigen sie bitte noch einmal!“
Atrá Troudeaut überlegte. „Damit sind sie entschuldigt, Fähnrich. Wollen sie noch ein wenig sitzen bleiben und mit mir plaudern?“
„Mit dem allergrößten Vergnügen, Madame!“
„Und sehen sie mich dabei ruhig an, Fähnrich.“ Atrá bint Selina lachte launig. „Es wäre sehr unhöflich, bei unserem Geplauder an mir vorbei zu sehen!“
=◇=
Am späten Morgen des 16. April 1889 kehrte François Louis Jean Napoleon Bonaparte vergnügt und rundum zufrieden gestellt an Bord der AIGLE zurück.
„Guten Morgen, mein Prinz.“ Chef d‘Escadron Comte Richard de Milfort begrüßte ihn am Einstieg.
„Den wünsche ich ihnen auch, Commandant. Wie ich sehe, ist die JEANNE D’ARC bereits unterwegs!“ Der Dauphin gähnte ungeniert. „Wir sollten uns die Zeit nehmen, damit sie ebenfalls ein wenig Dampf bei den Frauen ablassen können. Sie sehen so verspannt aus!“
„Die JEANNE D’ARC ist bereits unterwegs auf dem Weg nach Paris, Hoheit“, meldete der Adjutant.
„Nach Paris“ platzte der Dauphin heraus. „Warum das denn, verdammt noch mal? Sie sollte doch diese kakanische Vache“suchen!“
„La Princesse Marie Sophie ist wieder aufgetaucht, Hoheit!“ Der Major legte François Louis Jean mehrere bereits entschlüsselte Depeschen vor. „Die Sureté International hat Telegramme gefunden, welche das Signet der Prinzessin tragen, das letzte Mal aus Lalibela in Abessinien. Die Prinzessin hat sich auf eigenen Wunsch an die letzte Stelle der Thronfolge stufen lassen, trotzdem möchte der Kaiser, dass ihr nach Abessinien fliegt und der Dame endlich den Hof macht. Eine Rückstufung kann immerhin auch wieder Rückgängig gemacht werden, besonders wenn der Plebs es wünscht. Und la Pincesse heroine ist in den gesamten Donaumonarchien sehr beliebt!“
„Der Kaiser wünscht, dass ich…?“
„Selbstverständlich, Hoheit. Die Depesche ist in seinem Namen gezeichnet!“
„Natürlich. Gut, gehorchen wir ma Mère, Commandant. Sagen sie bitte dem Capitaine, er möge Kurs auf Lalibela setzen!“
„Jawohl, votre Altesse imperiale. Wir haben nur auf auch Euch gewartet!“ Er wandte sich an den wartenden Matrosen. „Verschrauben sie die Tür, Matelot!“ Danach griff er nach einem Sprachrohr. „Seine Hoheit ist an Bord, Capitaine. Sie können die Leinen losmachen. Kurs wie besprochen auf Lalibela.“
„Verstanden! Kurs Lalibela!“
Die mächtige AIGLE zog die Halteleinen, welche sie an Ort und Stelle gehalten hatten, nach dem Lösen von den Ankermasten mit den motorisierten Winden in die Bug- und Hecksektionen, die Rotoren wurden geschwenkt und trieben den beinahe schwerelosen Körper nach oben. Kleine Propeller im Bug und Heck trimmten den Körper aus und verhinderten ein abdriften nach den Seiten. Der große zigarrenförmige Körper stieg langsam in Höhe, drehte die Nase nach Nordosten und entfernte sich gemächlich von Fort Dinka. In ihrem Zimmer stand Atrá bint Selina am Fenster und sah dem Luftschiff noch einige Zeit nach. Kurz wunderte sie sich, dass die AIGLE nicht dem Fluss folgte, dann hörte sie ein Geräusch hinter sich.
„Guten Morgen, mein strammer Fahnenjunker!“ Lächelnd drehte sie sich um. Nach dem Zwischenspiel mit dem nur auf seinen eigenen Spaß bedachten Franzosen war der junge, gelehrige Deutsche eine wahre Erholung, welcher auch der Alexandrinerin ihre Freude zu bereiten verstand. Und seiner späteren Frau würde es sicher nicht schaden, wenn der Knabe nicht ganz unerfahren in die Ehe ging! „Wie schön, der Mast ist ja schon aufgerichtet, da können wir doch direkt eine morgendliche Flaggenparade abhalten!“
=◇=
Abessinien
Auf dem abessinischen Hochland wurde es nach Sonnenuntergang zu dieser Jahreszeit immer noch rasch ziemlich kühl. Vier Tage waren die italienischen Soldaten bereits den Wagenspuren gefolgt, am Afrera-See vorbei und bei Hara Gebeya auf die Handelsstraße treffend. Dabei hatten sie allmählich aufgeholt, die Dampfwagen vor ihnen schienen es nicht sonderlich eilig zu haben. Jetzt schlichen sie in der Dunkelheit den Handelsweg entlang, weiter vorne hatten sie den Schein eines Feuers gesehen.
„Diavolo“, flüsterte Capitano Michele di Fouccini. „Das ist ein britisches Expeditionsfahrzeug und britische Uniformen. Sind wir etwa die ganze Zeit der falschen Spur gefolgt?“
„Eher sind die Tommies auf der gleichen Fährte wie wir“, wisperte Lugotenente Palamazzo. „Es wäre doch seltsam, wenn wir die einzigen wären, die hinter dem Instrument her sind.“
„Dann müssen wir sie aus dem Weg räumen, die Trommel muss in italienischen Besitz geraten“, raunte der Maggiore. „Unbedingt. Ich sehe da drüben fünf Personen. Legt die Gewehre an.“ Ein gellender Pfiff zerriss die Stille, und plötzlich waren die Briten wie vom Erdboden verschwunden, seitwärts stach eine Feuerlanze nach den Italienern, die Kugel winselte jedoch als Querschläger in den Himmel, ohne mehr als einen Fels zu treffen. Eine Salve aus sieben Gewehren antwortete dem Schuss des Postens, aus der Nähe des Wagens donnerten die Schüsse der Lee-Enfield-Karabiner.
=◇=
„Herr Hauptmann, da vorn‘ gibt es e Feuergefecht, da schieße zwee Parteie ofeenander.“ Der erfahrene Söldner Leutnant Alfred Dengler weckte Siegfried Krause aus seinem Schlummer.
„Wer?“
„Also, siche bin ich mir nich, Haupdmann, aber es klinged ganz nach Fucile Carcano im 8,5 Millimede Kalibe, und die andere könnte Lee-Enfield mit 7,6 Millimede sei. Also Idaliene gegen Englände, sechs bis acht uf jede Seid!“
Der Söldnerhauptmann nickte. „Sollen wir nachsehen?“
„Wär‘ scho nichd schlechd, Herr Haupdmann. Wir sollde scho Bescheid wisse. Ich hab den Feldwebel Duschek mit zwei Soldade vorgeschickd, zum Lage peile!“ Krause schüttelte die Stiefel sorgfältig aus, ehe er hineinfuhr. Er hatte schon gehört, dass sich manchmal unwillkommene Gäste in dem leeren Schuhwerk breit machten, und wirklich fiel ein Skorpion aus dem Schuh, den Dengler rasch zertrat.
„Misdvieche“, fluchte der Leutnant. „Ich hass die Dinge, die habe mir scho zwee gude Kamerade kosded. Ware aber auch zu blöd, ihre Sdiefel auszuschüdde!“ Nachdem Krause in seine Knobelbecher geschlüpft war, band er sich den Koppel mit der Mauser-Pistole um und setzte die Mütze auf.
„Gehen wir!“
„Also, Fräuleins, ihr habd de Haupdmann geheerd! Uf die Beene und vorwärds, ohne Dridd marsch!“ Der Aufbruch und der Marsch der Truppe ging beinahe geräuschlos vor sich, während seiner langen Gespräche in der Söldnerstadt bei Josephshafen hatte der Agent des preußischen Geheimdienstes gute, erfahrene Männer vorgemerkt. Er selbst besaß eigentlich keine Felderfahrung, daher hatte er sich einen guten Stellvertreter angeheuert und verließ sich bei taktischen Überlegungen sehr stark auf Leutnant Dengler. Zu Recht, denn der Leutnant hatte jene Erfahrungen gesammelt, welche ihm abgingen.
Rund um den Rover der Briten war eben eine kleine Feuerpause eingetreten.
„Zum Teufel, wer schießt denn da auf uns“, fluchte Captain McIvor von seiner Stellung unter dem Wagen, der neben ihm liegende Sergeant Dunker versuchte die Dunkelheit mit seinen Blicken zu durchdringen.
„Das klingt wie die .335er von den Italienern, Sir. Aber vielleicht haben die Abessinier auch einen Posten von denen gekauft.“
„Vielleicht auch versprengte Spagettifresser von den Baylul-Truppen?“ Auch Corporal O’Monnebran lag unter seinem Dreiachser.
„Ich glaube das eher, und die haben wahrscheinlich genau den gleichen Auftrag wie wir bekommen, Jungs. Wir haben uns zu sicher gefühlt, und jetzt – jetzt löffeln wir eben diese verdammt heiße Suppe aus.“ Master Sergeant Poacher erkannte mehr instinktiv eine Bewegung in der Nähe, als er sie sah, er zog den Webley aus dem Holster und schoss auf einen Schatten, der darauf hin zu Boden sank. Sofort konzentrierte sich das Feuer aus drei Gewehren wieder auf sein Versteck, ein feuriger Schmerz zog eine Spur wie ein Peitschenhieb über seinen Rücken und ließ den Unteroffizier schmerzhaft aufstöhnen.
Vizeleutnant Luigi Palamazzo lag gemeinsam mit Caporale Riccardo Mentretti hinter einem großen Fels in guter Deckung und zielte links an dem Brocken vorbei, ganz ruhig und konzentriert. Als erfahrener Unteroffizier wusste er nur zu gut, dass auch das eigene Feuer die Sicht stark beeinträchtigte, daher hielt er die Augen geschlossen und wartete, bis das Feuer wieder einschlief. Dann zielte er sorgfältig auf eine ihm verdächtig erscheinende Stelle, hielt den Atem an und zog den Abzug durch. Die anvisierte Stelle war zu dessen Unglück der Kopf von Private John Kerry, welcher sofort verstarb. Sofort duckte sich der Lugotenente wieder hinter seine Deckung, doch der Caporale neben ihm hatte sich zu weit vorgewagt. Die Kugel aus einem Lee-Enfield Karabiner drang durch seine linke Schulter bis zum Herzen vor.
Als endlich die Dunkelheit wich, konnten die sich näher schleichenden deutschen Söldner das Ergebnis des nächtlichen Feuergefechtes erkennen. Ein italienischer Maggiore und ein Lugotenente trugen einige Leichen an eine Stelle, wo ein Soldato eben dabei war, Schutt und Geröll heran zu schaffen und diese zu einem Grab zu drapieren. Ein toter Capitano, ein Sergente, ein Caporale und zwei italienische Soldaten, dazu noch sieben Briten, es musste ein großes Grab werden. Hauptmann Krause stupste seinen Leutnant an und hob fragend die Brauen. Alfred Dengler überlegte nicht lange, er nickte kurz und verständigte sich mit seinen Leuten über taktische Handzeichen. Am Ende lagen alle sieben Italiener einträchtig neben den sieben Briten, während die deutschen Söldner noch mehr Steine für ein noch größeres Grab heranschafften.
„Das driffds sich gud, Hauptmann, de Rove gibd e gudes Kommandofahrzeug ab. Und wir habe edwas mehr Platz in de andere Wage, wenn wir weiterfahre!“
„Kehren wir zu unseren eigenen Dampfkraftwagen zurück, Leutnant. Und dann machen wir noch ein wenig Rast. Die Ausrüstung nehmen wir mit, und die Pferde auch.“
=◇=
Gonder
An der Tür zu jenem Zimmer, in dem ihre kaiserliche Hoheit, Prinzessin Maria Sophia, in der Garnison von Gonder ihr Lager aufgeschlagen hatte, klopfte es hektisch.
„Hoheit! Sind Hoheit anwesend, bitte?“
„JA“, ertönte es ein wenig echauffiert von innen. „Was ist denn jetzt wieder los?“
„Die AIGLE ist im Anflug auf Gonder, kaiserliche Hoheit“, meldete der Soldat vor der Tür.
„Schon? Ja, wie lang‘ hab‘ ich denn g’schlafen?“
„Hoheit haben sich vor knapp sieben Stunden zurück gezogen“, rapportierte der Dragoner.
„Na schön!“ Selbst durch die Tür Maria Sophias war Gähnen zu hören. „Geb‘ er doch der Baroness‘ von Oberwind‘n und dem Oberst von Inzersmarkt Bescheid, sie soll‘n doch bitte den Prinzen beschäftig‘n, bis ich fertig bin.“ Die Tür ging auf, und die Prinzessin stand in eine weiße Dschellaba aus den Beständen der Kaserne gehüllt vor dem Gefreiten Karl Herbst. „Sag er der Baronesse, dass ich noch g’schwind unter die Dusch‘ geh‘ und dann komm‘!“
Herbst salutierte. „Zu Befehl, kaiserliche Hoheit.“
„Abtreten, Gefreiter!“
„Dann ist es jetzt also soweit!“ Maerz kam nackt aus dem toten Winkel hinter der Tür hervor. „Ich hoffe, er geht auf den Plan ein, den du mit deiner Mutter ausgeheckt hast, Mary!“
„Das hoff‘ ich auch, Scharly!“ Sie schlang ihre Arme um seinen Nacken. „Gib‘ mir noch ein ordentlich‘s Bussel, und dann flitz‘ ich g’schwind in die Duschräume.“ Nach einem ausgiebigen Kuss löste sich die Prinzessin aus der Umarmung. „Legst du mir bitte noch eine frische Uniform heraus, bevor du gehst?“
„Zu Befehl, Frau Generaloberst!“ Carl Friedrich Maerz salutierte forsch!
„So ist’s brav, Scharly. Immer fesch stramm stehen. Schad‘, dass wir jetzt so gar keine Zeit mehr dafür hab‘n!“
Während die AIGLE von den schwenkbaren Rotoren dem Boden entgegen gezogen wurde und sich einige Mannschaften bereit machten, das Luftschiff am Boden behelfsmäßig zu verankern, warteten die Baronesse von Oberwinden und der Graf von Inzersmarkt in der leichten Africauniform der kakanischen Truppen auf den Dauphin.
„Die zwei Silbersterne auf goldenem Grund stehen ihnen hervorragend, Frau Oberstleutnant!“ Inzersmarkt sah lächelnd gerade voraus.
„Sie wiss’n aber schon, dass das nur ein Rang ehrenhalber ist, oder?“ Irgendwie misstrauisch betrachtete Elisabeth von Oberwinden ihre Schultern. „Das halbe Offizierscorps vom g‘mischten Africaregiment Erzherzogin Maria Sophia besteht doch aus solch‘n Amateuren wie mir, mit dem kleinen Lorbeerkranz um die Keks. Die echt’n Offizier‘ tun mir schon manchmal richtig leid, die müss’n einen richtigen Eiertanz aufführ’n, wenn einer von uns sich einbildet, wirklich Befehle geb‘n zu woll‘n und die Anweisungen total blöd sind. Einer von den echten Leutnants ist doch als Soldat und Offizier besser geeignet wie ich als Oberstleutnant! Die Stern‘ hat mir doch die Prinzessin nur auf die Schultern g‘steckt, weil wir keine Abendrob‘n mithaben!“
„Ich möcht‘ anmerken, meine teuerste Baronesse von Oberwinden, dass sie als Offizier wahrscheinlich fähiger wär‘n als so mancher regulärer Feldmarschall in der G‘schichte von Österreich.“
„Wie ist das jetzt eigentlich, Oberst.“ Elisabeth zupfte noch einmal die Bluse unter der Koppel zurecht. „Wer von uns zwei darf dem andern eigentlich das Du-Wort anbieten? Sie sind im Rang zweimal über mir, aber ich bin die Dame in dem Spiel!“
„Egal. Wenn wir uns einig sind, mir ist’s ganz recht, Elisabeth!“ Inzersmarkt hob kurz den Tropenhut mit der breiten Krempe. „Und ein Vergnügen, noch einmal mit einer feschen, jungen Frau befreundet zu sein.“
„Na dann!“ Elisabeth lachte und griff nach der Hand des Obersten. „Bussi, Wilhelm! Die echte Küsserei holen wir später nach, wenn kein Franzos‘ mehr zuschaut!“
„Aber ja, nur zu gern, und ein Glaserl Wein brauch’n wir doch auch noch dazu.“
Endlich berührte der Kanzelboden des Luftschiffs den Boden, die Taue wurden an den Erdankern ordentlich belegt und die Dampfturbinen liefen winselnd aus. Von der Kanzel wurde eine Tür mit Treppe aufgeklappt, welche François Louis Bonaparte, der Dauphin Frankreichs, mit seinem Adjutanten herabschritt und sich den beiden Offizieren näherte. Oberwinden und Inzersmarkt salutierten gleichzeitig und warteten, bis die Franzosen den Gruß entgegneten.
„Ich darf der kaiserlichen Hoheit Oberstleutnant Elisabeth Baronesse von Oberwinden vorstellen, mein Name ist Wilhelm Oberst Graf von Inzersmarkt. Sie müssen schon entschuldigen, kaiserliche Hoheit, aber wir haben nicht genug Soldaten für eine Ehrenformation und den roten Teppich haben wir auch nicht mit genommen.“ Wie jeder Adelige Europas sprach Inzersmarkt fließend die französische Sprache, aber die Grammatik und Wortwahl blieb österreichisch. „Und die Einheimischen sind auch gerade mit Wichtigerem beschäftigt, als einen Empfang vorzubereiten, also dachten wir uns, wir empfangen halbwegs formlos zwei Offizierskameraden. Wenn sie mitkommen wollen, Colonel, Commandant, wir haben einen Burschen los geschickt, damit er uns eine Flasche Wein oder Weinbrand besorgt.“ Gemeinsam mit Elisabeth von Oberwinden schritten die Herren auf die Garnison zu.
„Wir haben außer Feldrationen nur jene Verpflegung, welche vor Ort zu haben ist, und leider ist das nach dem Überfall einiger Verbrecher auf diesen Ort im Moment nicht sehr viel“, erklärte Elisabeth den Herren, François Louis verhielt seinen Schritt.
„Colonel, geben sie doch bitte in der AIGLE Bescheid, Maitre Albert Bocaise möge ein Picknick für fünf Personen zusammenstellen, und auch ein paar Flaschen Bordeaux dazugeben. Und er soll auch ein paar haltbare Leckereien für die Mannschaften der Husaren einpacken. Danke, Commandant.“
„Das ist sehr nett von ihnen, Hoheit“, strahlte Elisabeth den Prinzen an.
„Wie kann man herzlos bleiben, wenn eine selbst in Uniform so schöne Frau wie sie den Luxus eines guten Mahles entbehren muss?“ Der Bonaparte nahm Elisabeths Hand und küsste sie.
„Sie sind überaus charmant, mon Dauphin“, erwiderte Lisi. „Eine richtige Gefahr für jede Frau.“
„Sie übertreiben und schmeicheln mir, Baronesse“, flirtete Franz Ludwig ein wenig. „So, finden sie“, lächelte Elisabeth den Prinzen an, und von der Tür erklang Maria Sophias Stimme.
„Sie hat aber ganz recht, François!“
„Endlich begegnen wir uns wieder, Maria Sophia!“ Der Dauphin ergriff die rechte Hand der hinzutretenden Erzherzogin mit beiden Händen und beugte sich darüber.
„Ja, das letzte Mal waren wir noch viel jünger“, entgegnete die Habsburgerin. „Wir waren sehr jung, um genau zu sein. Aber du bist richtig fesch geworden, und die Uniform – ein wenig unpraktisch und warm für diese Gegend, aber sie steht dir gut!“
„Und deiner Schönheit, meine Teuerste, kann nicht einmal diese Uniform schaden.“ Franz Ludwig legte die Rechte aufs Herz. „Obwohl – sie wirkt schon sehr… aufregend, so wie sie bei den anwesenden Damen geschnitten ist und überdies so anmutig getragen wird!“
„Die Baronesse hat es schon ganz richtig gesagt, mein lieber François. Du bist ein gefährlicher Charmeur. Aber jetzt komm mit, wir haben ein offenes Wort miteinander zu reden. Unter vier Augen, Commandant“, wehrte sie den Adjutanten ab, der vom Luftschiff zurück gekehrt war. „Wir kontrollieren dabei gleich die Wachen. Einverstanden?“
„Wie könnte ich dieser Einladung widerstehen“, lächelte der Dauphin ein wenig säuerlich.
„Gar nicht, wenn du klug bist“, flüsterte Maria in sein Ohr.
„Dann, meine Liebe, bitte nach dir!“ Die Tür zum Gang fiel hinter ihnen ins Schloss.
„Ich hoffe, die Prinzessin weiß, worauf sie sich einlässt“, flüsterte Milfort und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
„Machen sie sich keine Sorgen, Commandant“, bemerkte Elisabeth. „Und ziehen sie doch um Gottes willen endlich diese dicke Uniformjacke aus, bevor sie umfallen. Wir haben hier leider keine Klimaanlage!“
„Danke, Mademoiselle, aber das wäre doch wirklich nicht schicklich“, wehrte der Major ab.
„Muss ich erst einen Befehl daraus machen, Commandant?“
=◇=

„Also, François, ich weiß schon, warum du gekommen bist, und im Moment ist es ein ganz dummer Zeitpunkt für solche Angelegenheiten. Trotzdem, reden wir einmal kurz darüber. Sollte ich wirklich ja zu dieser Hochzeit sagen, dann erwarte ich, dass du im Westflügel von Schönbrunn den ersten Stock bewohnst, und ich im Ostflügel. Ich hab‘ nämlich keine Lust, auf Schritt und Tritt über deine Mätressen zu stolpern, und ich möcht‘ auch nicht über Auswahl und Anzahl meiner Liebhaber diskutieren! Und ich werde auf keinen Fall auch nur auf einen einzigen von denen verzichten, nur weil ich dich geheiratet haben sollte. Willst du es dir nicht noch einmal überlegen? Valerie Theresia wäre noch frei, und die freut sich sicher über einen Kronprinzen und Thronanwärter als Ehemann!“ Franz Ludwig hatte derzeit Probleme, mit der Prinzessin Schritt zu halten, er seufzte tief zu ihren Worten.
„Wenn es nach mir ginge, meine liebe Marie, ließe ich mir noch viel Zeit mit meiner Hochzeit. Sehr viel Zeit, denn die hübschen Mädchen von Paris… nun gut, deinen Worten von vorhin entnehme ich, dass du wohl wissen wirst, was ich meine! Aber meine Mutter! Roxane Solange de Beauvoise möchte uns unbedingt auf einem gemeinsamen Thron sehen, auf biegen und brechen. Sie rechnet mit einem festen Bündnis unserer Reiche, damit sie ihr – unser – Volk endlich zufrieden stellen kann. Ein Volk, das nicht zu Unrecht immer lauter nach Erfolgen schreit.“
„Ja, wie denn?“ Maria Sophia blieb abrupt stehen. „Will sie Österreich als französisches Gebiet deklarieren? Das funktioniert nicht. Oder will sie Belgien und die Niederlande unter die Flagge Frankreichs bekommen? Skandinavien? Ja, wie stellt sich Roxane Solange denn das vor? Dass ganz Europa zuschaut, wie Frankreich immer größer wird? Nehmen wir der Diskussion halber einmal an, es gäbe wirklich ein expandierendes Austrofranzösisches Reich – es wären doch sofort alle gegen uns, sogar die Deutschen. Am Schluss bliebe nichts mehr von beiden Staaten übrig. Deutschland ginge bis zu den Alpen, auf der anderen Seite wäre ein überglückliches Italien. Britannien holte sich die französischen Provinzen eine nach der anderen, Russland breitete sich bis zur Leitha aus – und dann, dann streiten sie sich eben untereinander weiter. Bis wieder alles zerfällt. Wir haben im Moment ein verdammt labiles Gleichgewicht der Kräfte auf der Welt. Und ich finde, wir sollten nicht unbedingt eine brennende Lunte in dieses Pulverfass stecken. Denk nach, François, ist es das wert? Ein Leben ohne Liebe, aber mit einem Krieg und tausenden Toten auf dem Gewissen?“
„Ich sage ja, wenn es nach mir ginge…“
„Pass auf!“ Die Erzherzogin ging weiter, aber beträchtlich langsamer. „Ich hab‘ mit meiner Mama gesprochen, und wir machen dir, respektive deiner Mama jetzt einen Vorschlag. Du heiratest Valerie Theresia, sie hat ein leises Interesse an einer Ehe mit dir bekundet und ist sogar bereit, bis zur Erfüllung ihrer dynastischen Pflicht eine halbwegs brave und einigermaßen treue Ehefrau zu sein. Sie hat politisch kein so wirklich großes Gewicht und verzichtet außerdem für sich und ihre Kinder auf alle Ansprüche den österreichischen Thron betreffend. Valerie wäre für dich aber eine gute Kaiserin, denn sie ist intelligent und sogar die Hübschere, zumindest mit mir verglichen. Ja, mein lieber Cousin, ich kenne deinen Frauengeschmack durchaus! Also gut, du heiratest Valerie Theresia, dafür bekommt Frankreich von Wien zuerst einmal sofort einen Nichtangriffspakt. Das bedeutet, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Rüstungsausgaben Frankreichs in technischen und sozialen Fortschritt zu Gunsten der Bevölkerung fließen kann, weil ja ein schönes Stück Grenze nicht mehr auf biegen und brechen gesichert werden muss. Valerie Theresia bekommt noch dazu einen Fond als Mitgift, der soziale Projekte fördert und dem Kaiserhaus, also im Endeffekt auch dir erlaubt, in die eigenen Bürger zu investieren. Weil ein gut ausgebildetes Volk nun einmal das beste Kapital für einen Staat, also auch für einen Herrscher ist. Mit technischem Fortschritt und sozialeren Lebensbedingungen wäre das Volk à la longue wahrscheinlich zufriedener als mit einem expandierendem Reich. Dafür verzichtet Frankreich auf Expansion in Europa. Was sagst du dazu?“
„Ich finde das Angebot sehr gut und großzügig, obwohl der Teil mit den verschiedenen Flügeln in Schönbrunn für mich auch durchaus seine Meriten hätte – nein, das geht wohl nicht wirklich, wenn es um die Zeugung eines Erben geht. Ich schicke Mama ein Telegramm, einmal sehen, wie sie darauf reagiert!“
„Wir haben hier eine Telegraphenstation in der Garnison gefunden, ich führe dich einmal hin! Und zieh endlich deine warme Jacke aus, du bist ja schon ganz rot im Gesicht!“
In Hemdsärmeln kam der Dauphin aus dem Kämmerchen des Telegraphisten. „Ich habe für das Erste einmal dein Angebot übermittelt, aber wahrscheinlich muss Mama jetzt erst zu Madeleine de Cartaille laufen, um sich spirituellen Rat vom Goldenen Frühling zu holen. Dann geht sie zu Papa, um ihm ihren Entschluss mitzuteilen, und der Kaiser verkündet ihn dann.“
„Vom Goldenen Frühling?“ Maria Sophia zog die Augenbrauen hoch.
„Na ja, so ein spiritistisches Medium eben. Aber Mama schwört seit einiger Zeit auf den Rat der Geister!“
„Aha! François, kannst du vielleicht noch zwei Minuten hier warten, wenn ich schon hier vor dem Bureau stehe, könnte ich gleich Mama über unser kurzes Gespräch informieren!“
„Natürlich“, verneigte sich der Dauphin. „Wenn wir uns dann zu den anderen zurück begeben und unser Picknick genießen können?“
„Danke!“ Federleicht ruhten die Fingerspitzen der Prinzessin auf der Wange des Franzosen. „Ich bin sofort wieder bei dir, und dann gehen wir etwas essen. Mit Elisabeth von Oberwinden und dem Oberst von Inzersmarkt. Versprochen!“
=◇=
Die Sonne versank hinter den Bergen westlich von Gonder, und in der kurzen Dämmerung verabschiedeten sich François Louis und sein Chef d’Esquadron von Maria Sophia, Elisabeth von Oberwinden und dem Oberst von Inzersmarkt, um die Nacht bequem auf der AIGLE zu verbringen.
„Na gut, dann woll’n wir mal!“ Ein rasches, letztes Winken zu den einsteigenden Franzosen, dann verschwand das fröhliche Lächeln vom Gesicht der Erzherzogin, sie machte auf dem Absatz kehrt. „Bringt’s den Ahmed in den Käfig neben dem vom Major Maasfoord. Da werden wir ja einmal seh‘n und hör’n, was sich die netten Brüder zum sag’n haben!“ Gefolgt von den beiden anderen schritt sie wieder in die Festung der Garnison. „Hallo, Scharly! Nein, mach dir keine Sorg‘, ich bin noch nicht verlobt. Und selbst wenn, könnt‘ ich jetzt ein Bussel von dir ganz gut brauchen!“ Rasch, aber dennoch innig umarmte die Prinzessin den Schriftsteller und küsste ihn. „Hört’s zu, ich möcht‘, dass die Henny und der Orville unauffällig vor der Tür steh‘n und zuhorch’n. Weil vielleicht reden die ja Amharisch oder Hebräisch mit einander. Scharly, du passt bitte auch auf, wegen Arabisch und Türkisch. Hoffen wir, dass die Armleuchter nicht irgendeinen obskuren Bantudialekt ausgrab‘n, in dem sie sich verständig’n können. Alles klar?“
„Was gibt’s denn da nicht zum versteh’n?“ Elisabeth hatte gleichen Schritt aufgenommen und blieb neben der Erzherzogin. „Soll der Willem Okomaratu auch dabei sein?“
„Aber ja! Nur später, wenn’s ihr auch den Scheich Feisal von den Beduinen bringts. Dann müssen wir nicht alles fünf mal erzählen!“
„Auf mit dir“, befahl Vizeleutnant Alexander Smetana dem Gefangenen Ahmed. „Wirst verlegt! Komm schon mit!“
„Wohin gehen wir“, fragte Ahmed, während er zwischen dem Zugsführer Idinger und dem Korporal Czojka mit klirrenden Fußketten dahin schlurfte.
„Du musst nimmer allein sitzen und darfst ab jetzt Gesellschaft haben!“ Er öffnete einen Raum mit drei Zellen. „Vielleicht kennst du den Kerl ja schon, es ist der Major Maasfoord. Also bitte, der Herr, in die mittlere Zelle!“
„Aber warum denn?“
„Ach, das sind der Ranghöchste von denen, die wir am Exerzierplatz gefangen haben“ erzählte der Vizeleutnant im Plauderton. „Wir haben uns gedacht, eventuell möchtest ja mit dem ein wengerl plauschen!“
„Und warum sollte ich mit einem Spitzel sprechen?“ Major Jan Maasfoord trat an die Gittertür.
„Vielleicht fällt euch ja doch noch etwas ein“, meinte der Vizeleutnant schulterzuckend. „Zum Beispiel, warum ihr eigentlich die Leute da oben gefoltert und umgebracht habt!“
„Das haben wir doch schon erklärt, und es dürfte auch schwer abzustreiten sein. Weil wir den Bundesring wollten. Die Trommel, die dem Stamm Daniel anvertraut wurde. Es ist uns nicht gelungen, wir sind eure Gefangenen geworden! Andere werden mehr Glück haben.“
„Und schon sind wir beim Thema!“ Das Gesicht der Prinzessin zeigte nichts von der sonst vorhandenen Freundlichkeit, als sie mit ihren Begleitern den Raum mit den drei Zellen betrat. „Für wen oder was wolltets ihr eigentlich den Ring hab‘n. Für einen Gold‘nen Frühling vielleicht!“
Jan Maasfoord umklammerte die Gitterstäbe, doch sein Gesicht blieb ausdruckslos. „Was wäre denn schlecht an einem neuen, einem besseren Zeitalter?“
„Euer Weg dorthin“, erklärte Maria Sophia. „Wie kann eine Zukunft besser wird‘n, wenn sie auf dem Blut Unschuldiger gebaut wird?“
Der Major machte eine gleichgültige Geste. „Fußt nicht der Einfluss aller Religionen und Regierungen auf Blut und Gewalt?“
„Habt’s ihr nicht g’sagt, etwas Besseres bauen zu woll‘n“, lächelte die Erzherzogin eiskalt mit erhobener Augenbraue.
„Der Messias wird in Jerusalem erscheinen und er wird das neue Zeitalter, al eumar almuealim! Und die Gläubigen werden belohnt, während die Sünder bestraft werden! Wacht endlich auf und folgt dem Messias“, predigte der Major!
„Ich hör‘ da immer nur Schlagworte, aber eigentlich nichts Vernünftig‘s“, schüttelte Maria den Kopf. „Das ist kein Gespräch, das ist nur immer und immer wieder der gleiche aufg’wärmte Mist von all‘n Kerzelschluckern. Da sind überhaupt keine Argumente dabei, damit überzeugt man doch nur mehr Idiot‘n, aber doch keine denkenden Leut‘!“
„Ihr seht, Hoheit, dass man die Herrschaft der Yegēt Lijochi nicht zulassen kann“, mischte sich nun Ahmed ins Gespräch. „Ihr müsst uns helfen, diesen Messias nötigenfalls mit Gewalt von seinem Thron zu stoßen, wenn er ihn erst erobert hat! Denn es werden nach der Philosophie der Mutter des Messias alle sterben müssen, welche sich den Lehren nicht beugen wollen, und den späten Konvertiten ist ein Leben in Sklaverei und Leibeigenschaft zugedacht. Wir müssen vorbereitet und gewappnet sein, den Usurpator wieder vom Thron zu stoßen!“
„Und wer hat denn die Prinzessin unter der Androhung ihres Todes zu ihrer Reise genötigt“, warf Elisabeth von Oberwinden ein. „Ihr habt ihrer Hoheit gesagt, dass sie stirbt, wenn sie nicht macht, was ihr wollt!“
„Aber wir haben ihr doch nicht gesagt, was sie tun soll. Wir haben ihr lediglich die Spuren gezeigt, denen sie dann folgte. Der Orden der Kinder des Herrn will die ganze Welt unter seine Herrschaft zwingen, wir hingegen haben nur eine Person…“
„Gusch, G’sindl“, platzte es aus Maria Sophia heraus. „Ihr, der Ord‘n hinterm oder vor’m Frühling und der Ord‘n vom Ahmed, ihr seid’s alle zwei ein Bund Hadern. In einen Sack steck’n, mit einem Steck’n drauf hau’n, und man trifft nie einen falsch‘n! Was bildet’s ihr Hundling euch denn eigentlich ein? Glaubt’s ihr, Menschen sind nur dazu da, dass bei euren perversen Machtspiel‘n als Marionett’n auftret’n? Und wie krank muss man denn in der Marill’n sein, wenn man für einen Krieg nach einem Krieg aufrüstet, der noch nicht einmal ausbroch‘n ist? Statt die ganz‘n Toten zu verhindern, die die ander’n geifernden, fanatischen Arschlöcher provozieren wollen, wollt’s ihr noch einen draufsetz‘n und danach noch mehr Blut seh‘n. Ihr wollt’s wohl unbedingt selbst ein bisserl Gott spielen! Das ist ekelhaft, pervers und krank!“
„Wir versuchen doch, es im Vorfeld zu verhindern, Hoheit“, versuchte Ahmed eine Rechtfertigung. „Wir haben immerhin die Polizei von Österreich auf die Anwerbezellen in den Donaumonarchien aufmerksam gemacht!“
„Und in anderen Ländern? Frankreich ist, so scheint’s mir, schon ziemlich fest in der Hand vom Goldenen Frühling“, bemerkte Elisabeth.
Maasfoord schlug mit der flachen Hand gegen das Gitter. „Es geht ja auch um den neuen Messias, der das Reich GOTTES erneuern soll, gezeugt…“
„Mit Verlaub, drauf g’schissen“, unterbrach Maria Sophia den Eiferer. „Mir ist euer Stamm David oder Benjamin oder wer auch immer sowas von wurscht, das ahnt’s ihr gar net, wie sehr. Eure Stämm‘ zählen für mich genau elfe, also weniger wie gar nichts!“
„Immerhin, Maria, es geht hier doch um die Blutlinie des Messias Jesus Christus“, warf Elisabeth mit erhobenem Zeigefinger ein.
„Einer Blutlinie, der auch sie angehören, Baronesse“, tadelte Ahmed! „Ihr ironischer Tonfall ist also nicht wirklich angebracht!“
„Er kann mich im Arsch lecken, und zwar fest und kreuzweise“, polterte Lisi unvermittelt los! „Aber z‘erst wascht er sich die Zungen. Gründlich, mit Seif‘, ich will am Hintern ja net dreckig werd’n!“
„Was ist schon groß d’ran an einer Blutlinie“, hieb die Erzherzogin in die selbe Kerbe. „Woll’n wir denn wirklich aufzähl‘n, wie viele Herrscherhäuser ihre Ansprüche im Laufe der Zeit verloren hab‘n? Wenn jetzt einer in Frankreich auftaucht und sagt, er stammt von den Merowingern, den Bourbonen oder den Valois ab, was passiert wohl? Oder wenn in Schottland einer erzählt, dass er von Robert the Bruce abstammt? Oder ein Staufer in Deutschland? Und alle haben’s zu ihren Lebzeiten behauptet, sie wär’n von GOTT eing’setzt. Ein Dreck sind’s! Wir Habsburger hab’n noch vor vierzig Jahr‘ g’sagt, dass wir ‚von GOTTES Gnaden‘ Kaiser und König‘ sind. Schwachsinn! Wahrscheinlich hat einer unserer Vorfahren genug von der Arbeit als Bauer g’habt, sich ein Schwert g’schnappt und hat ang’fangen, im Gefolge vom ersten König Heinrich, den sie damals den Vogler g’nannt hab’n, gegen die Ungarn zu kämpfen und sich dabei einen ungarischen Gaul unter’n Nagel g’rissen! Und weil er genug Magyaren umbracht hat, war er plötzlich Ritter und Burgherr, damit er beim nächst’n Krieg noch mehr abschlacht’n konnt‘. Und wenn’s ein Haus gibt, das sich den Adelstitel anders erworben hat als mit Blutvergießen und Tod, mit der Keule, der Axt, dem Schwert oder ein paar Kanonen, dann sag‘ ich‘s jetzt ganz laut, dass das einfach nicht stimmt. Dass das glatt gelogen ist. Der David hat den Goliath flach g’legt und ist König word’n. Ja, Respekt dass er den riesigen Lack’l g’schafft hat! Und weiter? Er war König, und seine Familie nach ihm, in Ordnung. Aber dann sind irgendwann die Römer da g’sessen und die Israeliten hab’n eben dann die Papp‘n halten müssen! Da war’n halt die Römer die stärker‘n, weil’s bessere Steinschleudern für größere Steine wie die Davidsöhne g’habt haben. Und wie den Juden des Gosch’n halten nimmer passt hat, haben’s einen Aufstand versucht und ihn dann verloren. Ja, war eben so. Danach sind‘s irgend wohin vertrieben worden. Heut‘ sind’s überall, und in dem Land, das einmal ihnen g’hört hat, sind halt die verschiedenst‘n Muslime drüberg’raspelt. Die Kreuzritter auch immer wieder, weil sie sich mit den Moslems um das ach so Heilige Land g’stritten haben. Und die Juden, die im Jordanland blieben sind, hab’n wieder einmal weniger wie nichts zum sagen g’habt. Nicht schön, ich geb‘s zu, aber ein ganz normaler Vorgang in der menschlichen Geschichte. Und das alles ist Jahrhunderte und sogar Jahrtausende her! Wir Habsburger sind ja auch aus der Schweiz raus g’flogen, wo unser Stammsitz war. Wenn ich dort aufschlagert und sowohl die Habichtsburg als auch die Rechte von meinen Vorfahren verlangert, würd’n mich die Schweizer auch gleich wieder hochkant bei der zug’machten Tür rausschmeißen. Ist halt so und lasst sich nicht ändern. Wir hab’n damals die Babenberger, die Přemysliden und alle ander’n als Herzöge von Österreich abg’löst. Irgendwer wird uns irgendwann auch ablösen, und verdient werden wir’s haben. Wenn dann in drei- vier- oder fünfhundert Jahr einer sagert, er stammt von der Maria Theresia ab, würd‘ ihm der Neue den Mittelfinger zeig’n. Und das auch völlig zu Recht!“
„Aber keine dieser Familien stammt von Gott ab“, ereiferte sich Maasfoord! „Wir haben doch die heilige Pflicht…“
„Ihr sagt’s, dass Joshua, der Messias, aus dem Samen Davids gezeugt wurde“, unterbrach die Baronesse Elisabeth den Fanatiker.
„Ja, natürlich, geboren aus dem Schoße Benjamins und geschaffen vom Geiste GOTTES.“ Ahmed zeichnete mit den Händen ein Dreieck in die Luft.
„Und im Salome-Evangelium, das wir in Lalibela haben lesen dürfen, steht auch, dass der Messias Joshua mehrfach betont hat, dass wir alle seine G‘schwister und vom Geiste GOTTES sind“, führte Elisabeth weiter aus. „Er selbst stellt sich und uns alle auf ein und dieselbe Stufe, er ist in seiner eigenen Selbsteinschätzung nur ein Verkünder der Wahrheit. Meinetwegen mag er also ein Prophet, ein spiritueller Lehrer gewesen sein, aber er selber wollt‘ sicher kein Herrscher werden! Und d’rum seid’s ihr alle auf’m Holzweg, wenn’s ihr in seinem Namen einen heiligen Krieg anzetteln wollt’s.“
„Oh nein“, wehrte Maasfoord ab. „Auch wenn er es gesagt hat, und wenn er auch sein Brot mit den Ärmsten teilte, so war er doch der Auserwählte. So wie heute der Sohn Atrás der..“
„Nein, nein, die Baronesse hat völlig recht, ich kann ihrer Logik und Einschätzung nicht widersprechen. Der Lehrer wollte doch nie herrschen, ich frage mich jetzt, wie diese Vorstellung in unsere Köpfe geraten konnte“, rief Ahmed. „Aber es ist ein Grund mehr, die Herrschaft des Ordens Atrás zu verhindern! Bitte, Hoheit, gebt die Baronesse frei, um…“
„Stopp!“ Maria Sophia hob die Rechte mit der Handfläche nach vorne. „Jetzt möcht‘ ich einmal einige Dinge klarstell‘n. Erstens, die Baronesse von Oberwinden ist eine freie Frau, die jederzeit als Erbin der Baronie Oberwinden zurücktret‘n und auf ihr‘n Wunsch von ihrem Lehenseid entbund‘n werden kann. Das wäre ihre Entscheidung, an der ich nicht das Geringste zu bestimmen hätte. Ich müsste diese Entscheidung akzeptieren und würde sie natürlich respektieren. Bis jetzt hat sie sich allerdings gegen diesen ominösen namenlosen Orden entschieden, und auch das akzeptiere und respektiere ich. Zweitens hat die Baronesse völlig recht! Euch allen ist völlig wurscht, was der Mann, auf den ihr euch beruft’s, damals g’sagt hat. Ihr schimpfst, dass die christlichen Kirchen von Leut‘ gegründet worden sind, die den Messias und seine Lehren aus Eigennutz verraten hab’n. Gut, das stimmt auch, wenn Salome in ihrem Evangelium recht hat. Aber was macht’s denn ihr? Ganz genau das gleiche! Ihr wollt’s keine andere Ordnung, ihr wollt’s die gleiche, nur mit euch selber an der Spitze. Ihr wollt’s die absolute Macht, und zu was? Um einen Gottesstaat ausrufen und eine neue Dynastie von Tyrannen und Diktatoren heranzüchten? Was habt’s ihr davon? Könnt’s ihr vielleicht ein Brat’l mehr fressen als jetzt? Ein Flascherl Wein oder Bier mehr saufen? Einmal mehr vögeln? Ja, das vielleicht. Und vielleicht habt’s wirklich mehr Auswahl an Frauen, weil die sich dann nicht trauen, nein zu sagen. Aber spielt euer Dingeling auch mit, wenn’s ihr die Frau vor euch habt’s oder gibt der Familienschmuck doch wieder viel zu früh auf und hängt nur mehr schlaff runter? Was glaubt’s ihr? Und ist es das, was ihr wollt’s? Einfach alles nehmen, ob ihr was damit angefangen könnt’s oder nicht? Eine Zeitlang macht das sicher Spaß, aber dann, eines Tages, kommt die Angst. Das Misstrauen. Schleichend, auf leis’n Sohl‘n. Dieser dort könnt‘ mir nach dem Leben trachten, jener mir meine Position streitig machen, der meine Sklavin weg nehmen wollen. Es gibt keine Freundschaft mehr, nur noch ein gegenseitiges Belauern. 365 Tage ihm Jahr, keine Stunde, nicht einmal eine Minute Ruhe und Entspannung. Wie lang haltet’s ihr das aus, ohne zum Durchdreh‘n? Nun, eines Tages ist wirklich einer g’scheiter oder stärker wie ihr, und dann…“ Ruckartig fuhr sich Maria Sophia mit dem Daumen über die Kehle. „Dann endet eben ganz plötzlich ein ganz ein beschissenes Leb’n, nämlich euers. Was mich persönlich nicht stören würd‘, aber vielleicht hängt’s ihr ja an dem Dasein. Weil Glauben könnt‘s ihr das, was der Lehrer damals über das Jenseits und den Himmel g’sagt hat, ja nicht wirklich. Nicht nach dem, wie ihr euch benehmt’s. Und zum Dritten, mein Großvater und meine Mutter haben mehr und bessere Reformen auf den Weg bracht, als alles werden sollt, was ich von euch bis jetzt g’hört hab. Gottesstaat! Staatsreligion! Priesterkönig! Da geht mir ja das G’impfte auf. Da krieg‘ ich solche Kabel am Hals! Das ganze Blut hupft mir ins G’sicht! Da springt mir der Feitl in der Tasch’n auf. Es gibt keinen Krieg, der heilig ist! Nie! Gerechtfertigt vielleicht, wenn man an’griffen wird. Aber niemals heilig. Schluss jetzt! Die Audienz ist beendet. Ich werd‘ mit dem Willem Okomaratu reden, es schaut mir so aus, als wär der Ahmed wirklich unschuldig an den Massakern, also soll der sich in ein paar Tag‘, wenn ich wirklich noch leb‘, mit seinen Leut‘ von mir aus über sämtliche Häuser hau’n. Also, Ahmed, wenn das mit dem Gift, oder besser Nicht-Gift stimmt, dann nimmst in einer Woch’n deine Haberer und ihr schert’s euch heim zu eurer Tabernakeltaub’n und den Kuttenbrunzern und sagt’s denen, dass ich…“
„Dass wir“, warf Elisabeth ein und hob dabei die Rechte wie zum Schwur.
„Gut! Also dass wir sie in Zukunft jagen werd‘n. Das ist nicht heilig und im Namen Gottes, das ist reine Selbstverteidigung im Namen der Menschlichkeit! Und was euch vom Frühling und den Awlad Alrabi angeht, ihr habt’s jetzt der ganzen Welt den Krieg erklärt – also gut! Wir haben da ein Sprichwort: ‚wer Wind sät, wird Sturm ernten‘. Viel Spaß! Ihr habt’s zum Schwert griffen, und ihr werdet’s alle noch durch’s Schwert sterb’n. Oder durch die Hanfkrawaten. Vielleicht auch durch ein paar Steine, das wäre wirklich göttliche Gerechtigkeit. Und das ist ein Versprechen. Weil, das Karma ist nämlich wirklich ein Hund, auch wenn’s ihr nicht d’ran glaubt’s.“
„Glaubst du wirklich dran, dass das Gift vielleicht gar nicht gibt?“, fragte Karl Maerz, als er die Prinzessin in ihren Raum begleitete.
„Ich wüsst‘ nicht, warum er lügen sollt“, überlegte sie. „Jetzt hat er doch nichts mehr davon. Wenn ich – he, die Zeit ist doch schon vorbei! Eigentlich müsst‘ ich schon blau anlaufen und…“ Maria musste sich gegen die Wand lehnen.
„Es gibt doch ein Gift und es wirkt jetzt? Ich hole…“
„Nein, nein, es ist nur ein kurzer Schwäche- und Schwindelanfall“ beruhigte sie den Schriftsteller. „Aber ich muss jetzt gleich ganz fürchterlich speib’n, bring mich bitte auf einen Abort und besorg‘ mir dann einen scharf‘n Schnaps. Einen sehr scharfen. Das sind jetzt ganz einfach die Nerv‘n!“ Maerz hatte einen recht guten Korn in seinem Flachmann in der Tasche, er musste also nicht extra los laufen und etwas besorgen. So konnte er der Prinzessin den Kopf halten, während all die guten Sachen aus der Speisekammer der AIGLE ihren Magen wieder verließen.
=◇=
Wien
Die Arbeitsgruppe der Physiker war mit der heiligen Lanze in die Kaiser-Ebersdorfer Artilleriekaserne neben dem Schloss Neugebäude übersiedelt. Dort hatten sie reichlich Platz für Versuche, ohne Außenstehende zu verletzen.
„Kommen’s einmal her, Versuchskaninchen!“ Ernst Mach winkte den Zugsführer Franz Müller heran. „Schaun‘s einmal, da vorn in der Pistol’n ist ein kleiner Splitter von dem heiligen Nagel in der Lanz’n, im Schläuch’l um den Lauf heilig’s Wasser, g’weiht vom Kardinal Erzbischof Langer ganz persönlich. Patronen sind keine in der Waffen, und den Schlagbolzen haben wir auch ausbaut. Jetzt probieren’s einmal, sie woll‘n da vorn die Mannscheibe treffen. Dreihundert Meter, das schafft doch ein hervorragend ausgebildeter Alpinjäger. Also – oha!“ Ein Blitz war von der Waffe zur Mannscheibe gesprungen und hatte dort ein doppelt faustgroßes rauchendes Loch hinterlassen. „Genau dort, wo der Bluzer von aner Person wär! Oder besser, g’wesen wär. Versuchen‘s doch bei der nächsten Scheib’n ein kleiner‘s Loch zu machen, Zugsführer.“ Wieder bohrte sich der Blitz in die Scheibe, hinterließ dieses Mal ein rauchendes Loch von etwa einem halben Zentimeter. „Perfekt“, freute sich Mach. „Nächste Scheib’n, nächste, nächste! Gut. Dort, die fünfe, wie schnell…“ Beinahe gleichzeitig schlugen die Blitze in den Scheiben ein, der Lauf der Waffe hatte sich kaum sichtbar bewegt.
„Danke, Zugsführer. Vielen Dank!“ Viktor von Lang war blass geworden. „Ich schaff‘s grad einmal auf zehn Meter, und sie sind schon auf 500 Meter. Zielsicher und zerstörerisch. Ich krieg’s langsam mit der Angst zu tun. Dürf’n wir hier eigentlich noch weiter forschen, Kollegen? Erlaubt das unsere Ethik?“
Gottlieb Adler nahm die kurzläufige Waffe zur Hand und ging in den Anschlag. „Nichts. Bei mir funktioniert’s gar nicht, beim Kollegen Lang ein bisserl und bei dem Kappelständer fliegen die Fetzen. Warum? Und alle Instrumente, die wir anlegen können, zeigen überhaupt nichts an. Auch, wenn der Zugsführer die Scheib’n zerfetzt, da ist genau gar nichts auf die Zeiger!“
„Die Löcher in der Wand und den Scheiben besagen aber das Gegenteil, Kollege Adler.“ Josef Stefan schraubte seinen von John J. Loud erst vor kurzem entwickelten Kugelschreiber wieder zu, nachdem er eben noch auf seinem Block einige Zahlen gekritzelt hatte. „Es widerspricht auch dem vom Kollegen Boltzmann und mir entdeckten Abstrahlgesetz, scheinbar entwickelt sich die Hitze erst und ausschließlich im Ziel. Wir dürfen halt bei unserer ganzen Messerei und Analysiererei nicht die Empirik vergessen. All ihre Theorien und Messergebnisse bringen die Löcher in der Wand nicht weg, da müssten schon die Maurer ran. Was ist mit ihnen, Kollege Boltzmann, was denken sie?“
Ludwig Boltzmann nahm das Gerät zur Hand. „Also, Herr Professor…“
„Lassen sie das, Herr Kollege“, unterbrach Stefan. „Sie sind nicht mehr mein Student, Kollege scheint mir da völlig ausreichend.“
„Danke, Herr Kollege. Gut, es gibt kein offensichtliches energetisches Element in diesem – Gebilde. Der einzige Unterschied zu einer leeren Pistole bildet ein winziger Splitter einer Reliquie, in der Mitte des Laufes hinter der Mündung angebracht, und ein dünner Schlauch mit geweihtem Wasser. Logischerweise dürfte also eigentlich nichts geschehen. Aber der Kollege Lang erreicht eine gewisse Wirkung und der Zugsführer Müller eine ganz erhebliche. Es muss also irgendwie am Menschen liegen. Vielleicht sollten wir im weiteren Verlauf der Untersuchungen einen Psychiater, vielleicht den Freud, oder aber einen von den Messmerianern hinzu ziehen, aber jetzt schau’n wir mal, wie weit wir da und jetzt allein kommen. Es hat vielleicht etwas mit Überzeugung und Glauben zu tun. Der Kollege Adler glaubt ja nur an Magnete, Batterien und elektrische Leitungen, wenn sich seine Zeiger nicht rühren, ist für ihn nichts da. Aber – der menschliche Körper ist ja doch auch leitend, und ein größeres Magnetfeld als das von der Erde kennen wir bis jetzt noch nicht. Außer wir postulieren ein galaktisches oder gar universelles Energiefeld.“
Mach trommelte mit den Fingern auf dem Tisch, dann schlug er mit der flachen Hand darauf. „Es klingt für mich absolut überzeugend, dass der menschliche Körper eine Art Energiefeld, ähnlich einem Magnetfeld aufweist. Galvani hatte damals Muskelkontraktionen mit elektrischen Impulsen erzeugt, was die Vermutung mehr als Nahe legt, dass Muskeln mit körpereigenen elektrischen Impulsen gesteuert werden. Wo solche Impulse sind, ist auch ein magnetisches Feld, wie gering es auch sein mag.“
„Aber…“
„Später bitte, Kollege Adler“, unterbrach Victor Lang. „Sprechen sie doch weiter, Kollege Mach.“
„Nun, das vom Kollegen Boltzmann angesprochene universelle Kraftfeld – warum sollte nur die Erde ein magnetisches Feld aufweisen, und sonst kein Himmelskörper. Dann wäre es aber auch schon sehr weit hergeholt, der Galaxis ein solches abzusprechen, das aus den Feldern aller Sonnen der Milchstraße gebildet wird! Und da ja alles mit allem energetisch Verbunden ist…“
„Schau’n wir mal.“ Boltzmann hob die Pistole in Anschlag und zerstörte eine der Zielscheiben komplett. „Das war jetzt aber doch ein wengerl zu viel des Guten!“ Der Schweiß brach dem Physiker aus. „Tja, wir beweis‘n jetzt ein Wunder, indem wir es entzaubern. Und wir beweis‘n, dass die Hermeneutiker schon immer einen Zipfel der Wahrheit in der Hand g’halten haben, ob’s uns g’fallt oder nicht. Vielleicht hab‘n wir uns doch zu sehr auf das Mechanische und Technische konzentriert und den Geist vernachlässigt. Dann sollt‘n wir wirklich einmal mit dem Freud red‘n.“
„Wenn sich jetzt auch noch herausstellen sollt‘, dass die ganzen Religionen mit ihrem Herrgott recht hab’n, mach‘ ich einen Köpfler aus dem Fenster!“
„Tun sie sich bitte keinen Zwang an, Kollege Adler. Die zehn Zentimeter, die die Fenster vom Labor überm Dachl vom Nebentrakt liegen, werden’s schon noch überleb’n!“
=◇=
Die Räumlichkeiten der Kriminalkommission, in welcher der Kommissär Walter Brunner arbeitete, waren im dritten Wiener Bezirk, in der Heumarktkaserne untergebracht. Bei dieser Kaserne handelte es sich um eine so genannte ‚Fuhrwerkskaserne‘, also eine Kaserne für die Train-Bataillone. Da die meisten Fahrzeuge bereits zumindest Dampfantrieb aufwiesen, waren große Teile der Räumlichkeiten über den Stallungen zu Büros umgebaut und an verschiedene Ämter der k.u.k. Verwaltung übergeben worden, und eben dort residierte derzeit auch die zentrale Kriminalkommission.
„Also, die Puffmutter und ihre Katzen und Ratzen verhalten sich still?“ Brunner hatte sich in seinem Sessel zurück gelehnt und betrachtete seine Leute.
„Wir wissen nicht, was drinnen abgeht, Herr Kommissär. Weil wir den Heinzi ja nimmer als Informanten hab‘n!“ Joschi Pospischil hatte sich auf einen Tisch gesetzt und las einige neue Meldungen.
„Ja, schon recht“, brummte Heinrich Navratil und blätterte ebenfalls in einigen Akten. „Sag’s nur, ich hab‘ mich im Dienst g’sund g’stossen.“

„Na, wenn’st es eh schon weißt“, grinste Joschi.
„Das ist der Neid der zu kurz gekommenen. Hättest die Hintwitz doch eh gern selbst vor’m Rohr g’habt“, hänselte Helmuth Kollomwetz seinen Kollegen Joschi Pospischil.
„Ich hab’s praktisch pudelnackert mit ihr’m g’rupften Busch’n vor der Nas’n g’habt“, betonte Pospischil. „Aber ich hab‘ den Willi in der Hos’n lassen!“
„Ja, aber nur, weil er dir g’hängt ist!“ Kollomwetz hatte den Zeigefinger erhoben und krümmte ihn. „Und weil die Mistelbacher auch im Haus waren!“
„Stimmt“. gab Joschi zu. „Die Katz‘ warert schon ein Appetithapperl g‘wesen, und können wird’s auch schon einiges. Aber mir wär’s irgendwie lieber, sie hockert schon im Landl, dort würden ihr die andern Weiber das Wilde schon abereissen! Und die Visage erst, wies fragt ‚griechisch oder französisch‘ und ich ihr sag‘ sie soll sich anzie…“
„Ich bin doch vielleicht ein Hornorchs,“ schrie Heinrich Navratil plötzlich auf.
„Weißt eh, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung!“ Joschi Pospischil polierte seine Fingernägel auf dem Revers seines Sakkos.
„Halt‘ kurz die Gosch’n und hör einmal still zu. Da hab‘ ich doch selber berichtet, dass die Hintwitz d’rüber g’redt hat, dass irgendwo in die africanischen Berg eine Waffenschmiede für diesen Goldenen Frühling – also für den dalkerten Messias – sein soll. Und der Herr Kommissär haben damals noch g’sagt, dass es ja so wenig‘ Berg‘ gibt in Africa. Aber da ist ein Aktenstück über den Tod von der Lichtenbach in Kairo, und nach der sagt‘ sie etwas vom ‚Toussidé‘!“
Brunners Kopf bewegte sich wie in Zeitlupe. „Jaaa?“
„Herr Kommissär, Toussidé ist nicht nur so ein schwindliches Varieté am Gürtel in Mariahilf. Also, sie wiss‘n schon, das Etablissement mit den Hupfdohlen von diesem falsch‘n Franzos‘n, den die Strichkommission eh schon regelmäßig überprüft. Sondern das ist auch ein Berg im Süd‘n von Tripolitanien. Sie wiss‘n schon, diese osmanische Kolonie im südlich‘n Mittelmeer, wo die Franzosen grad anfang‘n, sich breit zu machen! Ein alter Schichtvulkan ist das, schon erlosch‘n! Jetzt kannst plauschen, Joschi! Oder ist die die Luft ausgangen?“
Noch immer wie in Zeitlupe nickte Brunner und griff zum Telephon. „Den Oberkommissär, bitte. Ja? Ja Herr Graf. Wären Herr Graf so gütig, für mich und einen meiner Männer einen Besuch beim Fürsten zu Hametten zu arrangieren. Ja natürlich, in der Sache Goldener Frühling und unserer Prinzessin. Ja! Ja, selbstverständlich, Herr Oberkommissär. Wir sind bereits unterwegs, Herr Oberkommissär. Danke, Herr Oberkommissär.“ Er hing den Ohrtrichter an den Haken des Geräts. „Komm, Heinzi, auf geht’s, wir bekommen eine Luxusfahrt zum Palais Hametten. In der Kiebererhutsch‘n!“
=◇=
Die Geheime Abteilung des k.u.k. Auswärtigen Amtes, das so genannte k.u.k. Evidenzbureau, hatte seine Räumlichkeiten ebenso wie das diplomatische Corps und das k.u.k. Außenhandelsbureau in einem modernen Gebäude gleich vis a vis dem Palais Hametten. Dieses Haus war mit dem Palais Hametten unterirdisch durch einen breiten, gut beleuchteten Gang verbunden. An dessen Endpunkten hielten je zwei Unteroffiziere der Wachtruppe des Amtes in einer gut gesicherten Stellung Wache. Sie benützten bereits den von Alexander Graham Bell 1881 erfundenen Magnetwellendetektor ebenso wie die von Johann Wilhelm Hittdorf 1869 entwickelte Kathodenröhre zur Durchleuchtung von Personen in einer Kammer zwischen zwei Türen. Ähnlich, aber weit unauffälliger waren die Eingänge zum Palais und zum Amtsgebäude gesichert, und kein Postgut erreichte den Empfänger, ohne zuerst mittels Doktor Hittdorfs Erfindung untersucht worden zu sein. Die Posten setzten sich aus handverlesenen Unteroffizieren der verschiedenen Infanterie- oder Marineregimentern zusammen. Es waren Männer, welche sich aus dem Mannschaftsstand hochgedient und ihre Erfahrungen in Scharmützeln und kleineren Einsätzen gesammelt hatten, teilweise auch auf Kaperfahrten oder auf der Jagd nach feindlichen Piraten. Dem Kaiserhaus und den Donaumonarchien gegenüber absolut loyal und nicht immer zimperlich in der Wahl ihrer Mittel, Gefahren von diesen abzuwenden.
Als der Kommissär Walter Brunner mit Heinrich Navratil aus der Droschke stiegen, fiel ihr Blick auf das im Vergleich zur restlichen Straßenflucht zurückgebaute Gebäude des Äußeren Amtes, dessen Portal von zwei an der Taille aus einer Säule wachsenden weiblichen Torsi flankiert wurde. Jede trug die runde Darstellung einer der Hemisphären der Erdkugel auf ihren Schultern und sah trotz der Last immer noch fröhlich lächelnd den Besucher auf dem Vorplatz an. Der Künstler hatte sein Handwerk verstanden, man vermeinte beinahe das Haar aus Marmor flattern, die Augen aus Lapis Lazuli zwinkern, den blanken, naturalistisch dargestellten Busen sich heben und senken zu sehen. Über der Tür war in einer Kartusche das Motto des Amtes zu lesen, VERBA PRO ARMIS, darüber der bei offiziellen Gebäuden allgegenwärtige Doppeladler der Donaumonarchien, über dem rechten Haupt die Wenzels-, über dem linken die Stephans- und dazwischen die Rudolphskrone schwebend. Auf dem Auswärtigen Amt saß dieser zweiköpfige Adler auf einem Band aus einer Anzahl von bunten Wappen auf Metallschildern, jeder Staat der Monarchien war dort vertreten. Die Anordnung war streng chronologisch nach dem Zeitpunkt ihrer offiziellen Verleihung, die ältesten innen, dann abwechselnd links und rechts wechselnd, die neueren. Die einzige Ausnahme war das relativ neue Bundeswappen im Zentrum des Bandes – der früher einfach weiße Balken zwischen den beiden roten war nun weiß-blau gerautet und hatte oben eine grüne und unten eine blaue Begrenzungslinie von exakt einem Zehntel eines Drittels der Gesamtgröße eines Wappens, gleich daneben war das klassische rot-weiß-rote Bindenschild Österreichs, welches noch auf die Babenbergerherzöge zurück ging, und der weiß-blaue Rautenschild Bayerns, welcher nun einmal älter war als der silberne, doppelschwänzige Löwe auf rotem Feld Böhmens und das silberne Doppelkreuz über einem grünen Dreiberg mit goldener Krone auf rotem Feld Ungarns.
Das Foyer des Gebäudes war ein großzügig dimensionierter, heller Saal, welcher sich über zwei Etagen erstreckte. Im oberen Stockwerk wichen an drei Seiten des Raumes die Wände noch weiter zurück und bildeten so einen noch größeren Raum, von welchem das Erdgeschoss einzusehen war. Das Zentrum der Eingangshalle bildete ein beinahe drei Meter großer, nach allen Regeln der Kunst naturgetreu in drei Dimensionen modellierter Globus mit umlaufender Wendeltreppe, welcher sich in 24 Stunden einmal um sich selbst drehte. Ein heller Spot zeigte jederzeit den derzeitigen Sonnenstand akkurat an, für jeden der 365 Tage im Jahr. Weiter hinten waren im Halbrund einige Empfangspulte aufgestellt, wo sich jeder Besucher anzumelden hatte. Dahinter waren durch Panzerplatten gut geschützt die Wachposten, welche auch mittels eines Schalthebels eine durch starke Federn betriebene Stahlplatte vor den Empfangstischen aus dem Boden schnellen lassen konnten. Zum Schutz der hübschen Empfangsdamen, welche hinter den Tischen ihren Dienst versahen und mittels elektrischer Leitungen die Herrschaft über die Türriegel der Eingänge zwischen ihren Tischen ausübten.
Kommissär Walter Brunner und Heinrich Navratil schritten über das Mosaik am Boden, welches Szenerien und Landschaften aus den verschiedenen k.u.k. Kronländern auf der ganzen Erde zeigte.
„Kommissär Walter Brunner und Inspekteur Heinrich Navratil für Heinrich, Fürst zu Hametten, Fräulein!“
Die junge Dame sah auf ihrer Liste nach und nickte. „Bitte, Herr Kommissär, Inspekteur, durch diese Tür, und geben sie dort ihre Waffen ab, sie bekommen diese beim Verlassen des Gebäudes selbstverständlich zurück. Dann nehmen sie bitte den Lift Nummer römisch III. Sechster Stock, Raum sechs drei vier. Ich gebe dem Fürst Bescheid, dass sie unterwegs sind!“
„Danke, Fräulein…“ Er sah auf das Schild vor der Dame. „… Voght!“
Im sechsten Stock erhellten hohe Fenster den breiten Gang, in die Glasscheiben waren sorgfältig florale Muster eingeätzt, zwischen den Türen zu den Bureaus standen Büsten aus Bronze von österreichischen Herrschern. Angefangen bei den Babenbergern bis zur Regentin Helene und deren Frauen – beziehungsweise dem verstorbenen Kronprinz Franz Joseph.
„Sechs – drei – vier! Hier ist es, Herr Kommissär!“ Navratil klopfte an die Tür.
„Herein“, ertönte eine helle Stimme, und die Polizisten traten in ein großzügiges Zimmer mit einem großen Schreibtisch und jeder Menge Aktenschränke, hinter dem Tisch erhob sich eine etwa 35 Jahre alte Frau in einem schlichten Kostüm. Frau Elfriede Steyn hatte ein nichts sagendes Durchschnittsgesichts und einen schlanken Körperbau. Die Natur hatte bei den weiblichen Rundungen etwas gespart, was Fürst zu Hametten jedoch völlig egal war. Ihm war das Gehirn der Dame wichtiger. Und der Umstand, dass sie stets mindestens zwei druckbetriebene Flechette-Pistolen und drei Messer am Körper versteckt trug. Waffen, von deren Existenz er wusste, die er aber trotzdem nie sehen konnte.
„Kommissär Brunner? Inspekteur Navratil? Bitte kommen sie näher.“ Hinter den Beamten schloss sich die Tür, und die Sekretärin machte eine einladende Handbewegung. „Bitte folgen sie mir doch!“ Sie öffnete eine Tür am anderen Ende des Raumes und trat vor ihnen ein. „Durchlaucht, Kommissär Brunner und Inspekteur Navratil sind hier!“
„Sollen eintreten, Frau Elfriede!“, polterte es aus dem Arbeitszimmer, und Elfriede trat mit einer Geste beiseite, die den Weg freigab. Der Kommissär und der Inspekteur betraten das Allerheiligste des k.u.k. Evidenzbureaus.
„Durchlaucht, ich bitte zur Kenntnis zu nehmen, dass der Inspekteur Navratil vielleicht etwas interessantes gefunden hat“, rapportierte Brunner.
„Na, dann lass er doch hören!“ Der Fürst wies einladend auf zwei Stühle vor seinem mächtigen Schreibtisch.
„Durchlaucht haben von meinem kleinen Versteckspiel Kenntnis?“ Navratil setzte sich ganz vorne auf die Stuhlkannte.
„Aber ja“, lachte der Fürst. „Also jetzt nicht offiziell natürlich, sonst müsst‘ ich ja stante pede disziplinarisch tätig werden. Aber inoffiziell sprech‘ ich ihnen mein Lob für die schnelle Reaktion aus. Also, red‘ er weiter!“
„Nun ja, Durchlaucht, einmal hat die Hintwitz nach dem Rudelpu… also, nach einem ihrer freizügigen Fest…“
„Weiß schon, er muss nichts beschönigen“, winkte Hametten ab. „Auch ein Fürst ist Mensch und Mann. Also, was hat die Strichkatz‘ zu ihm g’sagt.“
„Also, sie hat davon g’sprochen, dass die Blitz‘ und Zähn‘ vom Messias in einem Berg in Africa g’schmiedet werd’n. Und dann hab‘ ich noch einmal den Bericht über die Gräfin Lichtenbach g’lesen, und ist mir der Name Toussidé aufg’fallen. Es gibt am Gürtel zwar ein Varietee mit angeschlossenem Stundenhotel mit diesem Namen, aber dort ist bisher nichts verdächtiges vorgefallen. Es verkehren in diesem Etablissement zwar auch ein paar Herren der Gesellschaft, die ein bisserl auf kleine exotische Spiele stehen, also, auf dunkelhäutige Frauen, auf Schleier und Haremsspiele und so ein Zeug halt. Aber diese gewerblich‘n Damen sind allesamt angemeldete Professionelle, und die Überprüfungen durch’s Strichreferat haben auch nichts wirklich linkes g’funden. Nur ein stinknormales – Durchlaucht entschuldigen den Ausdruck – ein Puff halt, mit ein bisserl nordafricanischem Flair. Ein bisserl auf maurisch hergerichtet halt. Aber es gibt in Tripolitanien, aber schon auf französischem Gebiet, einen erloschenen Vulkan, der ebenfalls Toussidé heißt, wahrscheinlich hat der falsche Franzose das Lokal sogar nach dem Berg benannt.“
Der Leiter des Evidenzbureaus erhob sich und sah auf die Straße hinunter.
„So“, brummte er. „Das war eine gute Arbeit von ihm, er war immerhin nur ein bisserl mehr als zwei Wochen langsamer als wir.“
„Durchlaucht?“ Brunner glaubte, sich verhört zu haben. Hametten breitete eine Karte vor den Polizisten aus, welche einen Vulkan mit einem tiefen Krater zeigte, von dem ganze Höhlensysteme in das Innere der Kraterwand zu führen schienen, zudem noch die Positionen der Wachposten.
„Wir haben von der Prinzessin einen Hinweis erhalten, dass sie den Vulkan für verdächtig hält“, erklärte der Leiter des Evidenzbureaus. „Also haben wir nachg’schaut. Die Erzherzogin hat wahrscheinlich nie von diesem Varietee gehört, also hat sie gleich an den Vulkan gedacht und nicht wie ein Wiener Kieberer an ein Bordell am Gürtel. Trotzdem ist er fündig worden, Inspekteur. Gut gemacht. Und jetzt schaun’s beide her, einer von unseren Sonderagenten hat diese Kart’n ang’fertigt. Nein, frag er nicht, wie, der Linienkapitän hat einige ganz besondere Talente, das muss als Erklärung erst einmal reichen. Also, wir haben jetzt die Bestätigung, dass dort etwas ist, und wir wissen auch, dass der Goldene Frühling eine riesige internationale Organisation ist. Wir wissen, es hat keinen Sinn, die Franzosen zu verständigen, weil die Frau des Kaisers denen verfallen ist. Und wir wissen auch, dass der Frühling spioniert und Söldner anwirbt. All diese Ergebnisse hätte man der Kommission in den nächsten Stunden ohnehin mitgeteilt. Also, wenn alles gut geht, können die Herren das Fräulein Hintwitz morgen früh im Landl besuchen gehen. Außer, einer ihrer Männer möcht‘ persönlich heut Abend die Verhaftung vornehmen.“
„Vielen Dank, Durchlaucht, ich für meinen Teil verzichte.“ Navratil schüttelte sich. „Schad‘ um das Chassis, weil gut ausschau‘n tut sie ja wirklich!“
„Dann werden wir wieder die Mistelbacher hinschicken“, beschied der Fürst.
„Mit welchem Haftgrund, Durchlaucht“, fragte Walter Brunner ein wenig unsicher. „Ich meine, wir sind doch ein Rechtsstaat, wir können nicht die Leute einfach so verschwinden lassen, nur weil’s uns nicht passen.“ Hametten setzte sich wieder hin und baute ein Dach mit seinen Händen.
„Gewerbsmäßige Unzucht ohne Gewerbeschein und ärztliche Kontrollen. Handel, Konsum und das Verabreichung von Betäubungs- und Rauschdrogen ohne Ausbildung zum Mediziner, Apotheker oder Drogist und Steuerhinterziehung“, zählte der Fürst auf. „Mit ein wenig Glück auch noch wegen gewerbsmäßigen Betrug‘s wegen ihrer Wahrsagerei – obwohl wir da ja eigentlich auch sämtliche Pfarrer, Rabbis und Muftis von Österreich in’s graue Haus bringen müssten. Auf jeden Fall könnte auch ohne Betrug ein Strafmaß über acht Jahr heraus schau’n, also können wir erst einmal eine Untersuchungshaft anordnen und dann auch deswegen Anklage erheben. Nachher – na ja, vielleicht redet ja noch einer von der Bagage im Häfen, und es wird noch mehr!“
=◇=
Französisch Tunesien
Martin, der Baron von Oberwinden, war 1850 nach Japan gereist und bis 1872 als Legationsrat für den Botschafter der Donaumonarchien am Hofe des Tenno in Kyoto gewesen. Er hatte dort die beginnende Veränderung des Landes von einem reinen Agrarland, in welchem die riesige Schar von Bauern jedes Reiskorn einzeln per Hand erntete und jedes Pflänzchen extra zog und wo die Soldaten eine stark bevorrechtete erbliche Kaste waren, zu einer wachsenden Industrienation aus nächster Nähe gut beobachten können. Selbstverständlich hatten sich die Samurai den Veränderungen, die oft mit einer Minderung ihrer Rechte einherging, öfter als einmal in den Weg gestellt, doch insgesamt war die Entwicklung nicht mehr aufzuhalten gewesen. Es war ein Prozess geworden, der langsam begann, dann aber immer schneller und unaufhaltsamer in Schwung kam. Ein Netz von Schienen für Eisenbahnen überzog in nur 20 Jahren sämtliche Inseln Japans, Dampffähren aus eigener Konstruktion, breite, flache Katamarane mit Werner-Dampfturbinen, warteten bereits auf die Züge, um die Passagiere auf die anderen Inseln zu bringen, wo sie ihre Fahrt fortsetzten. Auch das Straßennetz wurde zügig ausgebaut und bald belebten auch viele relativ kleine Dampfmobile aus eigener Produktion dieselben. Japan hatte nicht wenig für die Lizenz der Werner-Dampfturbinen und Vaporid bezahlt, aber kommerziell hatte sich die Ausgabe gelohnt. Viele neue Fabrikanlagen für moderne Gerätschaften und Maschinen wurden gebaut, und der Tenno rüstete eine private Armee als Leibgarde mit den modernsten Waffen aus. Er nahm allerdings keine Samurai in diese Einheit auf, die Garde hielt keine Paraden ab, exerzierte nicht, die Formalausbildung war nur ein Witz. Besser gesagt, sie war nicht vorhanden. Aber es waren Männer und Frauen, die seit ihrer Kindheit zu kämpfen und zu töten gelernt hatten. Mit Lanzen, mit Pfeil und Bogen, mit Schwertern, Messern und Gift. Wenn gar nichts anderes zur Verfügung stand, eben mit der bloßen Hand, dem Fuß oder den Zähnen. Es waren in der Öffentlichkeit mittlerweile Dutzende ihrer Tricks und Kampftechniken bekannt geworden, aber diese Soldaten kannten deren hunderte. Sie lebten seit Jahrhunderten in vielen größeren und kleineren Clans und hatten viele Namen, beziehungsweise, eigentlich hatten sie keinen wirklichen, keinen, den sie selbst benützten. Der japanische Volksmund nannte sie scheu und respektvoll zumeist einfach Ninja, die Verborgenen oder Hikage, die Schatten.
Auch in der Botschaft waren einige dieser Soldaten als Wächter ohne Uniform im Dienst, eine dieser Damen hieß Yoshiko Haschamoro und eroberte das Herz des Legationsrates Martin von Oberwinden im Sturm – und er das ihre. Die junge Dame war klein und zierlich gebaut, hübsch, hatte keine überaus stark ausgeprägte, aber durchaus aparte Lidfalte und wurde von allen Angehörigen der Botschaft als freundlich und nett eingestuft. Aber wie alle ihresgleichen wurde sie nicht als wirklich effektiver Wachposten und Schutz angesehen. Das änderte sich grundlegend, als sie eines Tages ihrem Ehemann die fünf Wochen alte gemeinsame Tochter Elisabeth in die Hände drückte, über das Geländer eines Balkons in den Innenhof sprang und einem Angreifer, der es auf das Leben des Botschafters abgesehen hatte, mit bloßen Händen scheinbar mühelos das Genick brach. Nach diesem Tag betrachtete man die kleinen, schlanken Frauen und Männer mit ganz anderen Augen und wesentlich gewachsenem Respekt. Als der Baron von Oberwinden nach Hause zurück kehrte, begleiteten ihn neben seiner Frau Yoshiko, seiner Tochter Elisabeth Mitsoku und seinem Sohn Karl Akiro zwanzig der freundlich lächelnden Wachposten mit den tödlichen Händen. Sie wurden ganz offiziell Ausbildner für einen Teil des gemischten k.u.k. Regiments 111 Orden des heiligen Leopold, nämlich für die erste Kompanie des Infanteriebataillons. Dieses sollte eine Elitewacheinheit werden. Und inoffiziell ganz geheim auch für die Uhus. Mit Geheimnissen kannten sich die Hikage aus, Jahrhunderte hatten sie im Untergrund gelebt, geheim und unerkannt.
Die Uhus ihrerseits waren ein Freiwilligencorps der k.u.k. Armee in der Stärke eines Bataillons mit drei Kompanien zu je 250 Soldaten, das es eigentlich überhaupt nicht gab. Nie gegeben hatte, nie geben wird, jede Nachricht darüber war, ist und wird immer frei erfunden sein! Ein Märchen, eine Legende, eine Zeitungsente – ebenso, dass die Fürstin Meszerökk es gerade mit ihrem Reitlehrer treiben soll. Nein, also warum sollt‘n die Donaumonarchien denn auch solch eine Trupp‘n aufstellen wollen? Geübt in der unsichtbaren Bewegung, im Infiltrieren von Festungen und Stellungen, absolute Nahkampfspezialisten, mit einem Wort – Schattenkrieger! Ninja! Hikage! Ja, wozu denn wohl? Vielleicht hat dem Kaiser damals die Vorstellung von unsichtbar‘n Kämpfern, welche Leib und Leben seiner Familie schützen könnt‘n, ganz einfach imponiert und g’fallen? Vielleicht einfach weil er es können hat oder vielleicht auch, weil’s ja wirklich nicht ging, dass der Tenno etwas hatte, was er nicht besaß? Ich bitt‘ sie, das ist doch alles wirklich völliger Unsinn! Es gibt in Österreich keine Schattenkrieger und die Fürstin Meszerökk ist eine absolut treue Ehefrau. Werwölfe? Österreich beschäftigt weder Werwölfe noch Vampire – also zumindest nicht wissentlich. Was ein Beamter in seiner Freizeit macht, wird ja in Kakanien nicht überwacht! Was, wie, andere Gestaltwandler? Ja, wo sollen die denn herkommen, bitt‘ schön. Wär‘ manchmal ja wirklich ganz praktisch, zugegeben – und vielleicht ist einer der Herren und Damen im Staatsdienst privat sogar wirklich ein Metamorphist. Dann soll er sich bitte melden, es gibt eine saftige Bezugserhöhung, wir hätten ein paar Aufgaben für solche Leut‘. Glauben’s mir doch bitte, und lassen’s jetzt endlich die Fürstin Meszerökk in Ruh‘, das ist doch tatsächlich eine ehrenwerte und treue Frau…
=◇=
Diese Truppe, die es eigentlich gar nicht gab, hatte einen Kommandanten. Es war Oberstleutnant Christoph Plautzen, der sich eben wie der Rest der Truppe bereitmachte, einige nicht existierende schwarze Luftschiffe mit beinahe lautlosem Teslaantrieb und noch geheimen starken Akkumulatoren der vierten Generation zu verlassen. Drei Stunden konnte das Luftschiff damit mobil bleiben und sich unhörbar anschleichen, ehe der Dampfkessel wieder gestartet werden musste. Die dunkle Kleidung der Kommandosoldaten konnte zu keinem Schneider zurück verfolgt werden, die dampfbetriebenen Waffen waren handelsübliche zivile Flechettegewehre aus allen Ländern Europas, die Dolche gute Marken, aber Massenware, auf die speziellen Bedürfnisse des Trägers von diesem selbst zurecht geschliffen. Niemand von ihnen trug Schmuck oder andere Gegenstände bei sich, welche im schlimmsten aller Fälle zu einer Identifizierung führen konnte. Lautlos glitten die Uhus an jeweils 10 Seilen aus den drei Luftschiffen auf den Boden und schwärmten sofort Truppweise zu zehnt aus, hundertfach geübt und trainiert. Ihr Ziel war der schwarze Schatten, der Berg dort nicht weit vor ihnen. Der Toussidé.
Einige Tage vorher hatte ein speziell für große Höhen konzipiertes Luftschiff mit einem eigens für den Ausstieg in 5.000 Metern Höhe gebauten Druckausgleichsraum den Linienkapitän Eugen Popescu, Herzog von Bistritz, über dem schwarzen, markanten Bergmassiv abgesetzt. Dieser hatte sich dann in seiner Gestalt als Adler dem Berg in der Morgendämmerung genähert. Niemand hatte auch nur den geringsten Verdacht geschöpft, Tiere fanden manchmal eben Wege durch und Wasser in der Wüste, wo Menschen schon lange umkamen. Der Linienkapitän hatte anderes als Wasser und Nahrung gesucht und es auch gefunden. Die körperliche Züchtigung eines Soldaten durch seine Kameraden, einige Mädchen, welche aus Löchern in der Wand des Vulkankraters kamen, diesen durchquerten und in einem anderen Höhlensystem wieder verschwanden. Fünf Dampfelephanten, die wirklich Radpanzer der britischen Armee, drei von den noch größeren, italienischen Jupiter-Landkreuzern und ein kleines Luftschiff, dessen Oberseite in der Farbe des hiesigen schwarzen Basalts gefärbt war. Während des Tages dann marschierten Truppen durch die Schluchten in die Wüste, wo sie Gefechtssituationen übten. Einige Fahrer preschten mit den Fahrzeugen durch die Wüste, die Artilleristen übten Zielschießen auf herum liegende Felsen. Und er fand einige Posten, sowohl im Inneren des Kraters, wo Beduinen hinter Maxim-Gewehren saßen und den Kratergrund im Auge behielten als auch außerhalb, an den Zugängen. Auch MG-Nester, welche die Eingänge beherrschten und Minen an den Zugängen. Aber insgesamt waren mehr Posten im Inneren als zur Außenverteidigung vorhanden, so wirklich schien hier niemand mit einem Angriff zu rechnen. Herzog Eugen hatte nicht nur gute Augen, sondern auch ein gutes Gedächtnis, seine Planskizzen hatten schon mehr als nur eine Person in Entzücken versetzt, sie waren akkurat, genau und gut lesbar. Und waren auch eine große Hilfe für Oberstleutnant Plautzen und seine Männer, welche nicht die Gabe des Fliegens besaßen. Dafür hatten einige von ihnen andere Talente.

Ludwig ‚Vickerl‘ Auer schnupperte in die Nacht. Dieser Hauch kam nicht von einem Tier, so roch nur ein Mensch, ein Posten, es musste einer sein – nein sie waren zu zweit! Seine großen, beweglichen Ohren spielten und versuchten auch das leiseste Geräusch aufzufangen. Dann wandte er sich beinahe lautlos flüsternd an den Zugskommandanten.
„Da vorne mach’n zwei auf ‚englische Marine‘, Chef. Eine verdammt lasche Dienstauffassung. Woll’n wir?“ Er fuhr mit dem Zeigefinger über seine Kehle.
„So blöd kannst nur du frag’n, Vickerl. Jetzt mach schon!“ Und Ludwig verschmolz noch mehr mit den Schatten. Er konnte das gut, so gut, dass sich Johannes ‚Jo‘ Spengler manchmal fragte, ob der Mann nicht vielleicht ein…
„Wir könn’n weiter, Chef. Einer von denen, also der aktivere bei dem Spiel, war ein Offizier. So ungeniert, wie der sich einen beim Posten abg’arbeitet hat, vielleicht sogar der Wachoffizier selber. Der war sich so sicher, dass Keiner nachschau’n kommt!“
„Ersparen’s uns doch bitte weitere ungustiöse Details, Vickerl“, bat Spengler.
„Sicher Chef. Weiter?“
„Weiter!“ Bald betraten sie als erster Trupp das ausgedehnte Höhlensystem.
„Stellung beziehen und auf die anderen warten“, befahl Jo. „Pirošorr, vor zur nächsten Ecke dort. Lauschposten beziehen. Die andern, Gusch!“
„Gäht klår, Schääf!“ Der kleine Ungar hastete nach vor und setzte sich dort mit dem Rücken an die Wand gepresst nieder. Lange dauerte es nicht, und die fünf Gruppen des ersten Zuges waren komplett.
„Sehr gut, Leute“, freute sich der Zugskommandant Conny. „Also, geh’n wir‘s an. Jos Gruppe übernimmt wieder die Spitze.“
Der Stollen, durch welche der Zug eindrang, war verwinkelt und bei einer der letzten Eruptionen entstanden, sie liefen auf einen erkalteten Lavastrom. Man konnte richtig sehen, wie sich das dunkelrot glühende Gestein Meter um Meter durch den tektonischen Riss gewälzt hatte, der an manchen Stellen sieben, acht Meter hoch war. Ein Kabelstrang an der Decke, von dem ab und zu eine Göbelbirne hing, tauchte den Gang in stetiges Dämmerlicht, gerade genug für etwaige Personen, welche auf dem Weg zur Wachablöse waren. Und für Posten im Inneren des Stollens, Eindringlinge rechtzeitig zu erkennen. Vickerl rechnete mit einer weiteren Wache, als sich vor ihm der erste dieser Felsendome auf dem Weg auftat. Einfach deshalb, weil er selbst es nicht anders eingerichtet hätte. Eine versteckte Kanzel mit gutem Schussfeld – nun, letzteres war sicher kein Problem. Wieder wurde Vickerl für die Augen seiner Kammeraden regelrecht unsichtbar.
„Wie so ein verdammter Geist“, fluchte Franz ‚Rotschäderl‘ Spengler beinahe unhörbar. Vorne war fünf- sechsmal das leise ffft eines Flechettegewehres zu hören, dann flüsterte Vickerls Stimme von irgendwo her.
„Wir können weiter!“ Sie beeilten sich, den Felsendom zu durchqueren, der Platz erinnerte immer noch zu sehr an einen Präsentierteller.
„Dort oben“, zeigte Vickerl seinem Chef zwei Gestalten, welche auf einer Plattform hinter einem Maxim-Gewehr lagen, ein Karabiner lag drei Meter unterhalb. „Der Ladeschütze war aufmerksam und net schlecht. Fast hätt‘ er mich g’habt, aber ich war der Schnellere.“ Jo nickte. Risiko, auf beiden Seiten. ‚Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen‘. Ja, eh klar, keine Frage, der Typ hatte das Leben als Söldner gewählt, nun war es eben zu Ende. Jo selbst hatte sich für die Truppe mit Hochrisikoeinsätzen beworben, bisher hatte er das Glück auf seiner Seite gehabt, aber vielleicht, nein, wahrscheinlich würde es ihm eines Tages ebenso gehen.
„Weiter, Vickerl“, flüsterte er.
÷
Der Söldner Jean Tribout hatte ein Problem, das ihm in dieser Nacht den Schlaf raubte. Seine Eingeweide waren voll, übervoll sogar, und doch, so sehr er sich bemühte, seine Därme wollten sich einfach nicht und nicht entleeren. Sein gepresstes Stöhnen hallte lautstark durch den großen Raum mit den kleinen Abteilungen. Die Tür öffnete sich, leise Sohlen bewegten sich durch den Raum, dann wurde die Tür zu Jeans Verschlag aufgerissen, Tribout sah erschrocken auf und blickte genau in die Mündung einer großen Flechettepistole. Sekundenbruchteile, bevor er starb, fühlte er noch eine große Erleichterung, als seine Gedärme endlich doch nachgaben.
„Fåst tut är mir leid!“ Makacs betätigte die Spülung unter dem Toten. „Håst du gäsähän Ärleichtärung auf sein Gäsicht, bävor ich håb åbdruckt?“
Palká zuckte nur mit den Schultern. „Geh’n wir weiter, Makacs.“ Die beiden schwarz gekleideten Gestalten mit den nur die Augen freilassenden Hauben aus dünner Baumwolle huschten beinahe lautlos weiter.
÷
Der Schlafsaal wurde nur durch wenige schwache Lämpchen über den Türen beleuchtet, gerade hell genug, um den nächsten Ausgang zu finden. Je dreißig schmale Kojen standen sich in zwei Reihen gegenüber, und in einer wälzte sich Ingeborg Zukalsky von einer Seite zur anderen. In Berlin hatte sie sich der Dienst für die Sache des Goldenen Frühlings in Israel noch ganz anders vorgestellt. Aber dann war ihre Reiseroute plötzlich eine andere geworden. Und einmal hier angekommen, musste sie feststellen, dass sie nur wie eine gewöhnliche Prostituierte behandelt wurde, nein eigentlich sogar noch schlimmer. Als einzige Gegenleistung für ihre ständige Verfügbarkeit – denn jederzeit konnte ein Söldner die Erlaubnis bekommen, sie aus ihrem Bett oder einer zugewiesenen Arbeit weg zu holen und in das ‚Arbeitszimmer‘ zu schleppen – bekam sie nur karge Kost und diesen Saal als Logis. Und spielte sie nicht freiwillig mit, gab es kein Wasser, kein Essen, nichts außer Prügel. Ein nicht enden wollender Alptraum, und was geschah denn, wenn sie für dieses Gewerbe zu alt, zu hässlich, zu krank wurde? Musste sie dann verdursten? Elend zugrunde gehen? Oder erlöste man sie vorher von ihren Qualen? Mit einer schnellen Kugel oder einem scharfen Messer? Aber, wie auch immer ihr Ende hier aussehen mochte, sie hatte keinen Einfluss darauf. Überhaupt keinen. Sie wusste noch nicht einmal, wer sie hier gefangen hielt. Und wo dieses hier denn eigentlich lag.
Die beiden Türen wurden leise geöffnet, schwarze Gestalten schlichen durch das Halbdunkel, dann flammten die großen Deckenlampen auf und überfluteten den Saal mit ihrer mitleidlos grellen Helligkeit. Die Frauen fuhren aus dem Schlaf auf, war es denn schon Morgen, war es an der Zeit für den Servierdienst?
„Frauen!“ rief eine Stimme, und Ingeborg starrte den breitschultrigen Riesen am Fußende ihren Bettes an, der die Mündung einer Pfeilwaffe auf sie gerichtet hatte. Die Mündung derselben bewegte sich jetzt einen Millimeter zur Seite und wies nicht mehr direkt auf ihr Gesicht, sondern knapp an ihr vorbei. Vorsichtig legte sie die Hände mit der Handfläche nach oben auf die Decke und erhielt dafür ein kaum merkliches Nicken.
„Meine Damen, bitte verlassen sie den Raum in der nächsten Zeit nicht, dann wird ihnen kein Leid zugefügt.“ Der Mann mit einer gelben Raute auf der Schulter sprach akzentfrei französisch.
„Je dois faire pipi. Urgent!“ Der Stimme nach war das die kleine Michelle aus Paris, frech und mit noch immer ungebrochenem Mut. Trotz aller Repressalien und Bestrafungen seit ihrem Eintreffen bereits vor Monaten. Sie war so etwas wie ein emotionaler Anker für die dreißig Mädchen in diesem Schlafsaal geworden, obgleich sie die kleinste und zarteste unter ihnen allen war.
Der Offizier nickte. „Tres bien alors. Wo ist das Bad?“
„Gegenüber, mon Capitaine“, beschied Michelle.
„Lieutenant, Mademoiselle. Sergent, nehmen sie zwei Männer und kontrollieren sie das!“ Einer der Männer mit Winkeln auf dem Ärmel winkte zwei andere zu sich, verschwand mit ihnen und kam nach kurzer Zeit zurück.
„Tout va bien, mon Lieutenant!“
„Also, meine Damen, wer wie diese junge Dame einmal Pipi muss, dann bitte, aber nur immer eine nach der anderen. Sie…“, deutete er auf Michelle. „Sie zuerst, die anderen bitte dann der Reihe ihrer Betten nach. Bleiben sie ruhig, und es wird ihnen nichts geschehen! Ich verspreche es.“ Die kleine Französin schwang sich aus ihrem Bett und ging trotz ihrer Nacktheit in aufrechter Haltung und einem ungemein stolzen Gesichtsausdruck an den Soldaten vorbei.
÷
Einige Stockwerke höher deuteten die größere Anzahl der Türen auf kleinere Zimmer, wahrscheinlich also für einzelne und damit höherrangige Personen hin. Offiziersunterkünfte, den Aufschriften nach. Vickerl Auer schlich mit Gigerl Bäcker näher an die erste Tür, und Gigerl ging neben Tür in Stellung, die Waffe schussbereit in der Hand. Leise und vorsichtig öffnete Vickerl die Tür und verharrte kurz. Dann machte er den Zugskommandant auf sich aufmerksam.
„Zwei Personen“, sprachen seine Hände. „Eine Frau!“ Rasch stoppte der Zugskommandant den Vormarsch und teilte Dreiergruppen ein.
„Frauen möglichst lebend befreien, Männer nur wenn’s wirklich leicht geht lebend gefangen nehmen. Kein Risiko eingehen.“ Die Tür öffnete sich weiter, die Soldaten waren wie Schemen, wie Gespenster. Eine schwarz behandschuhte Hand legte sich auf den Mund von Bronween Llydwender und erstickte ihren erschrockenen Schrei, während zwei Männer Capitaine Claude Misetout überrumpelten und rasch fesselten und knebelten.
„Bleiben sie bitte still, Mademoiselle, ziehen sie sich etwas über und kommen sie mit.“
„Etwas überziehen? Ich – das darf ich doch nicht, der Capitaine hat es mir verboten, weil ich zu frech wurde. Und ich besitze doch auch gar nichts mehr.“
„Merde!“ fluchte der Schwarzgekleidete, dann riss er den Spind des Capitaines auf und reichte der Frau ein weißes Hemd, das zumindest lange genug war, ihre Blöße notdürftig zu bedecken. „Hose kann ich ihnen leider noch keine anbieten, die von diesem Bastard passen ihnen ja leider doch nicht. Aber irgendwo wird es wohl eine Kleiderkammer geben. Und jetzt kommen sie bitte mit! Aber kein lautes Wort.“ Sie verließen die Kammer wieder und ließen den gut verschnürten Söldneroffizier zurück, welcher ihnen mit flammenden Augen nachsah. Was er gegen den Knebel schrie, blieb völlig unverständlich. Außer einem gedämpften Hmpf Mpf war nichts zu vernehmen.
Draußen kamen auch die anderen Gruppen wieder auf den Gang.
„Wir mussten den Chef de Bataillon da drinnen in der Kammer leider liquidieren“, meldete Whisky. „Aber wenn ich mir die Veilchen und die Handgelenke vom Mädchen aus seinem Zimmer anschaue, ist es wirklich nicht schade um dieses Vieh. Nur, dass es so schnell gestorben ist!“
„Es haben genug andere überlebt, die man verhören kann. Die Damen aus den Offiziersräumen in dieses Zimmer, die Leiche von dem Schwein darin könnt ihr einstweilen hier draußen auf dem Gang ablegen“, bestimmte Leutnant Conny, dann wandte er sich an die Frauen. „Bitte, meine Damen, bleiben sie bis auf weiteres in diesem Raum. Sie haben mein Wort, dass ihnen nichts Übles geschehen wird, wenn sie nicht laut werden. Weiter, die nächsten Räume!“
÷
Im Gang der dritten Kompanie der zweiten Legion saß am Tisch des Chargen vom Tag zum Zeitpunkt des Überfalls Legionär Wladimir Alexandrowitsch Medwed aus Kiew, der Name Medwed, Bär, passte ganz gut zu seiner großen, behaarten Statur, und wie sein Namensgeber war er trotz seiner Masse und seines stupiden Gesichtes schnell von Begriff und flink in der Bewegung. Sein Mitcharge hatte sich vor kurzer Zeit für seine vier Stunden Ruhe zurück gezogen, und die einzige Abwechslung, welche Wladimir jetzt noch erwartete, war der Besuch des Offiziers vom Tag. Aber heute hatte Majeur Anton Kolinski Dienst, und der Unteroffizier machte selten einen Kontrollgang. Also nahm Wladimir die Beschreibung der neu ausgegebenen Dardick-Revolverpistolen zur Hand und studierte deren Aufbau. Ein winziges Schaben erreichte das Ohr des Russen, er sah auf und eine schwarze Gestalt in der Tür zu seinem Gang stehen, welche eine Waffe mit dickem Lauf auf ihn richtete. Seine Hand, die zum Dardick fuhr, erreichte noch den Kolben der Waffe, dann löschten fünf winzige Pfeile sein Leben aus. Beinahe lautlos, denn ein leises Röcheln kam noch aus der zerfetzten Kehle von Wladimir Alexandrowitsch Medwed.
Die einfachen Legionäre der Asnan Alrabi, oder der Beni Yasue, wie sie sich auch öfter nannten, waren halbzugsweise in Schlafsälen untergebracht, jeweils dreißig Mann in einem Raum. Zwischen den beiden Reihen mit Betten standen einfache Tische und Holzbänke, am Fußende der Betten jeweils eine Truhe und links vom Kopfende ein schmaler Spind. Abgedeckte Nachtlichter sorgten normalerweise für gerade genug Dämmerlicht, um bei einem nächtlichen Toilettengang die Tür und danach sein Bett wieder zu finden. Und es half jetzt den Kommandosoldaten, welche sich so gut wie unhörbar im Raum verteilten.
„Feuer“, befahl die ruhige Stimme von Lieutenant Scaramouche, und die Flechettegewehre der Kommandosoldaten zischten einige Male leise auf, die Schwarzgekleideten untersuchten rasch ihre Opfer auf Lebenszeichen.
„Fertig!“
„Weiter, nächster Raum!“ Dieselbe ruhige Stimme wie vorhin, die nicht existierenden Uhus verließen den Raum, um sich den nächsten Saal mit dreißig Schläfern vorzunehmen.
÷
„Mon Colonel!“ Ein einfacher Soldat salutierte vor dem Befehlshaber der Angriffstruppe. „Mit besten Empfehlungen des Lieutenant Joueur, wir haben so etwas wie ein Stabsbureau gefunden.
„Bringen sie mich hin“, verlangte Oberstleutnant Christoph ‚Grand Chef‘ Plautzen. Die Kommandogruppe deckte den Marsch des Oberstleutnant zu einem Saal, in welchen einige Karten der Umgebung und ein Stadtplan hingen. Mit detaillierten Angaben zu den Forts rings um die Stadt.
„Zum Teufel noch einmal. Das ist doch…“, entfuhr es dem Oberstleutnant.
„Richtig, Grand Chef, das ist Jerusalem. Hier der Tempelberg, die Grabeskirche und der Garten Getsemane auf dem Ölberg, alles zu erkennen. Hier sind die Forts gut zu erkennen, welche sie Stadt wie ein Ring umgeben. Nur Stambul und Mekka haben im osmanischen Reich stärkere Festungen aufzuwarten. Aber mit genügend Flug- und Luftschiffen kann man schon eine Schneise für einen Angriff von Infanterie schaffen.“
„Dann sollten wir das schon wirklich ernst nehmen. Belichtet ein paar photographische Platten, und schafft mir die ersten von den Offizieren heran. Ich denke, wir werden sie gleich hier in diesem Raum vernehmen. Gute Arbeit, Lieutenant!“
=◇=
Insgesamt fanden die Eingreiftruppen des Oberstleutnant Christoph Plautzen in den Höhlen des Vulkans Toussidé beinahe 8.000 Männer und nicht ganz 600 Frauen vor, als sie alle Räume durchsucht hatten. Mannschaftsgrade und Unteroffiziere in den großen Räumen hatte man wenn möglich gleich im Schlaf eliminiert und auch mit den Lieutenants kurzen Prozess gemacht. Zum Glück hatten die Zähne des Herrn ebenfalls, wie jede andere Militäreinheit, den Rang und aktuell benutzten Namen der Bewohner an der Tür vermerkt, wobei der Name allerdings ohnehin nicht sehr vertrauenswürdig war. Es dauerte gar nicht lange, und die Frauen, welche ohnehin in einem abgetrennten Bereich der Anlage untergebracht waren, durften sich auf den Gängen ihrer Unterkünfte wieder frei bewegen. Auch eine Kleiderkammer wurde gefunden, und die Damen konnten mit Uniformen der Söldnertruppe ausgestattet werden. Auch wenn es sich nur um Kleidung mit wenig Chic handelte, waren die Mädchen doch glücklich, endlich wieder vollständig bekleidet zu sein. Sie fühlten sich, als wäre ein großer Druck bereits jetzt von ihnen genommen worden, auch wenn ihre Zukunft immer noch mehr als unsicher war. Bis endlich ein Mann mit drei Rauten und einer Handvoll Männer zu ihnen kam und sie auf französisch ansprach.
„Meine Damen, sie werden jetzt in Gruppen mit Luftschiffen an eine Bahnstation gebracht, mit dem dort verkehrenden Zug erreichen sie Tunis etwa zwölf Stunden, nachdem sie unsere Schiffe verlassen haben. Selbstverständlich werden sie mit ausreichend Barmittel ausgestattet, um wieder nach Hause, wo immer das sein mag, zurück zu kehren. Bitte kommen sie mit nach draußen, die Luftschiffe werden sie dann schon erwarten.“
„Was ist mit den Männern, die hier gelebt haben“, fragte die blonde Solveig Svenson schüchtern.
„Die werden allesamt niemandem mehr weh tun“, versprach der Mann. „Nie mehr! Nein, fragen sie besser nicht weiter. Aber geben sie in Zukunft bitte besser auf sich acht und fallen sie nicht wieder auf falsche Versprechungen herein. Und jetzt, bitte folgen sie mir!“
Und wirklich lagen kurz darauf, als die Frauen frisch eingekleidet zum ersten Mal als freie Menschen den Kratergrund betraten, fünf gigantische schwarze Luftschiffe dort vor Anker, die Rampen waren bereits ausgefahren.
„Also bitte, meine Damen!“ Soldaten verteilten auch noch Proviant und Wasserflaschen an die Befreiten, während diese in die Schiffe stiegen und den Schildern in französischer Sprache folgten.
„Merde“, rief Michelle jubelnd aus. „Wir haben aber ganz tolle Luftschiffe und Soldaten in Frankreich. Danke, mein Kaiser!“ Dann wurde das dumpfe Grollen in den Dampfleitungen lauter, als die Ventile weiter geöffnet wurden, und die Luftschiffe machten sich auf den Weg. Dass die Turbinen eigentlich an Tesla-Generatoren gekoppelt waren, welche den elektrischen Strom für den Antrieb lieferte, merkte von den jubelnden und plaudernden Passagieren niemand.
„Haben wir alle wichtigen Papiere und die Protokolle der Vernehmungen“, fragte Oberstleutnant Christoph Plautzen, als die Luftschiffe etwa einen Tag später von der Bahnstrecke nach Tunis zurückkehrten und wieder im Krater landeten.
„Oui. Mon Colonel!“
„Dann geben sie Befehl zum Abrücken, Comandant. Wir verschwinden von hier! Sofort!“
=◇=
In Tunis rief das Eintreffen von beinahe 600 Frauen einiges an Erstaunen hervor, besonders als sie sich bei der französischen Verwaltung meldeten und das Geschehene berichteten. Sofort liefen die Kabel heiß, als alles nach Paris gemeldet wurde, doch dort war man ratlos. Die Armeeführung wusste nichts von derart großen Luftschiffen oder einem Einsatz von Soldaten. Sie sandte aber sofort die dritte Kompanie der fünften Luftlandeinfanterie der französischen Légion étrangére mit den dazugehörigen Luftschiffen los, um sich ein Bild von der Lage zu machen. 1889 sagte man der Légion nach, sie sei die am besten ausgebildete und zäheste Infanterie ihrer Zeit. Wie auch immer man zu ihren Kampfqualitäten stehen wollte, zäh und hartgesotten waren sie wirklich. Sie waren während ihrer Ausbildung buchstäblich durch eine Hölle gegangen, denn sie wurden in Africa ausgebildet. Entweder im Dschungel der Äquatorgebiete, wo während der Regenzeit die schwüle, feuchte Hitze herrschte, oder in der Sahara, wo die trockene Hitze die Feuchtigkeit aus den Leibern zog. So oder so, wer diese schmerzhafte Ausbildung überlebte, gehörte wirklich zu den zähesten Personen in Uniform, welche jede Furcht verloren hatten. So leicht konnte man einen Legionär nicht schockieren. Aber zumindest immer noch überraschen.
Die FD KARDINAL MAZARINE, die FD CHARLES DE ROCHEMORT und die FD JEAN JUNEAU hatten den typischen zigarrenförmigen Rumpf der Luftschiffe ihrer Zeit. Das Passagierdeck war allerdings komplett unterhalb der Hülle untergebracht, mit aufblasbaren Kufen für die Landung beiderseits der Gondel. Entgegen der Bezeichnung ‚leichter als Luft‘ war ein Luftschiff trotz der Gaszellen nicht völlig ohne Gewicht. Ohne Motorleistung sank es langsam, aber unaufhaltsam zu Boden, daher auch die Kufen. Angetrieben wurde die MAZARINE und ihre Schwesterschiffe durch drei ummantelte Zugschrauben auf jeder Seite, welche um 180 Grad gedreht werden konnten. Auffällig war bei diesem Typ das Seitenleitwerk, welches zweigeteilt hoch oben am Rumpf angebracht war, um während der Landung nicht mit dem Boden zu kollidieren. Jedes dieser Schiffe trug einen Zug Infanterie, das waren drei volle Kampfgruppen zu je zwölf Mann mit Bewaffnung und Marschgepäck, also 36 Mann.
Diese drei ‚Absetzschiffe‘ begleitete ein sogenannter ‚Deckungskreuzer‘. Oder wie die Luftlandesoldaten diese Schiffe auch liebevoll nannten, ein ‚Merde de Balle‘. Die CYRANO DE BERGERAC hatte einen inneren Rumpf, der wie ein verkehrtes T geformt war. Der untere waagrechte Teil trug an allen vier Ecken je eine Kanone im Kaliber 12 Zentimeter und an den Breitseiten je 30 Maxim-LP (longue portée, hohe Reichweite) Maschinengewehre. Diese schweren Maschinengewehre hatten keine wirklich großen Kaliber, es waren nur 8,3 Millimeter. Aber die Patronen trugen im Vergleich zu dem üblichen 7,62 Millimeter die doppelte Pulverladung, was Reichweite und Durchschlagskraft erheblich vergrößerte. Im senkrechten Teil des inneren Rumpfes waren die Maschinen und die Steuerkanzel untergebracht. Beiderseits dieses Teiles waren dann in zwei zylindrischen Körpern die Gaszellen angebracht. Die Hauptaufgabe der CYRANO DE BERGERAC war die Sicherung des Landevorganges der Infanteristen. Durch massives Feuer aus eben diesen Maxims. Wenn alle 30 Maschinengewehre gleichzeitig feuerten, ergossen sich 24.000 Bleikugeln in der Minute über den Gegner. Genug, um diesen zu nötigen, den Kopf in der Deckung zu behalten. Man konnte also sagen, dass der Spitzname ‚Kugelscheißer‘ nicht so ganz ohne Berechtigung war.
„Wir nähern uns dem Krater, Capitaine“, meldete der Tradition folgend Fregattenkapitän Louis de Croix Capitaine Jaques Mantour, dem Kompaniekommandant der Infaneristen. Der Gascogner nickte bestätigend.
„Danke, Commandant. Lassen sie bitte das Signal ‚Vorbereiten zum Absetzen‘ geben. Auch per Lichtsignal an die anderen Einheiten.“
„Gerne, Capitaine!“ Fregattenkapitän de Croix nickte seinem Bootsmann zu, dieser drückte einen großen Knopf in seine Fassung und der dumpfe Klang einer Dampfsirene riss die Legionäre aus ihrer Entspannung. Dann wandte sich der Bretone an den Rudergänger. „Maschine zurück auf minimale Fahrt!“ Der Steuermann griff zum Maschinentelegraphen und drückte Hebel beinahe bis zum Anschlag.
„Jawohl, mon Commandant“, bestätigte er. „Minimale Fahrt voraus.“ Das Luftschiff wurde merklich langsamer und trieb bald wie auch die anderen mit weniger als 10 Stundenkilometern weiter. Im unteren Teil des Schiffes knöpften die Soldaten ihre hüftlangen Uniformröcke zu und schlossen ihre Koppel mit den Dienstrevolvern und den Munitionstaschen, zogen sich warme Wollmützen bis über die Ohren und setzten ihre Sandbrillen auf. Dann schulterten sie ihre Tornister mit den über Brust gekreuzten Gurten und befestigten diese am Koppel, ebenso wie den zwischen den Beinen durchgehenden Y-Gurt. Zuletzt befestigten die Legionäre ihre kurzen Repetiergewehre am Gurtzeug so, dass sie nicht ausschlagen und das Gleichgewicht stören konnten.
„Also Männer, dann wollen wir mal wieder“, forderte Lieutenant Germain Tulliere das erste Peloton der Kompanie auf, welches sich an Bord der KARDINAL MAZARINE befand. „Sergent, antreten lassen!“
Sergent Wladimir Ragulin salutierte. „Zu ihren Diensten, mon Lieutenant!“ Der Akzent verriet den gebürtigen Russen, als er sich an die Legionäre wandte. „Also, Mademoiselles! Auf die Beine! Truppweise Aufstellung. Vite, vite!“ Es ging schnell, die Männer kannten ihre Plätze in der Aufstellung. Dann erlaubte der Sergent bequemes stehen und erstattete dem Leutnant seine Meldung. Der ging nun durch die Reihen und kontrollierte jedes einzelne Gurtzeug peinlich genau.
Dann nickte er seinem Sergent zu. „Übernehmen sie, Sergent!“ Der wandte sich nach der Befehlsbestätigung an die Truppe.
„Leute, ihr wisst ja aus den Vorbesprechungen, worum es geht. Seht zu, dass ihr zuerst einmal über den Krater kommt, und dann vorsichtig runter. Wir sind dieses Mal die ersten! Klar, das ist das größte Risiko, aber auch die größte Ehre. Also macht Väterchen Wladimir keine Schande. Den wenn…“ Er starrte Sekunden lang seine mächtigen Pranken an.
„Es würde euch nicht gefallen“, brüllte der gesamte Zug im Chor zurück.
„Richtig. Also los. Aaachtung! Im Schritt – Marrrsch!“ Im Gleichschritt marschierten die Legionäre die Treppe hinab in den Absetzraum. Dort hakte sich jeder mit seinen Tragegestell an einen der le Bries – Gleitdrachen mit langen Flügeln aus Balsa und Leinwand und wartete. Auf der Brücke kontrollierten Commandant de Croix und Capitaine Mantour laufend den Standort.
„Stopp! Position halten“, rief der Fregattenkapitän schließlich. „Es ist soweit, Capitaine. Viel Glück“, wandte er sich an Mantour.
„Danke Commandant. Klappe öffnen in fünf Minuten.“ Rasch eilte er in den Absetzraum, sich auf dem Weg fertig machend. Dann trat er an den ersten Segelgleiter, hakte seine Schultergurte ein und hob das Lenktrapez. Die mächtige Bugklappe begann sich zu öffnen, der Capitaine nahm einen kurzen Anlauf und sprang als erster hinaus. Er zog an einem Griff, Riegel schnappten auf und entfalteten den Hängegleiter auf die volle Spannweite von 6 Metern. Nach einer kurzen Orientierung nahm der Capitaine Kurs auf den Vulkankegel des Toussidè.
1853 hatte Jean Marie le Bris seinen ersten Gleitversuch mit einem dem Albatros nachempfundenen Fluggerät versucht. Es misslang, das Ergebnis war nicht mehr als ein Hopser über fünf Meter und ein gebrochenes Bein. Doch der Bretone blieb stur. Er studierte noch intensiver die Flügel der Vögel und beobachtete den Flug derselben. Fünf Flugmodelle und noch mehr gebrochene Knochen später war die Albatros, ein Hängegleiter mit 9 Meter Spannweite fertig und er stürzte sich damit von einer Klippe in der Bretagne. Dieses Mal funktionierte es über all seine Erwartungen. Das Gerät sank kaum mehr ab und ließ sich überraschend gut durch Gewichtsverlagerung steuern. 1878 versuchte er, vom Boden aufzusteigen. Die nun mit Rädern ausgestattete Albatros sollte von einem Dampfmobil gezogen auf Höhe gebracht werden. Die Idee war gut, das Militär erkannte ein gewisses Potential und finanzierte weiter Forschungen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen, eine Gleitzahl von 15 bei einer Spannweite von nur 6 Metern. Nach der Erfindung der Luftschiffe stellte die französische Armee sofort spezialisierte Luftlandetruppen zusammen. Auch ein Regiment der Fremdenlegion wurde für Absetzmanöver aus dem schwebenden Luftschiff ausgebildet.
Dieses Absetzmanöver in der Luft hatten die Fremdenlegionäre oft und oft geübt. Sie kannten die Tücken, wenn sie die Winde außerhalb der Luftschiffe erfassten, sie erahnten die Thermik unterbewusst, noch ehe ihr Gehirn alle Informationen verarbeitet hatte. Die Gleitflieger wurden über einen trapezförmigen Holzrahmen durch Gewichtsverlagerung gesteuert, alle Mitglieder der Luftlandetruppen beherrschten diesen Flug beinahe im Schlaf. Nachdem alle 110 Offiziere und Mannschaften in der Luft waren, beschleunigten die Luftschiffe wieder und flogen voran. Die Maxim-Schützen luden ihre Waffen durch, nachdem die Ladeschützen die Munitionsgurte eingelegt hatten. Ihre Augen wanderten über die in Sicht kommenden Berghänge, um jede Bewegung zu registrieren. Doch sie erkannten keine. Die Luftschiffe erreichten schließlich den Kraterrand und überflogen ihn. Etwa 34 Stunden, nachdem die Uhus den Berg verlassen hatten.
Hinter den Luftschiffen näherten sich die Infanteristen mit ihren Gleitdrachen wie ein großer Vogelschwarm. Sie näherten sich aus jener Richtung, in welcher sich die Sonne eben dem Horizont zuneigte. Eine übliche Taktik, um so lange wie möglich für den Feind unsichtbar zu bleiben. Die Thermik erlaubte es den Legionären, zuerst sogar noch ein Stück zu steigen, dann begann Jaques Mantour an der Spitze des ersten Pelotons den Abstieg. Über allem schwebten die vier Luftschiffe, die Maxim-Gewehre nach wie vor feuerbereit, deren Schützen und einige Beobachter mit starken Ferngläsern weiterhin wachsam.
„Mon Lieutenant!“ Matrose Karl Mantler war aus Köln, mehr wussten seine Kameraden von ihm nicht, es war auch nicht weiter wichtig. Und außerdem – man stellte in der Légion einfach keine persönlichen Fragen, das lernte man ganz schnell. Und wenn es der letzte Lernprozess war. Der Leutnant kam zu Mantler gegangen, er kannte und vertraute dessen scharfe Augen.
„Was gibt es, Matrose?“
„Dort unten sind in der Kraterwand Maxim-Nester, welche das gesamte Innere des Kraters unter Feuer nehmen könnten“, berichtete der Kölner. „Aber keine Menschenseele!“
„Das deckt sich mit den Berichten“, überlegte Leutnant Luc Bisserote. „Gut gemacht, Matrose. Aber bleiben sie trotzdem weiter wachsam. Vielleicht sind von den Männern, welche den Vulkan überfallen haben, noch welche anwesend. Wir wissen nichts von deren Plänen!“
„Zu ihren Diensten, mon Lieutenant!“ Matrose Mantler zog das Fernglas wieder an seine Augen und nahm den Spähdienst wieder auf, und auch der Leutnant kehrte zu seinem Posten zurück.
Die JEAN JUNEAU stieg hoch auf und wartete. Falls es zu einer schweren Niederlage kam, hatte sie die Aufgabe, sofort nach Tunis zurück zu kehren und auf das Genaueste Bericht zu erstatten.
„Es ist so ruhig hier“, bemerkte Fregattenkapitän Charles Lebeuf. Auch hier waren einige starke Ferngläser auf den Krater gerichtet, ebenso viele aber behielten auch die Umgebung im Auge. Auch den Himmel über dem Toussidè. Aber es bewegte sich außer den Legionären mit ihren Gleitflügeln und den Luftschiffen in dieser Gegend nur der Sand der Sahara, den der stetige Wind von Westen nach Osten trieb und zu immer neuen Dünen sammelte, um sie danach gleich wieder abzutragen.
Das erste Peloton aus der KARDINAL MAZARINE mit dem Captain an der Spitze ging in weiten Kreisen tiefer. Auch ihnen mussten die leeren Maxim-Stellungen auffallen. So manches dankbares Stoßgebet hob sich gegen Himmel, weil jetzt niemand mehr an den Waffen saß. Allerdings sahen sie bald, dass menschliche Körper teilweise seltsam verkrümmt in den Stellungen lagen, welche überhaupt nicht auf die französischen Luftlandetruppen reagierten. Die roten Flecken auf so manchem weißen Burnus waren allerdings recht deutliche Indizien, was den Grund der Reglosigkeit anging. Jaques Mantour erreichte den Boden als erster. Er lief aus und nützte den Schwung, um an den Rand des Kraters zu kommen, wo er die Haltegurte von seinem Koppel löste und sich damit von dem Gleiter befreite. Dann beobachtete er die Landemanöver des restlichen Pelotons. Sie waren gekonnt, wie nicht anders zu erwarten. Die begehrten silbernen Albatrosflügel auf der Brust erhielt eben nicht jeder, bei den Lehrgängen war immer ein hoher Schwund zu verzeichnen. Geübt verstauten die Legionäre ihre Gleiter an der Wand, um dem nächsten Zug Platz zu machen und versammelten sich mit schussbereiten Gewehren um Capitaine Mantour. Der wartete ab, bis das erste Peloton komplett war.
„Premier Peloton, premier Groupe, effronté“, befahl der Capitaine, Caporal Corlos Estrancia hob seine Faust.
„Gruppe, mir nach!“ Einer nach dem anderen marschierten die 12 Männer los. Jeder von ihnen hatte während des Vorstoßes einen speziellen Sektor zu überwachen und zu sichern. Diese Sektoren überschnitten sich, diese Art des Vorgehens hatte sich bereits bewährt und wurde bis zum Abwinken immer und immer wieder geübt. Teilweise unter sehr realistischen und für den Unachtsamen schmerzhaften Bedingungen. Jeder Soldat wusste gensu, wohin er seine Augen und den Lauf seines Gewehres zu richten hatte. Nach und nach drangen die Legionäre so in ihren weißen Felduniformen in die Festung ein.

„Teufel noch mal“, fluchte Capitaine Jaques Mantour nach geraumer Zeit, als sie einen großen Saal mit einer Fülle von Kartenmaterial gefunden hatten. „Da hat aber jemand ganz schön aufgeräumt! Hier waren grob geschätzt drei Regimenter stationiert, ausgestattet mit einigen Dampfelephanten und anderen Radpanzern aus allen Ländern, sogar drei von den riesigen italienischen Jupiter sehe ich. Was die hier wohl gewollt haben?“
„Es sieht nach einer Ausbildungseinrichtung aus, mon Caitaine. Söldner, so wie es nach den unterschiedlichsten Nationalitäten der Toten aussieht!“ Lieutenant Noël Gaspard kniete hin und drehte eine der Leichen im großen Besprechungssaal um. „Nobel, nobel! Wer es auch war, er hatte eine perfekte Ausrüstung für diese Art von Einsatz. Das war ganz sicher ein blitzartiger und lautloser Überfall. Gute Leute!“
„Die auf unserem Gebiet ohne Erlaubnis des Kaisers einen Einsatz durchgeführt haben“, schnappte Mantour. „Das ist auch ein Verbrechen! Ebenso, wie das Einnisten dieser Bande hier im Vulkan. Können wir feststellen, wer hier das Massaker durchgeführt hat?“
„Keine Spuren, welche auf irgendeine Nation als auf unsere Eigene hinweisen. Die Französinnen, die hier gefangen gehalten wurden, sagen übereinstimmend aus, dass die Männer akzentfreies Französisch gesprochen haben!“
„Seltsam. Was sind denn das für Papiere?“
„Eine Karte von Palästina und ein Festungsplan von Jerusalem, mon Capitaine!“
Der Fregattenkapitän lachte. „Also, um Jerusalem anzugreifen, braucht man mehr als nur Infanterie. Auch wenn es 8.000 Mann sind! Da benötigt man auch ein paar Luft- und Flugschiffe mit schwerer Artillerie!“
„Und wenn die noch irgendwo verborgen sind und auf einen speziellen Tag warten, mon Capitaine“, gab der Lieutenant zu bedenken.
„Wo soll das denn sein? Zeigen sie mir doch nur einen Anhaltspunkt, wo wir mit der Suche beginnen sollen, Lieutenant Gaspard!“
„Das kann ich nicht, mon Capitaine!“ Gaspard wischte sich das Schweißband seiner Mütze trocken. „Ebenso wenig, wie ich die Angreifer identifizieren kann. Diese Flechettes sind zivile Jagdmunition, die es überall zu kaufen gibt!“
„Eine konkurrierende Söldnerbande vielleicht? Aber warum denn bloß dieser Aufwand? Und wer ist so verdammt hart und schnell? Mit Ausnahme der Légion natürlich!“
=◇=
Paris
Mit klackenden Absätzen ging Roxane Solange de Beauvoise in ihrem Salon auf und ab.
„Verdammt. Wien bietet uns anstelle von Maria Sophia als Braut für François die jüngere Valerie Theresia an. Dazu einen sofortigen Nichtangriffspakt, was uns wirklich einige Gelder einsparen könnte. Und einen Fond, der aber nur für soziale Projekte verwendet werden kann. Das ist gut genug, um nicht als Beleidigung aufgefasst zu werden, aber auch nicht das, was ich mir erhofft habe!“
Der Vorsitzende der Volkskammer, der Marquis Leon de Lumrocheux, nippte an seinem Champagner. „Es macht doch nicht sehr viel Unterschied, mon Imperatrice. Valerie Theresia ist zumindest nicht derart – nun, sagen wir doch einmal – eigenwillig wie Maria Sophia. Für euren Sohn, Hoheit, wäre sie vielleicht sogar noch die bessere Frau!“
„Diese Frau will mit der Hochzeit auf alle Ansprüche auf den österreichischen Thron für sich und ihre Kinder verzichten. Wie sollen wir da zu meinen Lebzeiten jemals ein geeintes, ein übermächtiges Reich werden, das ganz Europa unter einer Fahne vereint? Der Flagge Frankreichs! Wie, mein lieber Marquis? Sagen sie mir das!“
„Mit Geduld, mon Imperatrice. Auch wenn sie verzichtet, solch ein Verzicht kann auch wieder Rückgängig gemacht werden. Eure Worte!“
„Unfug!“ Roxane Solange de Beauvoise schlug mit beiden Händen so stark auf die Schreibplatte ihres klassizistischen Sekretärs, sodass die Füllfedern durcheinander sprangen. „Valerie Theresia ist nicht Maria Sophia. Bei weitem nicht. Trotzdem können wir jetzt nicht so ganz einfach auf unserem Willen beharren, wir benötigen einen triftigen Grund. Denn dass François in unsterblicher Liebe zur Prinzessin entbrannt ist, glaubt uns leider kein Me… Was ist denn los?“ Ein Klopfen war an der Tür erklungen, so leise, als wollte der Anklopfende gar nicht gehört werden.
„Mon Imperatrice, eine Nachricht aus Tunis ist eingegangen. Es sind beinahe 600 Frauen verschiedenster Nationalität in der Stadt eingetroffen und haben ihre Gefangenschaft, Ausbeutung und Vergewaltigung durch eine Organisation namens Awlad Alrabi in französisch Tunesien zur Anzeige gebracht. Sie sind des Lobes und des Dankes gegenüber Frankreich voll, dessen Elitesoldaten sie befreit und in die Nähe von Tunis gebracht haben sollen!“
„WAS?“ Mir wirren Haaren sah Roxane Solange den Lakai an, als sähe sie einen geistig gestörten vor sich. „So ein Unfug!“
Der Diener legte ein Telegramm auf den Tisch. „Hoheit verzeihen, aber…“
„Sendet sofort nach Madame de Cartaille, ich möchte sie umgehend sprechen! Damit meine ich eigentlich sofort!“ Dann fuhr sie herum. „Wissen sie etwas von einem Militäreinsatz im…“ Sie sah auf die Depesche „…in Tunesien? Ein Vulkan, der Toussidé genannt wird?“
„Ich habe nicht einmal die Ahnung einer Idee“, wehrte der Marquis ab. „Ich habe von diesem Berg noch nie auch nur das Geringste gehört!“
„Dann möchte ich auch den Generalstab Frankreichs sprechen. So schnell die Herren kommen können, meinetwegen im Nachthemd! Vite, vite, Directeur, rufen sie die Marschälle zusammen. Jetzt! Gleich! Sofort! Irgend jemand muss doch etwas von diesem Überfall wissen! So eilen sie doch, Marquis. Und ich werde den König von seiner Gespielin Colette zumindest temporär trennen müssen. Anwesend muss er bei einer solchen Stabsbesprechung schon sein!“
=◇=
Es hatte durchaus seine Gründe, dass der Kaiser Frankreichs die Gesellschaft von Mademoiselle Colette Girardou mochte. Zum einen hatte sie eine zarte Figur, mit kleinen, aber feinen Brüstchen und einem ebenso kleinen, aber durchaus wohlgeformten Po. Zum anderen war Karl Joseph Napoleon Bonaparte, der Vierte seiner Familie auf Frankreichs Thron, verliebt in den Schmollmund mit den etwas vergrößerten mittleren Schneidezähnen und den allerliebsten kleinen Spalt zwischen diesen, und auch in die großen, schimmernden Augen seiner Gespielin. Alles Attribute, die den Kaiser auf Touren brachten und seine Hosen eng werden ließen. Doch am meisten liebte er an Colette, dass sie ihn bewunderte und seiner Männlichkeit, nicht seinem Amt schmeichelte. Sie wollte nicht über Frankreichs Größe und Zustand sprechen, sondern war ausschließlich an Größe und Zustand seines Bite interessiert. Sie redete nicht andauernd von Krieg und Intrigen, von dynastischen Heiraten anderer, sondern von den neuesten Werken eines Guy de Maupassant oder Emile Zola, vom neuesten Bild des Toulouse Lautrec, vom Turm des Ingenieurs Eiffel, der sich rasch seiner Fertigstellung näherte. Sie las mit ihm Voltaire und Hugo, aber auch einige romantische und deftige Colportageromane, welche sie von ihrer Mutter erhielt. Was dann nicht selten dazu führte, dass sie die Szenen nachspielten und zumeist änderten, denn wenn es geschah, hatte Charles nur noch Augen für Colette, die ihren weichen Schmollmund so wunderbar zu benutzen wusste.
Die Tür zum kaiserlichen Gemach flog auch und Roxane Solange stöckelte lautstark herein.
„Beeile dich doch ein wenig, Colette“, befahl sie der Gespielin des Kaisers, dann wandte sie sich an den wohlig stöhnenden Kaiser. „Und sie sollten auch zusehen, bald zu einem Ende zu kommen und sich danach waschen und dem Anlass entsprechend kleiden, Sire! Volle Uniform, wenn ich bitten darf! Die Arbeit ruft, ich warte im Konferenzraum auf eure Majestät, die achtzehn Maréchaux d‘Empire werden auch bald dort eintreffen! Und machen sie um Gottes Willen nicht so eine befriedigte Miene, wenn sie eintreffen, mon Empereur! Setzen sie gefälligst ein ernstes Gesicht auf, ehe sie in den Raum kommen, es ist leider etwas vorgefallen, das beileibe kein Spaß ist!“
Die achtzehn Maréchaux d’Empire waren von Napoleon I Bonaparte als Versorgungsposten für verdienstvolle, nicht dem Adel angehörende Generäle ins Leben gerufen worden. Doch der Dritte Napoleon hatte daraus einen echten militärischen Stab geschmiedet, ein Führungsgremium für die kaiserliche Armee. Üblicherweise hatten sie eine Menge zu sagen, und manchmal war sogar etwas halbwegs Kluges dabei. An diesem Tag im April 1889 jedoch waren die achtzehn Gesichter von absoluter Ratlosigkeit geprägt.
„Ich kann nur für mich sprechen, Sire, aber ich habe noch nie von solchen Uniformen und Rangabzeichen gehört!“ Maréchal Thierie Monchalet schüttelte den Kopf. „Wir haben keine Armeeeinheit, welche derart ausgerüstet oder eingekleidet ist!“
„Wer hat denn eine solche Einheit, meine Herren?“ Notgedrungen hatte Karl Joseph Napoleon IV Bonaparte den Bericht gelesen, und auch wenn er lieber nicht mit Problemen belästigt wurde, dumm war er keineswegs. „Ein Spezialkommando der Boches?“
„Davon habe ich – haben wir noch nichts gehört, Sire“, berichtete Maréchal Claude Davoreux, mit seinen 69 Jahren der älteste Stabsoffizier der Runde. „Es wäre auch ein sehr weiter Weg, von Deutschland bis in das südliche Libyen!“
„Die Boches haben aber sehr gute und schnelle Zeppeline zur Verfügung“, überlegte Maréchal Monchalet. „Und sehr große, die Damen haben von großen Luftschiffen berichtet!“
„Die Donaumonarchien verfügen aber auch über große Luftschiffe von hervorragender Qualität, für die Pazifikrouten. Und sie haben da eine Kompanie vom 111 Regiment, die als hervorragende Eliteeinheit ausgebildet und entsprechend ausgestattet sind“, warf der jüngste Maréchal der illustren Runde, Pierre Clamontreux ein.
Maréchal Davoreux wieherte laut los. „Zweihundertfünfzig Männer erobern eine streng bewachte Festung mit 8.000 Mann Garnison. Selbst mit einem nächtlicher Überfall wäre das nicht so leicht zu schaffen, und wenn es drei Kompanien wären!“
„Außerdem haben die Angreifer ganz offensichtlich die Offiziere nach einem Verhör kaltblütig erschossen, mit jeweils drei Flechettes direkt zwischen die Augen, aus nächster Nähe!“ Maréchal Charles Blanfontaine legte seine Fingerspitzen zu einem Dach zusammen. „Solche dicken Eier, einen Gefangenen Auge in Auge mit aufgesetzter Waffe zu liquidieren, haben die Österreicher ziemlich sicher nicht in der Hose! Vor allem ihre Offiziere nicht!“
„Die Erzherzogin Maria Sophia hätte sie schon, denke ich“, berichtigte Pierre Clamontreux.
„Zugegeben“, nickte Blanfontaine bedächtig. „Bei ihr könnte ich es mir unter Umständen vorstellen. Aber sie ist nun einmal in Gonder, und unser Prinz ist auch dort. Sie verhandeln dort einen dynastischen Vertrag, habe ich gehört. Und die Erzherzogin hätte eine Ehe mit ihrer Schwester Valerie Theresia angeboten, mit einer Menge Hilfe für technische und soziale Projekte!“
„Überlassen sie es bitte uns Frauen, über Heiraten und Verbindungen sprechen, Maréchal Blanfontaine“, meldete sich Roxane Solange erstmals in dieser Sitzung zu Wort. „Sie, meine Herren, sollten über die Verletzung unseres Hoheitsgebietes sprechen. Sie sind Maréchaux, keine Cupidos!“
„Nun ja, also, da muss ich zustimmen“, räusperte sich Davoreux. „In gewisser Weise muss ich allerdings Herrn Blanfontaine recht geben. Ich traue bei allen Fähigkeiten im Feld den Kakaniern einen solch eiskalten Pragmatismus nicht zu. Da würde ich eher britisch-indische Gurkha-Regimenter verdächtigen!“
„Warum sollten die einen Schichtvulkan in Tunesien überfallen?“ Richard Boeuff trommelte mit den Fingern auf den Tisch. „Warum sollte eigentlich irgend jemand diesen Vulkan überfallen?“
„Was mich zu einer weiteren Frage bringt!“ Michael Ponfireux hatte mit geschlossenen Augen der Diskussion gelauscht. „Wer sind eigentlich diese Awlad oder Asnan Alrabi, die sich in diesem Vulkan eingenistet hatten, und mit welchem Zweck haben sie es getan? Capitaine Mantour von der Légion Étrangére hat immerhin von 8.000 Männern berichtet, militärisch ausgerüstet und organisiert. Das ist eine Gefechtsstärke von drei bis vier Bataillonen Infanterie mit mobiler Artillerieunterstützung, vielleicht nicht überragend, aber im Einsatzfall durchaus ernst zu nehmen. Dazu der logistische Aufwand, diese Leute und die 700 Frauen zu ernähren, zu bewaffnen und genug Munition heranzuschaffen. Und selbstverständlich später dann diese Männer irgendwo hin zu bringen, wo sie ihre Aufgabe zu erfüllen haben. Worin immer die bestehen mag. Das ist eine enorme Leistung und kostet eine Menge Geld, Personal und Transportmittel. Diesen Nachschub effizient durchzuführen und auch noch geheim zu halten, nötigt mir eine gewisse Hochachtung ab. Trotzdem würde mich interessieren, wer sich dort unter quasi unseren Augen breit gemacht, und Französinnen entführt, versklavt und vergewaltigt hat!“
„Sie haben nicht nur französische Mädchen in ihre Gewalt gebracht“, warf Clamontreux ein, Ponfireux zuckte mit den Schultern.
„Die anderen Frauen gehen mich aber nichts an, Kamerad, ich bin ein französischer Maréchal. Vielleicht haben die Briten Wind bekommen, dass einige von ihnen dort sind und haben ein Befreiungskommando los geschickt. Oder die Portugiesen? Oder wer weiß denn ich? Nach den Schilderungen in diesem Bericht“, Ponfireux wedelte mit den Blättern in seiner Hand. „Also, nach diesen Angaben hält sich mein Mitleid mit diesen Lumpen in Grenzen! Engen Grenzen, sehr engen sogar, ich gebe es zu.“
„Trotzdem, mein werter Ponfireux, ist hier eine nicht abgesprochene militärische Operation auf französischem Gebiet geschehen“ wies Monchalet noch einmal auf einen zentralen Punkt hin. „Das ist eine Beleidigung und eine Provokation! Wir sollten zumindest eine Entschuldigung verlangen!“
„Einverstanden. Aber von wem“, wollte der Kaiser wissen. „Vielleicht von allen? Man dürfte in den meisten Ländern Europas mehr oder weniger laut über uns lachen.“
Clamontreux hob verzweifelt die Hände. „Wie sollen wir uns denn jetzt bloß verhalten?“
Der alte Davoreux hob einen Zeigefinger an seine prominente Nase. „Wir sollten uns verhalten, als wäre es wirklich unsere Armee gewesen, wir könnten sogar eine solche Einheit aufstellen. Wie man gesehen hat, ist solch eine Eingreiftruppe recht brauchbar, und wir könnten ein Bataillon der Légion Etragère entsprechend ausrüsten und nachschulen. Dabei lassen wir ein wenig durch die üblichen Kanäle sickern und warten auf Reaktionen!“
„Gut. Machen wir es vorderhand so. Und der Service Secret de Sécurité sollte sich auf die Suche nach diesem Phantomkommando machen“, verlangte Charles Joseph. „Die Aufstellung einer solchen Einheit kann man doch nicht geheim halten. Es müssen Gehälter bezahlt werden, Kasernenplätze, Hangars für die Luftschiffe, da kommt doch etwas zusammen! Ich möchte niemandem in sein Handwerk pfuschen, aber ich bitte sie, den Zaren nicht ganz zu vergessen, meine Herren. Wladimir Alexandrowitsch ist ein wenig anders als sein Vater, wenn russische Mädchen unter den Entführten waren – ihm traue ich eine solche Aktion durchaus zu. Über Elisabeth Anna, die Gattin von Großfürst Pavel Alexandrowitsch, könnten sie auch Zugriff auf modernste Technik haben, und Russland ist so groß, dass man leicht eine Menge verstecken kann. Meine Herren, wir vertagen uns um zwei Wochen. Ich wünsche Antworten!“ Der Kaiser erhob sich, und mit ihm seine Marschälle. Dann schritt Charles Joseph aus dem Raum, während seine Marschälle sich tief verneigten. Laut hörte man den Kaiser nach seinem Adjutanten rufen, und der Comte d’Tourenne eilte hinter ihm her.
„Bringen sie mir einige Berichte, Jean! Und zwar…“, hörte man den Kaiser noch befehlen, ehe die Tür ins Schloss fiel! Roxane Solange de Beauvoise sah ihm erstaunt nach. Wollte sich ihr Gemahl denn jetzt ernsthaft um seine Geschäfte kümmern, statt zu Colette zurück zu kehren. Hoffentlich hielt dieser Eifer nicht zu lange an.
=◇=
Das Palais de Tuileries war von Katharina de Medici im 16. Jahrhundert als ein außen großzügiges und prunkvolles, innen jedoch mit kleinen Räumen ausgestattetes Bauwerk geplant gewesen. Mit Ausnahme der Grand Galerie und des großzügigen Ballsaales. Nach dem Brand während der Erstürmung am 1. August 1792 im Laufe der französischen Revolution und der Krönung von Napoleon I Bonaparte wurde die Anzahl der Räumlichkeiten zugunsten ihrer Größe halbiert, die Gänge und Treppen des Wohntraktes verbreitert wie auch die Fenster vergrößert. Der ganze Palast zeigte sich nun als lichtdurchflutetes Kunstwerk, in welchem Statuen und Gemälde hervorragend in das gesamte Ensemble integriert waren. Pierre-François-Léonard Fontaine und Charles Percier hatten in der zweiten Etage eine den griechischen Kolonnaden nachempfundene fünf Meter hohe Galerie neu eingebaut, mit Fenstern zwischen den Säulen vom Boden bis zur Decke reichend. An dieser ‚Galerie Napoleon‘ lagen die privaten Gemächer des Kaisers wie auch jene der Kaiserin, beide mit einem herrlichen Ausblick über den Jardin de Tuileries, während die Galerie die Sicht auf den Blick auf Louvre erlaubte. Die Dame, welche eben hinter einem Diener in Livree elegant durch die Galerie Napoleon schritt, trug ein Kleid mit langem, fließendem Rock zu einem eng geschnittenen Jäckchen, das ihre modern schmale Taille betonte, beides in der Farbe von Champagner, die bordeauxfarbene Bluse mit dem voluminösen Spitzenjabot setzte einen für Frankreich sehr gewagten Farbakzent. Das dunkle Haar war unter dem rechts mit einer riesigen Schleife verzierten und links mit hochgeschlagener Krempe getragenen Hut zu einem Knoten am Haupt hochgesteckt und fiel von dort noch hüftlang über den Rücken. Madame Madelaine de Cartaille war durchaus eine Schönheit, und sie wusste diese auch durchaus einzusetzen. Kaum ein Mann widerstand ihrer erotischen Ausstrahlung, und auch viele Frauen waren ihr bereits erlegen. Sie war eine Künstlerin, welche mit menschlichen Emotionen ebenso virtuos zu spielen vermochte wie 100 Jahre zuvor ein gewisser Johannes Chrisostomus Wolfgang Gottlieb Mozart auf dem Klavier.
Vor dem Salon der Kaiserin blieb der Lakai stehen und machte Front vor einem anderen in ähnlicher Livree, nur dass dieser zweite eine goldene Kette an der roten Weste trug.
„Madame Madelaine de Cartaille ist eingetroffen und bittet ihre Majestät Roxane Solange de Beauvoise, die Kaiserin der Franzosen sprechen zu dürfen!“ Der zweite Diener klopfte an die Tür, wartete, öffnete diese einen Spalt und schlüpfte in den Raum. Dann stieß er den Flügel weit auf und intonierte mit näselnder Stimme.
„Die Kaiserin der Franzosen, ihre Majestät Roxane Solange de Beauvoise, erweist Madame Madelaine de Cartaille die Ehre einer Audienz. Erweiset Respekt der Kaiserin und nahet euch demütig, wie es sich geziemt!“
Lächelnd trat Madelaine durch die Tür und machte noch an der Schwelle einen tiefen Hofknicks. „Majestät wollten ihre Dienerin sprechen?“
„Das will ich! Kommt herein, Madelaine. Diener, die Türe zu, und außer für den Kaiser bin ich für niemanden zu sprechen. Keine Störungen, ist das klar?“ Madame de Cartaille trat weiter in das Zimmer, und hinter ihr fiel die Tür ins Schloss.
„Willkommen, meine Freundin!“ Roxane umarmte Madelaine und küsste sie auf die Wangen. „Ich brauche deinen Rat.“
„Nur zu, meine teure Freundin!“ Madelaine nahm zwei Nadeln aus dem Hut und legte diesen auf einen Tisch, knöpfte das Jäckchen auf.
„Die Österreicher haben statt Maria Sophia ihre Prinzessin Valerie Theresia angeboten, dazu noch eine Menge Geld für Modernisierungen und soziale Projekte“, platzte Roxane Solange heraus.
„Das klingt doch gar nicht schlecht!“ Madelaine zupfte die dünnen Handschuhe von den Fingern.
„Aber Valerie Theresia verzichtet für sich und ihre Kinder auf alle ihre Thronansprüche, sobald sie heiratet!“ Roxane goss zwei Gläser Champagner ein.
„Du musst verhandeln und den Österreichern erklären, dass nach dem Codex Napoleon sie zwar für sich, aber nicht für andere auf den Thron verzichten kann. Für ihre Kinder kann sie also nicht entscheiden!“
„Aber bis ein Kind entstanden und erwachsen genug für einen Thronanspruch ist, vergehen noch Jahre“, jammerte Roxane.
„Oh nein“, beruhigte Madelaine und nippte an ihrem Champagner. „Denn wenn die Habsburger akzeptieren, dass sie nur für ihre Person verzichten darf, dann kann sie doch auch nicht für ihren Ehemann verzichten. Und ob die Kakanier lieber einen Russen als Kaiser hätten als einen Franzosen?“
„Dann gibt es immer noch die Maria Sophia. Die könnte einen Anspruch geltend machen!“
„Die Dame ist in einem gefährlichen Gebiet unterwegs. Wer weiß, was da alles geschehen kann. Beruhige dich, Roxane. Es wird alles geschehen, wie es geschehen muss. Tritt mit den Habsburgern in Verhandlung, das Schicksal Frankreichs wird sich erfüllen, wenn es soweit ist.“
„Also gut! Ich werde deinem Rat wie meistens folgen!“ Roxane Solange beruhigte sich ein wenig. „Übrigens haben sich in Tunis eine Menge junger Damen eingefunden, welche teilweise Deine Schäfchen waren. 300 Frauen aus Europa, die alle im Namen des Goldenen Frühlings nach Palästina wollten und nach dem Vulkan Toussidé verschleppt wurden, etwa fünfzig davon aus Frankreich! Dazu noch vielleicht 400 farbige Frauen aus französischen und anderen Africakolonien.“
„Das ist ja fürchterlich!“ Madelaine de Cartaille schlug die Hand vor den Mund. „Wirklich abscheulich. Wie konnte denn das geschehen?“
„Die europäischen Frauen wurden zumeist in Kairo auf ein Schiff gelockt, oder in la Goulette bei Tunis. Irgend jemand hat sie jetzt in einer Nacht- und Nebelaktion befreit.“
„So!“ Madelaine schüttelte den Kopf. „Die armen Frauen! Wir müssen ihnen helfen, wieder den Weg zurück in ihr Leben zu finden. Wer waren denn die mutigen Männer? Wir müssen uns doch bei ihnen bedanken!“
„Das eben wissen wir noch nicht, aber wir arbeiten daran, meine liebe Freundin!“ Roxane hob ihr Glas. „Auch wenn diese Aktion unzweifelhaft einem guten Zweck diente, so ist sie doch eine Provokation Frankreichs!“
Auch Madelaine nippte wieder an ihrem Glas. „Hat man sonst noch etwas gefunden?“
„Eine Menge Kartenmaterial“, erzählte die Kaiserin. „Jerusalem, la Goulette, einige Mittelmeerinseln und sogar von Südafrica und einigen Inseln im Atlantik. Als hätte jemand vor, dort anzugreifen.“
„So?“ Madame de Cartaille blieb trotz allem die Ruhe in Person.
„Aber ja. Auch wenn ich nicht wüsste, warum jemand die Insel Ilhéu Caroço im Golf von Guinea angreifen sollte. Für Malta gäbe es natürlich einige Gründe vor allem strategischer Natur für alle europäischen Mächte. Darum sind die Briten ja auch so versessen darauf, die Insel zu behalten. Aber verdammt noch einmal, was will man mit einer winzigen Oase in der Sahara. Oder was für einen Nutzen soll denn Jerusalem haben? Ich verstehe es nicht!“

„Ich auch nicht“, bekannte Madeleine. „Du weißt doch, Roxane, mein Metier ist nicht der Krieg, sondern die Liebe!“
„Natürlich, meine Liebe“, atmete Roxane tief durch. „Entschuldige, dass ich dich damit belästigt habe.“
„Aber das hast du doch nicht!“ Madelaine öffnete ihre Arme. „Wofür hat man denn sonst Freunde?“
=◇=
Berlin
Auf der Friedrichstraße, vor dem Haus des Goldenen Frühlings, hatte Kurt Pietsch seinen Hocker und davor einen Kasten mit Schuhputzzeug aufgestellt.
„Eenmal wienern und polieren, det Herr?“ „Froillein, een wenich Jlantz uff die ollen Galoschen?“ Das Mundwerk des Schuhputzers ging wie geschmiert. „Aber jädichste Frau, for nur 10 Pfeeniche kieckt ihr Schuhwerch wieder so dolle aus wie sie selber.“ „Ach Jott, for ihr müsst ick ja glatt umsonst arbeiten, gnädiches Froilein, nur dat ick ihre Beene bewundern kann.“ Ein typischer Berliner, dessen Großvater aus dem Spreewald, dem Sorbenland, eingewandert war. Ein nicht sehr großes, dürres Männchen, mit funkelnden Augen, stets einem forschen Spruch auf der Lippe. Den dünnen Schnurrbart unter der langen Nase hatte er unternehmungslustig aufgezwirbelt, die Schiebermütze war keck auf den etwas verwuschelten Scheitel gesetzt. „Juten Tach, det Herr von Schutzmann, wollen sie ma‘n jlänzend jewichstes Schuhzeuch? Dit Hooptmann von ihne wird’s froin!“
„Imma Ruhe mit die Jäule, Jungchen.“ Atze Friedmann war auf seiner Runde stehen geblieben. „Jib mich mal dit Papiere!“
„Aba klar doch, Herr Wachtmeester, it allet in Ordnung!“ Kurt holte sein kleines Heft mit der Lizenz heraus, in dem die Verwaltungsbeamten für den jeweiligen Bezirk einen eigenen Stempel hinein drücken mussten. Der galt dann ein Monat für den bewilligten Standort. „Ick hab‘ alle Stempel vom Machistraat in meener Erlaubnis! Hier, bitte schen!“ Atze blätterte in der Lizenz, während Manni Jankowsy scheinbar gelangweilt die Friedrichstraße hinauf und hinab blickte.
„Kurt Pietsch?“
„Klar, Herr Oberwachtmeester“, bestätigte Kurt. „Ick hab nen echten Auswees, nen Passpoort, wollen se mal kiecken?“
„Schutzmann oder Wachtmeester is jenuch!“ Ohne von der Lizenz aufzusehen, wedelte Atze mit den Fingern.
„Hier bitte, Herr Wachtmeester!“
„Jut, jut. Der Herr Vater war aus dem Spreewald? Hübsche Jechend dort. Eene Tante for mir hat noch’n Hüttchen da, direkt am Kanal! Pflanzt immer noch Jurken. Na schön, Kurt Pietsch aus’m Sorbenland, allet hat sene Ordnung! Mach et jut, und bleb brav!“
=◇=
Das neue Büro von Kriminalrat Kaltenegger war zwar um einiges größer als das alte gewesen war, aber um nichts gemütlicher ausgestattet. Sein massiver Schreibtisch stand hinter einem kleinen Paravent aus Holzlamellen. Darauf stand eine Göbel – Lampe mit einem geschwungenen Fuß auf einer schweren Standfläche aus geschwärztem Gusseisen und einem außen grün und innen silbrig-weiß gefärbten, wie ein hohler Halbzylinder geformtem Schirm aus Weißblech. In einer Schale lagen akkurat ausgerichtet die drei Füllfedern, welche das Amt stellte, einige Graphitstifte warteten in einem Becher auf ihren Einsatz, der stählerne Kurbelanspitzer war fest auf dem Tisch verschraubt. Auf der anderen Seite des Paravents war das Refugium der ihm derzeit unterstellten Leute. Ein großer Tisch mit einigen Stühlen für Besprechungen und Papierkram, ein langer, schmaler Tisch, um Beweismaterial ordnen und zur Betrachtung auflegen zu können, ein aufgezogener Stadtplan und eine große Schultafel, so groß wie die gesamte Längswand. Derzeit waren darauf wenige Namen und Linien, aber auch noch sehr viel mehr Fragezeichen zu sehen.
„Det Kurt Pietsch is uf Stellung jegangen, Herr Rat!“ Atze Friedmann stellte die Pickelhaube an ihren Platz und hing seinen Mantel auf. „Wo haben se denn die Quasselstrippe uffjetrieben. Det Männecken kennt ja jar keene Pause, det redet dir in Grund und Boden!“
„Det Kurt is, du gloobst es nicht, von dit Universität“, erzählte Kaltenegger. „Hat Jus studiert und nen Magister! Aber dann wollt‘ er unt’n anfangen und als Schupo arbeeten, damit er eene Ahnung vom Leben uff dit Straße kriecht. Aber er ist in Ordnung, gloob’s ma!“
„Dann wird er wohl ma der Scheff in dem Revier da, und wa werd’n vor ihm di Haken knallen dürfen!“ Manfred schüttelte den Kopf. „Aber wat soll et. Die Welt jehört den Reichen, die stolpern nur in eene Richtung! Nach oben!“
„Nu mach mal halblang, Manni“, protestierte Atze. „Da ham se doch vor nüscht allzulanger Zeit dit Jrafen uffjehangen. Soll seine Köchin abjemurckst haben! Also dit Männecken ist nach unten jefallen, janz deutlich!“
„Jut, hat et mal en erwischt“, gab Manni knurrend zu. „Aber sonst?“
„Sonst hat der Kolleche allemal recht, Atze. Die Welt it wat führ Reiche und Mächtige. Da kannste nüscht mache, is so!“ Der Kriminalrat Kaltenegger nickte. „Und, schon wat jesehen?“
„Een paar Meechen, von den der Kurt gloobt, dat et Penunzenritzen von janz unten sind, aber janz fein rausjeputzt“, meldete Atze. „Und dann is eener rinjegangen, den kennt det Kurt vom sehen aus Potsdam, von dit Füsilier-Rejiment. Da soll det Jung mit nem Kadetten wat jehabt ham!“
„Wat denn, jehen jetzt och Meechen zu die Soldaten“, brummte Manni. „Wat? Wat kieckt denn ihr so?“
„Manni!“ Atze drückte den Freund auf einen Stuhl. „Haste schon mal wat davon jehört, dat et Männer jibt, dit sich lieber zu eenem Mann lechen als zu eener Frau?“
„Wat denn, die verzichten uf die Titten un dit andre?“ Manni schüttelte den Kopf. „Nu, also, meen Plaisier wär det nich! Überhaupt nich!“
„Jut, Junge, aber die denken halt nich wie wir. Die haben et jerne anders“, hob Atze die Hände.
„Wenn sie glücklich dabei sin, ick hab‘ nüscht dajegen. Nur mir sollen sie damit nich kommen“, schloss Manni das Thema ab. „Ick bleib‘ lieber bei mein Grete und ihre dollen Dinger!“ Manni deutete mit den Händen einen üppigen Busen vor seinem Hemd an. Ein hartes Klopfen an der Tür unterbrach das aufkommende Gelächter der Beamten.
„Ja, Bärner“, rief der Kriminalrat, denn der harte Klang verriet die metallene rechte Handprothese des Innendienstmitarbeiters. Die echte hatte er im Einsatz verloren. Mittlerweile schrieb der Mann mit der linken Hand ebenso gut wie früher mit der rechten, die dampfbetriebene Prothese eignete sich eher für grobmotorische Handlungen. Was einige aufmüpfige Arrestanten bereits schmerzhaft erfahren mussten.
Julius Bärner öffnete die Tür zum Bureau und steckte den Kopf durch den Spalt. „Herr Rat, zwei Herren sind hier und möchten sie sprechen.“
„Dann sollen se doch ma rinkommen, Julius. Sei so jut ind sach ihnen, ick lasse bitten.“ Einer der Eintretenden war etwa einen Meter achtzig groß, schlank, durchtrainiert, das blonde Haar zu einem akkuraten Scheitel auf der linken Seite des Hauptes gekämmt, er war glatt rasiert. Doch das Auge wurde unweigerlich von der anderen Person angezogen. Rund einen Kopf kleiner als sein Begleiter, das schwarze Haar sehr kurz an den Schläfen rasiert, der Mittelscheitel wirkte wie mit dem Lineal gezogen und auf ewige Zeiten fixiert. Die stahlblauen Augen hinter dicken Augengläsern blickten stechend scharf in die Umgebung und schienen dem Gegenüber mittzuteilen: ‚Versuch es nicht einmal, ich weiß genau, wann du mir ein Märchen auftischen willst‘. Der dünne Oberlippenbart milderte den harten Mund kein bisschen, das breite Kinn strahlte pure Verbissenheit aus. Ein Foxterrier, der einmal in eine Sache verbissen, keine Ruhe mehr kannte.
„Herr Kriminalrat“, schnarrte er und streckte Kaltenegger die Rechte entgegen. „Mein Name ist Friedrich Liebherr. Hauptmann Friedrich Liebherr, und dies ist Oberleutnant Binder. Jakob Binder.“
„Freut mir, Herr Hooptmann, Herr Oberleutnant.“ Kaltenegger schüttelte die Hände und stellte seine Beamten vor. „Wat kann ick for sie, oder besser für die Armee tun?“
„Für das erste, absolutes Stillschweigen über die Sache, welche ich ihnen sofort präsentieren werde. Sie, Herr Oberkriminalrat haben gedient, ihre Akte ist mir bekannt. Und die beiden Herren sind zumindest für meine Behörde auch keine unbeschriebenen Blätter mehr, ebenso die Schutzleute Friedrich Brauwitz und Karl Fischer, die derzeit mit ihnen eine gute Mannschaft zu bilden scheinen!“ Die Gesichter der Polizeibeamten wurden ausdruckslos.
„So, ihre Behörde! Wat is denn dat for eene“, fragte Kaltenegger. „Preußische Jeheimpolizei?“
Liebherr zuckte kurz mit den Wimpern. „Diese Amateure werden wir in Zukunft für Routineaufgaben einsetzen, Oberkriminalrat Kaltenegger. Unser Dienst, die Abteilung III/b des Auswärtigen Amtes, wurde erst vor etwa einer Woche nach dem Vorbild des österreichischen Evidenzbureaus offiziell gegründet und löst die einzelnen Geheimdienste der deutschen Länder ab. Ab sofort gibt es nur noch einen gesamtdeutschen Geheimdienst. Uns. Aber das ist noch nicht das Geheimnis, spätestens nächste Woche können sie das in sämtlichen Journalen des Reiches und in den unvermeidlichen Aktennotizen nachlesen. Ich bin hier auf Wunsch des kaiserlichen Kanzlers Bismarck, um sie mit einer delikaten Angelegenheit bekannt zu machen.“ Liebherr verstummte kurz und griff zu seiner Mappe.
„Momang, Herr Hooptmann. Ick bin schon lange aus’m Dienst, und damals war ick jerade…“
„Es ist heute vier Jahre, fünf Monate und elf Tage her, abgerüstet haben sie als Leutnant der Garde-Grenadiere. Sie sind geboren am 25. Juni 1862, was sie mit dem heutigen Tage 26 Jahre, 10 Monate und 20 Tage alt macht. Stellen sie ihr Licht bitte nicht unter den Scheffel, Herr Oberkriminalrat. Fürst von Bismarck schenkt ihnen sein Vertrauen, und das reicht mir. Für’s erste. Später wird die Abteilung sicher bessere Wege finden müssen, aber das ist Träumereien wie die Geschichten dieses Franzosen Jules Verne. Reisen zum Mond und zu diversen Planeten, ich bitte sie. Aber egal. Hiermit möchte ich ihnen die Akte Leutnant Alfred Maranski überreichen.“ Er legte eine sauber abgeheftete Dienstakte auf den Tisch. „Und dieses hier sind alle Schriftstücke, die wir in seinem Besitz gefunden haben. Seine restlichen Effekten finden sie in der Aservatenkammer der Abteilung III/b im Heeresbeschaffungsamt, sie haben bis auf Widerruf freien Zutritt. Oberleutnant Binder wird ihrer Abteilung für diesen Fall zugewiesen. Sie, Herr Oberkriminalrat, behalten selbstverständlich die Leitung der Ermittlungen, der Oberleutnant ist ihrem Kommando unterstellt.“
„Das ist aber ungewöhnlich, Herr Hauptmann!“ Kaltenbrunner lehnte sich zurück und verschränkte die Hände auf seinem Bauch. „Sehr ungewöhnlich. Darf ich fragen…“
„Alles, Herr Oberkriminalrat, alles. Ihre Beförderung – direkt vom Kanzler. Sie haben ihm imponiert, als sie ihm die Stirn geboten haben. Und dass sie das Undenkbare trotz allem doch gedacht haben, das hat ihm auch gefallen. Ursprünglich war geplant, die Untersuchungen über den Verbleib der Geheimdienstwaffe intern durchzuführen, um die Identität unserer – Vertreter zu schützen.“ Friedherr zuckte mit den Schultern. „Wie gesagt, da hatten wir ihre Dienstakte noch nicht durchgearbeitet.“
Kaltenegger erhob sich, um ein wenig auf und ab zu gehen. „Möchten sie Kaffee, Tee, Herr Hauptmann, Herr Oberleutnant? Ich fürchte, es wird eine längere Angelegenheit.“
„Gerne, Herr Oberkriminalrat. Kaffee wäre gut.“ „Atze, sagst du bitte dem Bärner Bescheid? Danke. Also, Herr Hauptmann, wer führt diese neue Abteilung III/b denn eigentlich“, stellte der Oberkriminalrat endlich die Frage, welche ihm seit einiger Zeit immer wieder durch den Kopf schoss, die er aber bisher als unwesentlich abgetan hatte.
„Derzeit wird die Abteilung von Herrn Major Arthur Waenker von Dankenschweil aufgebaut und geleitet.“
„Arthur Waenker von Dankenschweil“, rief, nein brüllte der Polizist. „Ach du heilige Scheiße! Und der will mich einweihen? Das ist – das ist jetzt aber wirklich das Seltsamste an der ganzen Sache!“
„Herr Major haben eine ähnliche Reaktion vorausgesagt, Herr Oberkriminalrat. Und ich soll ihnen dazu folgendes sagen. ‚Menschlich gesehen haben sie richtige Wahl getroffen, aber der Dienst zwingt uns manchmal eben, ein Arschloch zu sein‘. Er sagte, sie verstünden schon.“
Kaltenegger ließ sich in seinen Sessel fallen. „Das tue ich tatsächlich, Herr Hauptmann. Aber es macht die Sache nicht wirklich besser. Na gut, persönliche Ressentiments beiseite, worum geht es. Oder soll ich zuerst die Akte lesen?“
Jetzt erhob sich der Hauptmann und trat an den große Stadtplan. „Ganz kurz zur Einführung. Vor wenigen Tagen wurde hier aus diesem Weiler etwas außerhalb der Stadtgrenze Berlins eine unbekannte, unbekleidete männliche Leiche gezogen. Angeblich soll es sich bei diesem Gewässer um ein hervorragendes Fischrevier handeln.“
„Dit is korrekt, melde ick jehorsamst!“ Atze hatte genau hingesehen, wie es seine Art war. „Für dit Wasser kriechste nich so leicht ne Angelkarte, da musste früh ansteh’n. Aber wennste ne hast, dann kriechste für zwee Tache alle Mäuler von die Familje mit die Fische gestopft. Entschuldigung, Herr Hooptmann, wollte nich unterbrechen!“
„Nein, nein, das war gut“, beschwichtigte der Hauptmann. „Jetzt weiß ich, dass sie die Gegend kennen, und sie werden sich vorstellen können, wie der Tote nach einigen Wochen im Wasser aussah. Also, diese Leiche wurde zu Professor Virchow verbracht, der sie selbstverständlich einer Obduktion unterzog. Dabei fand eine seiner Studentinnen – eine seltsame Vorstellung, Frauen als Arzt, aber nun gut, die Zeiten ändern sich nun einmal. Die junge Dame hat jedenfalls hervorragende Augen, der Mann wurde mit einer langen, aber dünnen Art Stecknadel hier hinten im Genick getötet, die Tatwaffe verblieb in der Leiche. Nach Angaben von Professor Virchow dürfte der Mann nicht sehr viel davon gespürt und die Wunde kaum geblutet haben.“
„Dat it ja janz interessant, Herr Hooptmann!“ Manni strich sich über den Schnurrbart. „Aber da sin dit Kollechen von det örtlichen Polizee zuständich, nich wir. Und warum interessiert sich dit Jeheimdienst dafor.“
„Weil die Leiche ein Spion war, Manni. Entweder ein unsriger oder ein fremder“ überlegte Kaltenegger. „Einer von uns, und seine Flechettepistole ist verschwunden“, rief er dann, mit der Hand auf den Tisch schlagend. „Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage, woran hat ihn Professor Virchow erkannt?“
„Ich bitte Herrn Oberkriminalrat, dieses Geheimnis zu respektieren! Ansonst haben sie völlig richtig deduziert! Nur eine Kleinigkeit fehlt noch. Der Leutnant sollte eigentlich in Paris sein!“
„Da ist er aber ganz schön weit von seinem Einsatzgebiet entfernt. Na gut. Dann lassen sie den Oberleutnant und die Papiere einmal hier, Herr Hauptmann.“ Müßig blätterte Kaltenegger in den Blättern. „Die werden wir uns einmal durcharbeiten. Der Oberleutnant weiß, wie er sie erreicht?“
„Aber selbstverständlich, Herr Oberkriminalrat!“ Liebherr erhob sich und reichte Franz Kaltenegger die Hand über den Tisch. „Ich empfehle mich!“ Kaltenegger wog die Akte einige Minuten in der Hand, den Blick in unbekannte Fernen gerichtet. Dann fokussierte sich sein Blick wieder auf das hier und jetzt. „Also, Oberleutnant Binder, wie gut wissen sie Bescheid?“
=◇=
„Fritze, Kalle, hier herüber“, winkte Atze den beiden Kollegen zu, als die von ihrer Runde kamen. „Ick will euch nur vorwarnen! Unser Scheff, dit war’n Leutnant in die Armee, und plötzlich redet der janz komisch nach dit Schreibe. Hochjestochenet Hochdeutsch eben. Du gloobst et nich, wie unser Kriminalrat jetzt plötzlich redet! Ach so, Oberkriminalrat is er jeworden, der olle Bismarck selber hat die Beförderung unterschrieben! Und wer haben jetzt so een Bürschchen in der Stube, een Oberleutnant vom jeheemen Dienst, also vom neuen, een kaiserlicher Auslandsjeheemdienst. Det Jungchen soll uns unterstützen, aba so sauber jeschrubbt, wie det Männecken auskieckt, ick wees nich, ob der übahaupt schon ma ne Olle nackicht jesehen hat. Im Bureau mach er ja ne große Numma seen, aba uff der Straße, ick weeß nich, ick weeß nich!“
„Also, Herr Friedmann, det Männecken sieht so sauber geschrubbt aus, weil er unter der Dusche war. Zweitens bin ich sowohl an den Akten als auch auf der Straße eine ganz große Nummer, und wir können ja einmal den Sportsaal aufsuchen. Sie bringen mir bei, wie man auf der Straße kämpft, und zeige ihnen ein paar Tricks, die wir von der Abteilung III/b so auf Lager haben. Und im übrigen hab‘ ick ooch schon mehr als een ollet Meechen nackicht jesehen, und jefummelt hat det Männecken ooch schon. Sojar dit eene oder ooch andere Nümmerchen hat er schon jeschoben. Alles in Ordnung, Kollege Friedmann? Sie sehen so blass aus!“
„Wo sin sie denn herjekommen, ick hab‘ ihnen jar nich kommen jesehen, Herr Oberleutnant!“ Atze hatte sich erschrocken an Wand gelehnt, als wie aus dem Nichts der Oberleutnant Binder neben ihm aufgetaucht war.
„Wir von der Abteilung III/b haben gelernt, nicht aufzufallen, Kollege Friedmann“, lachte der große Blondschopf. „Und ab und zu ein wenig ihren Körper schrubben könnte ihnen bei der Eroberung ihrer Martha auch ganz hilfreich sein.“
„Nich jeder kann sich ne Bude mit Batt leesten, euer Hochwohljeboren! Die meesten von uns sind doch schon froh, wenn se jenuch Holz oder Kohle haben, damit et warm ist und sie sich nich janz kalt waschen müssen. Und jetzt können se mir meinetwechen verhaften, aba Balin könnte sich von Wien ne janz dicke Scheibe abschneiden. So wie dort jeht sozialer Wohnbau.“
„Jetzt muss ich zustimmen, Kollege. Nein, ich werde sie nicht verhaften, nicht für die Wahrheit, und wir hinken auf diesem Gebiet tatsächlich hinterher. Die wenigen Sozialbauten, die hier in Berlin jetzt entstehen, fangen noch nicht einmal den Zuzug ab, geschweige denn, dass sie Abhilfe bei den bereits Ansässigen schaffen könnten. Aber freuen sie sich, zumindest ihr neu gebautes Kommissariat wird über eine warme Dusche verfügen!“
„Det wird den einfachen Malochern leider nich vielle bringen, Herr Oberleutnant“, moserte Atze noch ein wenig. „Die sin ja nich wie wir im Staatsdienst. Aba für uns wird’s jut!“
„Ja, wollen sie denn vielleicht wie Wien einen roten, einen marxistischen Bürgermeister“, ereiferte sich Binder. „Dieser Victor Adler hätte Armenarzt bleiben sollen, statt eine marxistische Arbeiterpartei zu gründen! Die werden dem Kaiser und der Regentin noch viel Geld kosten! Die Wirtschaft wird bei uns schon alles wieder ins Lot bringen, vertrauen sie nur darauf!“
„Wenn er dem Kaiser treu ist und jute Arbeit macht, ja warum denn nich een roter Bürchermeester?“
„Würden die Herren ihr Kaffeekränzchen bitte ins Bureau verschieben?“ Kaltenegger stand in der offenen Tür ihres Domizis. „Hinsetzen, Leute. Jeder nimmt sich jetzt einen Haufen Papiere und schreibt sich auf, was er für seltsam hält. Dann wandert der Stapel im Uhrzeigersinn zum nächsten. Los geht’s!“
Die nächsten Stunden arbeiteten die Beamten schweigend und sehr konzentriert. Die Stille wurde nur durch das Rascheln des Papieres und das Kritzeln der Bleistifte unterbrochen, bis das harte Pochen von Bärners Prothese an der Tür erklang.
„Entschuldichen se, Herr Oberkriminalrat. Draußen is een janz een feines Froilein für Herrn Oberkriminalrat. So een fesches, elegantes Froilein kommt sonst nich zu uns of dit Wache, Herr Oberkriminalrat. Ein Froilein Annabelle Reicherth!“
„Was?“ Kaltenegger sprang auf, blutrot über beide Ohren. „Ich komme schon!“ Hastig rannte er aus dem großen Bureau.
„Wat hat er denn“, wunderte sich Manni.
„Reicherth, Reicherth, dit war dit Meechen aus dit Uni, die mit dem Waffenfabrikanten als Vater. Die wird sich doch wohl nich in den Chef verkieckt haben?“ Fritze Brauwitz wackelte obszön mit den Augenbrauen.
„Sie in ihn, das weiß ich nicht!“ Jakob Binder blätterte um. „Aber er in sie, ganz sicher. Sieht ein Blinder mit dem weißen Stock!“ Die vier Uniformierten sahen sich erst gegenseitig an, dann starrten sie auf den Neuen.
„Was denn?“, fragte der.
„Na, vasteen kann mans ja! Dit Meechen is eene wahre Sahneschnitte, schön un intelligent“, resümierte Kalle Fischer.
„Ja, aber wat unser Chef is, der is ooch nich ohne. Da könnt sich een Meechen een schlechteren angeln. Machen wa ma weiter“, beschloss Manni die Deabatte.
In dem nüchtern in weißer Farbe ausgemalten und mit schwarzen Klappstühlen ausgestatteten Gang zu den Bureaus der Kriminalinspektion Berlin-Brandenburg saß, in ein sittsames, pastellgrünes Kostüm gekleidet, eine ansehnliche junge Dame und beobachtete die umhereilenden Beamten. Ihr dunkelblondes Haar war zu einem modernen, hohen Knoten gebändigt, mit kokett geringelten Locken an den Schläfen bis zur Schulter. Als Oberkriminalrat Kaltenegger auf sie zueilte, erschien ein kleines Lächeln auf ihren vollen Lippen.
„Fräulein Annabelle Reicherth, was kann ich denn für sie tun?“
Annabelle Reicherth hielt ihm die Hand entgegen. „Sie könnten ihre Berliner Aussprache wieder benützten, oder darf man das als Oberkriminalrat nicht mehr? Wissen sie, für mich bedeutet Berlinerisch so etwas wie Heimat. Wenn ich vom Internat wieder einmal nach Hause kam und die ersten Worte von meinem Vater hörte – da wurde mir ganz warm um das Herz, und ich wusste, hier und nirgendwo anders gehöre ich hin. Hier bin und bleibe ich zu Hause. Ich hoffe, dass ich mich selbst nach dem Studium auch wieder in diese Sprache finde, denn wie sollen mir denn Patienten vertrauen, wenn ich nicht einmal ihre Sprache spreche?“
„Se wollen Armenärztin werden, Froilein Reicherth? Aber bitte, kommen se doch mit mich!“ Er führte die junge Frau in ein kleines Zimmerchen, in welchem nur ein Tisch und vier billige Stühle mit stabilen Metallbeinen standen, alle fest mit dem Boden verschraubt.

„Wir aufregend, das hier muss wohl ein Verhörraum sein!“ Annabelle sah sich interessiert um. „Die Türe wird wohl ziemlich schalldicht sein, so dick, wie sie ist. Muss ich jetzt die kolportierte Polizeibrutalität befürchten? Werden sie mich denn jetzt einfach küssen, so wehrlos, wie ich ihnen derzeit ausgeliefert bin?“ Sie ging um den Tisch herum und strich mit den Fingerspitzen darüber.
„Äh, also, ick, wie…“, stolperte Kaltenegger über seine Worte.
„Sehr eloquent, Herr Oberkriminalrat. Bei einer solchen Verhörtaktik muss doch ein jeder Übeltäter sofort gestehen.“ Mit wenigen Schritten war Fräulein Reicherth wieder bei Kaltenegger, baute sich vor ihm auf und griff in seinen Nacken. Rasch erhob sie sich auf die Zehenspitzen und drückte dem überrumpelten Oberkriminalrat ein Küsschen auf die Nasenspitze.
„Froilein, da bin ick jetzt aber platt! Wat soll ick sachen – wat kann ick for sie tun. Warum sin se jekommen?“
„Weil sie sich nicht mehr gemeldet haben, mein lieber Oberkriminalrat. Wollten sie mir nicht über ihre Fortschritte berichten?“ Sie nahm auf einem der Sessel Platz und beobachtete ihn.
„Also, ick – det darf ick doch nich, Froilein Reicherth. Noch nich! Det is verboten, müssen se wissen“, stotterte Kaltenegger. „Also, solange wa noch ermitteln tun!“
Annabelle Reicherth klopfte mit der flachen Hand auf den Tisch am Platz ihr gegenüber. „Setzen sie sich doch bitte zu mir, Herr Oberkriminalrat. Wenn sie über ihren Fall nicht sprechen dürfen, erzählen sie mir etwas von sich. Warum sind sie eigentlich Polizist geworden?“
Zögernd setzte sich Kaltenegger. „Dit is eene unanjenehme und schlimme Jeschichte jewesen, Froilein. Warum wollen se denn dit wissen?“
„Weil ich mit ihnen plaudern möchte, Oberkriminalrat Franz Kaltenegger. Und wenn sie nicht zu mir kommen – nun, ich bin eine moderne Frau!“
„Froilein, ick bin doch nich jut jenuch für eene feine Dame wie sie. Ick bin nur een kleener Polizist.“
„Wollen sie diese Entscheidung nicht mir überlassen, Herr Franz Kaltenegger? Also, warum Polizist?“
„Na schön, warum sollen sie et nich wissen, ist ja keen großet Jeheemnis. Es ist jetzt viereinhalb Jahre her, so um den Dreh rum, da war ick noch Leutnant bei den Jarde-Grenadieren. Rechiment Nummero 1, Kaiser Alexander Jarde. Er war een kleener Fahnenjunker, und man hat ihn anjeklacht. Wechen versuchter Verjewaltigung und Mord an eener jungen Frau, ick war seen Verteidiger vor dem Militärjericht. Fünf von seenen Kameraden haben ausjesacht, dat se mit ihm jemeinsam unterwechs warn, und ick hatte Beweise, dat er den Mord nich bejangen hat, nicht bejehen hat können, aber een Major und een Hooptmann vom Rechiment Nummer 4, Kaiserin Augusta, haben behauptet, dat se ihn dort jesehen und vatrieben hätten. Det Vorsitzende vom Tribunal hat den Offizieren mehr jeglaubt wie die Fähnriche und die Beweese, haben die fünfe, die for den Anjeklachten ausjesacht haben, wechen Meineid verknackt und der beschuldigte Junge musste vors Erschießungskommando. Ick habe ihn auf seenem letzten Wech begleitet, Froilein, der Junge hat nur noch jeweint und janz verzweifelt nach seener Mama jerufen. Dann habe ick den Rock des Kaisers an den berühmten Nachel jehangen und bin zur Kriminalpolizei jegangen. Vorijes Jahr hab ick dann den feinen Herrn Major und seinen Freund überführen können, det feiche Aas hat sich selber erschossen und sein Hauptmann och. Aber der Junge ist zumindest posthum rehabilitiert, und dat war for mir eene jute Sache. Och wenn et ihn nich mehr lebendich macht.“
Die rechte Hand Annabelles legte sich auf die des Oberkriminalrats. „Sie sind ein guter Mensch, Franz Kaltenegger. Kommen sie übermorgen um sechs Uhr zu der Adresse meiner Eltern, damit die sie kennenlernen können!“
„Froilein Annabelle, ick habe doch schon jesacht ick…“
„Sechs Uhr, Oberkriminalrat Franz Kaltenegger. Pünktlich! Ich werde keine Entschuldigung gelten lassen!“ Sie erhob sich von ihrem Platz. „Und jetzt möchte ich bitte gehen!“
„Natürlich!“ Auch der Polizist sprang auf und öffnete die Tür.
„Auf Wiedersehen, übermorgen sechs Uhr!“ Sie reichte dem benommenen Oberkriminalrat noch die Hand zum Kuss, dann schritt sie stolz davon. Kaltenegger sah ihr noch nach, als sie das Gebäude schon längst verlassen hatte.
„Ist allet in Ordnung, Chef“, fragte Julius Bärner.
„Nein, Julius, ick gloobe – ick gloobe, datt ick varückt jeworden bin, oder aba janz dolle verliebt!“
„Beedes det selbe Chef. Aber dit Meechen, dit is een Risiko allemal wert. Warten se nich zu lange, jestehen se ihr ihren Zustand! Bald, bevor et zu spät ist.“
Langsam drehte sich Franz Kaltenegger um und nickte Julius Bärner zu. „Übermorjen, Julius, um sechs!“
„So ist et recht, Chef. Aber kiecken se mal, der Kalle ist ja janz ufjerecht!“
„Danke, Julius. Zuerst die Pflicht, dann dit Meechen! Ick komm ja schon, Kalle!“
Die Tür zum großen Bureau fiel hinter Kaltenegger geräuschvoll ins Schloss.
„Also, wat jibt et“, fragte der Oberkriminalrat in die Runde.
„Neuigkeiten, Chef. Det Jraf von Jelsenstein ist in Paris bei eenem Medium jewesen, und det feine Pinkel ist een Major beim Marinebeschaffungsamt“, berichtete Kalle. „Dat is aber noch nich allet, Chef!“
„Im gleichen Haus ist eine Art Bordell untergebracht, welches der Graf ebenfalls besuchte“, erzählte Binder.
„Na, und nu, weder Puff noch Spiritismus sin verboten“, bemerkte Kaltenegger an. „Also, was ist so sensationell?“
„Det Leutnant Maranski hat sich da an wat erinnert, aus seiner Zeit in Balin, und det Major ist och hier in Balin zu eenem Medium und in een Puff jegangen“, erzählte Atze.
„Und dat witzige, dit Puff in Paris nennt sich..“ Manni blätterte kurz in seinem Block. „Printemps Dorè!“
„Und Printemps Dorè bedeutet…“
„Joldener Frühling!“ Oberkriminalrat Franz Kaltenegger schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. „Danke, Oberleutnant, ick erinnere mir an mein Französisch. Kosaken Kathi also.“
„Jenau, Chef!“ Atze rieb sich die Hände. „Det wat det Leutnant Maranski war, dit hat den Jelsenstein zurück nach Balin vafolcht. Hier in Balin beschattet, un der Jelsenstein hat wieder die Kathi besucht. Mit eenem dicken Paket in der Hand beim rinjehen, ohne dit beim rauskommen. Und da brechen die Aufzeichnungen dann bald ab.“
„Jute Arbeit Leute. Aber wieso habt ihr det so flott jeschafft, wo sich die jeheimen Superajenten die Zähne ausjebissen haben?“
Manni lachte. „Kommissar Zufall, Herr Oberkriminalrat! Sehen se dit Buch? Dat is een janz normalet Tachebuch. Hier etwa, ick zitiere – Ich habe die Baustelle vom Eiffelturm besucht. Es ist ein gigantisches Meisterwerk, eine Verknüpfung von Kunst und moderner Architektur‘ Zitat Ende. Daneben hat er den Turm skizziert. Aba dann, zwischen die Zeilen und an det Rändern, da hat der jute mit unsichtbarer Tinte seine eechentlichen Beobachtungen hinjeschrieben. Im Stenogramm, wahrscheinlich, damit er Platz sparen kann. Kluget Kerlchen, dit Leutnant.“
„Aba leider nich klug jenuch“, bedauerte Fritze. „Irchentwie hat die Kathi oder enne von ihren feinen Freundinnen ihre Griffel in seen Jenick jekriecht, und det war dann dit trauriche Ende vom Leutnant Maranski.“
„Jetzt, wo du et erwähnst“, Kalle kratzte sich den Skalp. „Da war wat, da hat hat doch eene Schnalle ihren Jatten janz hinterlistich uf die gleeche Art abjemurkst. Hat man erst nach mehr dreißich Jahren festjestellt, bei eener Exhumierung, weil der Friedhof mit dit Jrab ufgelassen wurde. Wie man die Knochen aus dem Sarch nehmen wollte, hats im Schädel seltsam jerappelt. Die Olle war über siebzich, als se se ufjehangen haben.“
Kaltenegger nickte. „Bei dit Kosaken Kathi könnte et schneller jehen. Haben wa schon nen Betretungs- und Durchsuchungsbeschluss für dit Puff in die Friedrichstraße?“
„Richter Kinnsaski hat versprochen, sofort einen Boten zu senden.“
„Dann, Jungens, könnt ihr der Kathi ja wirklich so richtich an die Wäsche. Nehmt noch eene oder zwee Gefängnisaufseherin mit. Fier eene Leibesvisitation.“
Im Haus in der Friedrichstraße war abendlicher Hochbetrieb. Sechs Herren und sieben Damen inklusive der Hausherrin waren nur in kunstvoll verzierte Halbmasken oder eventuell noch in ein Korsett gekleidet und vertrieben sich die Zeit mit allerlei erotischen Spielchen und Neckereien, naschten hier ein paar Früchte, tranken dort ein wenig Sekt – nicht unbedingt aus einem Glas. Die beiden Türen flogen krachend auf, und einige Polizisten in Mantel und Pickelhaube strömten mit gezogenen Waffen in den Raum, in welchem die Geräusche sofort erstarben.
„Ich erkläre alle Anwesenden für festgenommen!“ Oberkriminalrat Franz Kaltenegger trat nach vorne, und einer der Männer erhob sich und baute sich vor ihm auf. Vielleicht, dass er in anderer Kleidung imposant gewirkt hätte, doch der Kriminalpolizist bezweifelte das.
„Wer glaubt er, dass er ist, und wer gibt ihm das Recht, hier einzudringen und uns zu stören?“
„Also, ich weiß, das ich der Oberkriminalrat Franz Kaltenegger bin, und dass mir der Richter Kinnsaski und die Gesetze seiner Majestät, des Kaisers und die Gesetze des Reiches das Recht geben, hier einzudringen und alle Anwesenden zu verhaften. Das betrifft auch sie, wer immer sie sein mögen!“
„Und warum?“
„Steht allet hier drinne, Männecken. Also, willste noch Hosen anziehen oder jeste mit, wie’s de bist?“
„Ich verbitte mir diese Impertinenz! Ich bin Markgraf Ludovsky und verlange…“
„Jar nüscht für den Momang, Männecken! Een nackichter Mann mit seltsamer Maske verlangt sicher nüschts. Abführen, Kollechen! Vielleicht jefällt dit Ofmachung det Jungs im Knast ja sojar.“
„Waruum werden wir verchaftet?“ Eine Frau in goldener Halbmaske und eng geschnürtem Mieder leistete keinen Widerstand, fragte aber lautstark mit russischem Akzent. Kaltenegger nahm ihr die Maske ab und sah in ihr engelsgleiches Gesicht.
„Mord in zwei Fällen, Anstiftung zum Mord, Spionage, Verschwörung gegen das Reich und den Kaiser, mal sehen…“ Kaltenegger schnupperte vernehmlich. „Vielleicht kommt noch Verabreichung von Drogen dazu, es riecht hier so süßlich. So, dat langt mal fors erste, später kommt vielleicht noch dat eene oder andere dazu. Meine Damen Schließerinnen, durchsuchen se die Dame. Sorchfältich bitte.“
„Jeht klar, Herr Oberkriminalrat!“ Liese Mayr zog sich die geniale Erfindung des Herrn Thomas Forster aus Streatham über die kräftigen, großen Hände. Seit 1878 hatte dieser Mister Forster ein Patent für dünne, aber völlig dichte chirurgische Gummihandschuhe. Diese konnten mit heißem Wasser sterilisiert werden und fanden auch bei der Polizei und Justuzwache vor allem für die rektalen Untersuchungen von Arrestanten Verwendung.
„Also, Kathi, ist ja nich dein erstes Mal. Beene auseinander und versuch mal, ob du die Zehen mit det Fingern erreichen kannst. Ich benutze auch janz viel Vaseline, wennste brav bist. Vasprochen!“
Die Gäste wurden trotz aller Proteste in Handschellen abgeführt und mit dem ‚Gitterwagen‘ in das Untersuchungsgefängnis gebracht, wo sie photographisch erfasst und ihre Personalien protokolliert wurden. Kaltenegger stieg einstweilen die Treppe empor.
„Dit ist wohl det Zimmer von die Kathi“, vermutete er in einem opulent eingerichteten Schlafzimmer. Dicke Samtvorhänge in Purpur, mit Gold bestickt, das breite Bett mit ebensolcher Bettwäsche, vergoldetes Mobiliar in allen möglichen Stilrichtungen. Ein barocker Sessel, eine Rokoko-Kommode, ein Empire-Tischchen, eine klassizistische Figurenuhr. „Kalle, Fritze, kiekt euch hier mal um.“
„Also, über Jeschmack kann ma streiten“, stellte Fritze fest. „Aber janz bestimmt steht fest, dit Kathi hatte keenen. Jedet Teil for sich kiekt nich so übel aus, aba in der Masse und Mischung – ne!“
„Denkste, dit Meechen hat dit Flechettedings hier im Buduaa herumliechen“, überlegte Kalle. „Ick meen, dit wär entweder jenial oder dämlich!“
„Dit kann ma beedes sein, Kalle!“ Fritze zog den Mantel aus, warf ihn über einen Stuhl und stellte die Pickelhaube ab. „Ma kieken, wo würde ick mir vastecken, wenn ick so kleen wie eene Pistole wäre und nich jefunden werden will?“
„Det Sekretär wäre naheliechend. Aber vielleicht auch zu nahe!“ Kalle begann, das Möbel sorgfältig abzuklopfen. „In diese alten Dinger jibt es fast immer een Jeheimfach.“
„Stimmt. Aber ooch dit lose Dielenbrett isf een Klassiker. Oder dat Vasteck hinter eenem Bild!“ Fritze sah sich um.
„Kennt jeder und kiekt nich mehr nach? Meenste in det Art?“ Kalle stutzte und klopfte noch einmal auf eine Stelle, markierte das dünnere Holzstück der Rückwand des Sekretärs.
„Jefunden haste dit Ding. Aba wie jehts uf?“ Fritze stellte sich neben den Freund.
„Ham wa gleech! Die Olle hatte doch ne Lupe hier liechen – ach, da is se ja. Kieck mal, hier is det Holz anders, Momang!“ Kalle verschob einen Holzriegel, das Fach sprang auf.
„Und, ham wa die Pistole?“
„Nee, Fritze, nur een Packen Papier. Is aba vielleicht ooch nich uninteressant. Nehmen wa det Ding mit!“ Die Papiere wanderten in die für diesen Zweck mitgenommene Aktentasche.
„Jut, denn kieken wir hinter die Bilder. Fangen wa rechts von dit Tür an und arbeiten wir uns im Uhrzeigersinn weiter.“ Beide begannen, die Bilder von den wänden zu nehmen.
„Oha, dit is een jewaltiger Schrank hinter det Portrait von der Kathi als Jroßfürstin aller Russen.“
„Wat is drinne, Fritze?“ Kalle drehte sich um.
„Ne Menge Joldmünzen und Papierjeld. Pfundnoten, Markscheine, Papiergulden und jedruckte Franks. Kalle, det is furchtbar viel Jeld. Ruf ma besser die Kollechen und den Chef, aba bleib an det Tür stehen. Ick komm zu dich!“
„Jeht klar, Fritze!“ Im Zimmer der Kosaken-Kathi angekommen, staunte der Oberkriminalrat Franz Kaltenegger tatsächlich über die Menge an Geldmittel, welche hier gebunkert waren.
„Na, Jungens, dit is mal een Fund. Da wird sich die Staatskasse janz jewaltich freuen! Atze, du jehst ma die Kollechen von det Finanzbehörde vaständichen, die sollen mit eenem Jeldwachen kommen!“
„Jut Chef. Ick habe unten een Telephon jesehen, vielleicht jeht dat schneller, als wenn ick loofe!“
„Jute Idee, Atze. Die anderen jehen nich in dat Zimmerchen, ehe nich die Finanzer da waren. Sucht woanders, aba keener verlässt dat Haus! Ick ooch nich“, befahl Kaltenegger.
Als Atze eben wieder die Treppe hinaufging, schellte es an der Haustür, und ein Leutnant im blauen Uniformrock der Infanterie mit dem roten Stehkragen und den roten Manschetten zu schwarzen Hosen und Knobelbechern.
„Hallo! Ist Herr Oberkriminalrat Franz Kaltenegger hier zugegen?“
Halb auf der Treppe drehte sich Atze um. „Is er, Herr Leutnant. Wat kann er denn for sie tun?“
„Ich habe hier eine Nachricht für ihn. Persönlich zu übergeben!“
„Jut, Herr Leutnant. Ick sach ihm Bescheid! Bitte nehmen se solange Platz, der Chef kommt gleech!“ Damit stieg Atze die Stiege komplett hinauf und erstattete Kaltenegger Meldung.
„Een Leutnant, der selber kommt un keen Steppke schickt. Da is wat faul im Staate Dänemark!“
„Wat? Wieso den Dänemark? Wat hat denn dat mit zu tun“, kratze Konrad Maraskowski sich am Kopf, und Kalle verdrehte die Augen.
„Na, det is doch aus dem Hamlet von Schekspier. Lieste eegentlich noch wat anderes außer unseren Akten, Konrad?“
„Ne! Des is jenuch for mir!“
Derweil schritt Kaltenegger die Treppe hinunter, und der Leutnant sprang auf und salutierte. „Herr Oberkriminalrat Franz Kaltenegger?“
„Der bin ich. Sie können bequem stehen, Herr Leutnant. Was hat es mit dem Schreiben denn auf sich?“
„Es ist von Oberst von Donnermark. Mehr weiß ich leider nicht!“
„Nun gut!“ Der Polizeibeamte griff in die Tasche und holte seinen Ausweis hervor, den der Leutnant betrachtete und danach mit dem Brief an Kaltenegger zurück gab.
„Empfehle mich, Herr Oberkriminalrat!“
„Danke Leutnant.“ Kaltenegger ging wieder nach oben und öffnete dabei das Schreiben, welches er rasch überflog. Auf halber Höhe der Treppe stockte sein Schritt, er las aufmerksamer, dann stieg er die Treppe vollends hinauf und zeigte Atze den Brief.
„Kieck dir det ma an, Atze. Da hat der Donnermark eene Depesche aus Wien jekriecht. Wir, also das Deutsche Kaiserreich, werden zwar von höchster Stelle, aber janz inoffiziell vor dem Joldenen Frühling jewarnt. Spionage und Anwerbung for subversive Aktionen im nahen Osten. Det is vielleecht een Wespennest, in dat wir da jestochert haben.“
„Wat denn, dit olle Donnersmark vertraut uns so ne vertrauliche Information an. Chef, da haben se nen dicken Stein in dem sein Brett. Ick zieh det Helm vor ihnen!“ Atze schöpfte mit seiner Pickelhaube einen imaginären Fischteich aus.
„Ne, ne, Atze. Der hat det Vertrauen zu uns allen. Er hat doch jewußt, dat ick euch det sachen werd‘. Jungs, da ist noch wat. Ihr alle, ihr seid in den kriminalen Dienst vasetzt. Unterkriminalräte seid ihr jetzt, gratuliere, Jungens. Morjen im Zivil zum Dienst, ooch wenn die Besuche von Atze bei die Martha in dit Dienstzeit nich mehr drinne is.“
„Mensch, Unterkriminalrat!“ Atze kratzte sich am Kopf. „Na, det ist doch een ehrbarer Rang. Wat will dit Martha mehr, jetzt wird se mir wohl hoffentlich nehmen!“
„Jut, Jungs, wa haben jetzt aber jenuch Maulaffen feiljeboten!“ Kaltenegger klatschte in die Hände. „Lecht ma een Zahn zu, wa müssen noch dit Flechette-Pistole finden.“
=◇=
„Wat biste?“ Martha Krakowski hatte die Fäuste in jener Geste in die Hüfte gestützt, die Frauen seit Jahrhunderten eigen war. Wahrscheinlich schon seit jenen Tagen in der africanischen Savanne, als sich Homo sapiens auf den Weg nach Norden machte. „Unterkriminalrat? Wat ist denn dat?“
„Na, dat ist, dass ick Polizist ohne Uniform bin. Zivilbeamter!“
„Und? Soll ick jetzt in Ehrfurcht erstarren oder wat?“ Die gute Martha war nicht zufrieden gestellt.
„Ne, jutes Meechen. Steif sollste nich wern, dat kannste mir überlassen. Aba heiraten sollste mir! Ick kann et mir jetzt leisten, dir durchzufüttern.“ Der Polizist versuchte, das Dienstmädchen in die Arme zu nehmen, aber sie wich zu Seite.
„Wat denn, icke soll abhängig von dich werden? Schmink dich det ab. Ick vadien meen Jeld selber! Wennste et Ernst meenst, na jut, ick heirat‘ dir, wennste nen Ring hast. Aber meen Schtellung jeb‘ icke noch lang nich of. Ne, ne, det is nich! Also hat du nen Ring?“
„Hab ick, Martha! Hab ick. Kieck ma!“ Atze holte ein Schächtelchen aus der Manteltasche und klappte es auf.
„Atze! Du bist ja een janz varückter Typ! So `n mächticher Klunker! Du menst et ja scheint’s richtich ernst!“
„Kla, Martha, janz ernst! Ick – na ja, wat soll ick sachen, ick, na, ick liebe dir halt!“ Atze wurde rot und stotterte ein wenig.
„Wat haste jesacht? Wat tuste?“ Martha hielt ihre gewölbte Hand hinter ihr Ohr und beugte sich vor.
„Ick liebe dir, Martha“, nickte Atze. „Janz dolle sojar!“
„Und, warum sachste dit nich gleich, du alter Esel?“ Die Köchin kuschelte sich in die Arme des Polizisten. „Kla machen wa Hochzeit, wennste mich so frachst. Aba ne Zeit lang werde icke doch noch arbeeten. Da ham wa dann ne bessere Wohnung, wenn icke schwanger werd‘!“
April 1889
Vereinigte Donaumonarchien
Im Palast Tridor wurde die übliche Seance am Nachmittag abgehalten, Mariamne Fürstin Sabatini alias Marianne Sabič vermittelte wieder einmal zwischen der Geisterwelt und jener ihrer Gäste. Wie immer fühlten sich die Gäste nachher bei weitem besser, und Marianne bat Karoline Markovič noch kurz in ihren Salon, sie wolle ihr noch etwas geben, wegen ihrer Probleme. Wenig später vermerkte der Polizeibeamte in Zivil Valentin Titovčik auf seinem Block ganz korrekt mit der Uhrzeit, dass das Hausmädchen mit einer großen Einkaufstasche das Haus verließ, das war nicht ungewöhnlich. Wenig später ging der letzte Gast der Seance, der Kleidung und dem Hut nach eben diese Karoline Markovič, ein Stammgast, den man bereits identifiziert hatte. Auch das vermerkte Valentin noch mit der Zeitangabe auf seiner Liste, ehe er kurz danach abgelöst wurde.
=◇=
Das Palais Tridor lag in einem der besten Gebiete der Stadt Triest. Gleich gegenüber lag in einem klassizistischen Bau das britische Konsulat. In einem der Räume saß in seinem Bureau mit Blick auf das Tridor der Konsul einer kaum 24 Jahre alten, recht hübschen Frau gegenüber. Franziska Ziegler kam aus Leipzig, wo sie eben für die renommierte Zeitschrift ‚Die illustrierte Gartenlaube‘ zu arbeiten begonnen hatte. Die Gartenlaube veröffentlichte kürzere und Fortsetzungsromane, Novellen, Gedichte und Artikel über Autoren bekannter Werke. Mehr als eine Ausgabe war dabei bereits überaus konservativen Richtern und selbsternannten Sittenwächtern zum Opfer gefallen, zum Beispiel ‚Venus im Pelz‘ von Sacher-Masoch. Deswegen wurden auch einige Sonderauflagen der Zeitschrift im bayrischen Hof gedruckt und von dort aus auch versandt. Die k.u.k. Beamten waren da wesentlich weniger kleinlich, auch wenn der Betrachter für die Illustrationen nicht mehr viel Phantasie benötigte. Wenn diese Beamten nur ihr Belegexemplar erhielten.
Vor einem Jahr hatte Felix Paul Greve in einer dieser Sonderausgaben die Übersetzung eines Werkes in der Gartenlaube veröffentlicht, das Franz von Bayros aus Zagreb und Raphael Kirchner aus Wien illustrierten. Der Titel lautete ‚Das Buch der tausend Nächte und die eine Nacht‘. Die arabische Sammlung orientalischer Erzählungen mit der Rahmenhandlung mit dem Titel alf laila wa-laila hatte ein englischer Africaforscher, Übersetzer und Orientalist erstmals unzensiert in die englische Sprache übertragen. Greve hatte diesen Text mitsamt den manchmal recht erotischen Passagen ungekürzt übernommen, und auch die Illustrationen waren nicht gerade zimperlich. Dieser Orientalist und Abenteurer war nun britischer Konsul in Triest und saß Franziska gegenüber.
„Sir Richard“, begann Franziska das Interview. „Sie schreiben in einem ihrer Werke, sie seien in Barham House, Hertfordshire geboren. In ihren Akten aber ist Toquay in Devonshire vermerkt. Beide Orte sind aber ein gehöriges Stück von einander entfernt. Was stimmt denn nun?“

Der Diplomat breitete seine Arme aus. „Ich muss um Vergebung bitten, Miss. Ich bediente mich einfach einer dichterischen Freiheit. Die Gründe, welche zu meiner Geburt tief im Südwesten Englands führten, kenne ich verständlicherweise nur aus zweiter Hand. Aber ich wollte sie damals nicht bekannt machen, und ich will es heute noch nicht.“
„Natürlich, Sir Richard. Ich akzeptiere das!“ Ziegler sah auf ihren Block. „Aber vielleicht können wir über Mekka sprechen? Sie sind der erste Europäer, welcher die heilige Stadt der Moslems betreten hat?“
Über das markante Gesicht des Konsuls huschte ein leichtes Lächeln. „Das kann ich mir so nicht ganz an die Brust heften, Miss Ziegler.“ Die Journalistin riss die Augen auf.
„Sie – sie sind aber schon Captain Sir Richard Francis Burton, oder“, brach es aus ihr heraus.
Sir Richard F. Burton, E. C., GCMG war 68 Jahre alt, hielt sich aber immer noch kerzengerade. Seinen angegrauten, lockigen Bart trug er lang und gegabelt, das kurze Haar ähnlich Napoleon Bonaparte von hinten in die hohe Stirn gekämmt. Nun lachte er auf.
„Aber ja! Ich bin jener Burton, der versuchte, 1857 mit Speke die Quellen des Nils zu finden. Der 1861 gemeinsam mit ihrem Landsmann Gustav Mann als erster den Kamerunberg bestieg. Das Nigerdelta und Dahomey erforschte. Britisch-Amerika, Canada und Brasilien bereiste. Ich war Konsul auf Fernando Poo, in Santos, Damaskus und jetzt in Triest. Außerdem war ich 1853 wirklich in Mekka. Ich kann aber nicht behaupten, die Stadt als erster Europäer betreten zu haben.“
„Nicht?“ Franziska legte den Kopf schief. „Aber…“
Burton hob die Hand. „Ich war nur der erste Nichtmuslim, dem es gelang, die Stadt wieder lebend und gesund zu verlassen. Der erste, der davon berichten konnte.“
„Ach so!“ Die Deutsche kicherte kurz hinter vorgehaltener Hand. „Ich hätte wissen müssen, dass der Übersetzer der Geschichte von 1001 Nacht exakt sein würde. Immerhin, auch bei der Beschreibung einiger Szenen waren sie doch sehr – detailliert!“
„Dabei habe ich mich bei der Übersetzung noch zurück gehalten, Miss.“ Richard zwinkerte ihr zu. „Ich übersetzte etwa die verwendeten arabischen Worte mit Geschlecht oder Glied.“
„Was hätten diese Worte denn sonst bedeutet?“ Ziegler lehnte sich vor, der Stift schwebte über dem Block.
„Etwas, das ich nicht einmal meiner Frau ins Ohr flüstern würde, Miss Ziegler.“ Burton schüttelte den Kopf. „Schon gar nicht einer jungen Dame. Sie sind eine moderne Frau, und ich gehe davon aus, dass ihnen weder die Körperteile noch die Handlung an sich fremd sind!“
„Da können sie sicher sein, Sir Richard“, betonte Franziska Ziegler. „Immerhin habe ich auch ihre Übersetzung des Kama Sutra gelesen!“
„Wie ich vermutet habe. Dennoch“, beharrte der Brite. „Es gibt Ausdrücke, welche eine junge Dame nicht hören sollte!“
„Nun gut.“ Franziska lehnte sich wieder zurück. „Sprechen wir über Africa und die Sahara!“
„Über diese alte Sache?“ Burton zog die Brauen hoch. „Ich dachte, die Geschichte hätte Herr Maerz schon in ihrer Zeitschrift ausführlich erzählt!“
„Also stimmt es“, vergewisserte sich die Sächsin. „Sie sind dieser Sir Richard B., der mit Herrn Maerz die Raubkarawane jagte?“
„Die Gum, ja. Wir trafen uns eher zufällig in Tunis, er wohnte bei einem Freund meines Gastgebers. Er hat allerdings in seiner Geschichte unser kennenlernen ein wenig simplifiziert. Vereinfacht. Sie können sich vorstellen, dass das nicht so leicht war. Ich, der erfahrene Offizier und er, der junge Springinsfeld. Immerhin ist er etwa 25 Jahre jünger als ich, ihn da sofort als Gleichgestellten zu betrachten, war etwas schwierig. Aber er hat nicht aufgegeben, er hat mir bewiesen, dass er sich gut zurechtfand und rasch lernte. Einige Szenen, in denen er seinen Diener belehrt und von dessen Überlegungen überrascht wird, haben sich in Wirklichkeit zwischen uns abgespielt. Damals waren sie aber nicht so amüsant. Am Ende wurden wir dann doch ganz gute Freunde. Er hat sich dann in der Story älter und mich jünger gemacht, sodass er leichter ein Team auf Augenhöhe beschreiben konnte.“
„Und es ist ihnen wirklich gelungen, den Sohn des Kaufmannes zu befreien und die Anführer der Räuber zu stellen?“
„Nicht nur das. Auch einige andere Männer und Frauen, von deren Verwandten die Gum Lösegeld erpresste. Die Anführer waren zwei Zwillingsbrüder, eher eine Seltenheit bei den Berbern. Nun ja, dem einen Bruder hat Charley Maerz eine Revolverkugel in den Kopf geschossen, und dem anderen ein paar Tage später ich. Und der Rest der Gum, nun vielleicht gibt der ewige Sand der Sahara ihre Gebeine irgendwann wieder frei. Dann wird man unsere Kugeln in ihnen finden. Besonders die von Maerz. Diese Riesenkanone ist verdammt selten in Africa und Europa. Sie wurde für die Great Plains von British-Amerika konzipiert und eigentlich nur dort verkauft.“ Burton erhob sich und sah sinnend und mit der Erinnerung beschäftigt aus dem Fenster. Aus dem gegenüber liegenden Tridor kam das Dienstmädchen mit einer großen Einkaufstasche und wuselte davon. Der Brite wunderte sich kurz, dass sie in die falsche Richtung ging, sich also vom Markt entfernte. Aber was wusste er schon von ihrem Auftrag. Und was ging ihn dieser auch an?
„Und später haben sie Herrn Maerz dann wieder getroffen?“ Franziskas Stimme riss ihn aus seinen Überlegungen.
„Auch das stimmt, Miss. In Tripolis.“ Captain Burton drehte sich wieder um und sah Franziska an. „Er war dort mit seinem Freund K’ááTo durch die Wüste hinter einem Gangsterduo her gewesen, Vater und Sohn. Es war ein großer Betrug. Eine Erbschaftsangelegenheit. Später wurde ein Mord daraus. Ich habe meine Hilfe angeboten, welche auch gerne angenommen wurde. Wir verfolgten die Mörder bis nach British-Amerika, dort kamen auch noch der Bruder des Vaters und eine Verlobte des Sohnes dazu. Ein ganz verdorbenes Frauenzimmer. Schlimmer noch als diese Betrügerin vis a vis.“
„Eine Betrügerin“, staunte Franziska. „Und die Polizei unternimmt nichts?
„Ein Medium“, bekräftigte Burton. „Nun ja, vielleicht kann sie wirklich ein wenig. Ich habe im Orient Zauberinnen kennengelernt, also, es gibt so etwas wie übersinnliche, unerklärliche Kräfte. Es gibt ja auch Metamorphen und Vampire. Aber irgendwie – mit ihr stimmt etwas nicht! Meine Nase!“ Der Konsul klopfte mit dem Zeigefinger darauf. „Auf die kann ich mich verlassen! Aber sprechen wir von etwas anderem.“ Er blickte kurz noch einmal aus dem Fenster. Diese Frau, der letzte Gast wirkte etwas anders als bei ihrem Kommen, da war sie…
„Von Damaskus? Der Frau des Vizekönigs?“
Burton wieherte laut. „Erstunken und erlogen, eine reine Erfindung vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Ich schrieb die Geschichte nur, um diesen verklemmten Puritaner Speke zu ärgern. Was mir auch gelang! Nun ja, der Bursche ist tot, da kann ich es ja zugeben. Ich habe die Frauen des Vizekönigs niemals zu Gesicht bekommen! Und die Frauengemächer auch nicht. Aber jeder hat mir das Abenteuer abgenommen und mich beneidet. Wollen sie vielleicht etwas trinken, Miss Ziegler? Eine Tasse Tee? Einen kleinen Port? Stört es sie, wenn ich rauche?“
=◇=
Der Polizeichef von Triest sichtete in seinem Büro am Morgen die eingegangenen Depeschen und trank seinen Kaffee dazu.
„Johannis“, rief er dann in das interne Telefon. „Heute verhaften wir endlich die Sabič, Befehl aus Wien. Die drehen ihr den Strick wegen der fehlenden Lizenz und den ausständigen Arztbesuchen, das Tridor wird als unangemeldete Betriebsstätte im Bordellgewerbe eingestuft. Außerdem wird die Finanz noch das eine oder andere Wörtchen mit ihr reden wollen!“
„Auch nicht schlecht“, gab der Inspektor zur Antwort. „Hauptsache, sie wird jetzt endlich zumindest eine Zeitlang aus dem Verkehr gezogen! Vielleicht zwitschert der Vogel im Käfig ja auch einmal.“
„Ja, schon. Ich glaube ja auch immer noch, dass die etwas mit dem Verschwinden vom Bornthal zu tun hat. In dem seiner Wohnung hat man auf jeden Fall einige Aktskizzen gefunden, alle mit einem Gesicht, das dem von der Sabič schon sehr ähnlich ist. Egal jetzt. Nimm dir vier uniformierte Beamte und hole sie ab. Dann können wir sie gleich heute mit dem Zug um fünfzehn – zwanzig nach Wien überstellen. Ich ruf einmal die Bahn an, ob die noch einen Käfig anhängen können.“ Käfig, das war der k.u.k. – Jargon für einen speziell gesicherten Eisenbahnwagen, ein- und ausbruchsicher, für wertvolle Fracht und auch hervorragend geeignet für Gefangenentransporte.
Wenig später stand der Inspektor vor dem Tridor und klopfte – vergebens. Hinter dem massiven Holztor blieb alles ruhig.
„Na, dann!“ Johannis Gamtič trat beiseite und winkte einem der Uniformierten zu. „Aufmachen!“ Der Mann kniete nieder und fummelte kurz an dem kleinen, modernen Schloss, das trotzdem mehr Schutz bot als die alten mit den großen Schlüsseln. Der als Schlosser ausgebildete Beamte benötigte dennoch nicht viel Zeit, bis die Tür seiner Arbeit nachgab und aufsprang.
„Vorwärts, vorwärts! Haus durchsuchen, jede Person festnehmen. Schusswaffengebrauch ist autorisiert, die Gesuchte ist unter Umständen gefährlich.“ Die vier Polizisten zogen ihre langen Dienstrevolver Kaliber 9 Millimeter von Mannlicher und schwärmten aus, während der Inspektor in der Eingangshalle wartete.
„Da ist eine weibliche unbekleidete Leiche in einem Salon“, rief einer der Beamten nach unten, und Gamtič hastete in den ersten Stock.
„Wie ist sie gestorben“, rief er bereits während des Laufens nach oben.
„Erdrosselt, eine Garotte mit Laufknoten! Ein hundsgemeines Ding! Wenn man das Ding einmal dem andern übergestreift hat, kann man sich entfernen und braucht nur noch zusehen, wie das Opfer langsam erstickt!“ Der Gendarm in Uniform kannte sich damit aus, er hatte nicht erst einen Lehrgang über solche und ähnliche Mordinstrumente hinter sich.
„Wird uns doch nicht einer die Arbeit abgenommen haben“, knurrte Gamtič, als er den Salon betrat. „Nein, das ist sie nicht. Teufel noch mal, schickt mir einmal den Titovčik herein! Und einer von euch benachrichtigt den Herrn Oberkommissär, ich denke, wir müssen die Bahnhöfe und den Hafen kontrollieren. Wenn es nicht schon zu spät ist.“ Der Inspektor schlug mit der Faust gegen den Türstock. „Verdammte Scheiße! Und jetzt hinaus mit euch, bevor ihr noch mehr verändert. Der Oberkommissär wird sich selber ein Bild machen wollen. Der Photograph und der Zeichner sollen auch kommen.“ Gemeinsam gingen die Beamten ins Erdgeschoss.
„Wo geht denn diese Tür hin?“ Gamtič griff zu Waffe mit verkürztem Lauf, welche er unter dem Gehrock trug, und nickte einem der Gendarmen zu. Dieser trat neben die Tür, ehe er sie aufriss.
„Scheinbar ein Kühlkeller, von dort unten kommt es jedenfalls ganz schön kalt herauf, Herr Inspektor.“
„Dann schauen wir mal nach, Leute. Kommt mit!“ Langsam stiegen sie die schwach erleuchtete Treppe hinunter und öffneten unten vorsichtig eine weitere Tür.
„Zumindest die Fahndung nach dem Bornthal hat sich damit wohl erledigt!“ Der Wachtmeister leuchtete mit seiner Karbidlampe in das Gesicht einer weiteren Leiche.
„Stimmt, und der Oberkommissär hatte recht! Die Sabič hat wirklich etwas mit dem Verschwinden von seinem Vorgänger zu tun gehabt! Sie hat in ganz offensichtlich umgebracht.“
Etwa um die Zeit, in der das Polizeikommando in Triest das Palais Tridor stürmte, stieg in Ravenna eine wahrhaft schöne, exotische Frau in einem modischen und offensichtlich sehr teuren Reisekostüm in Begleitung ihrer Zofe in den Zug nach Rom. Ihr einziges Gepäck bestand aus einer kleinen, aber scheinbar wertvollen Reisetasche, welche sie nie aus den Augen ließ. Auch im Speisewagen nicht, den sie wenig später mit ihrer Bediensteten aufsuchte. Marianne Sabič war den österreichischen Behörden vorderhand entkommen und auf dem Weg nach der italienischen Hafenstadt Civitavecchia, wo sie sich unter dem Namen Madame Chloë Sorvaise einzuschiffen gedachte. Ein Name, für den sie auch sämtliche Papiere vorweisen konnte. Sie wollte zuerst einmal nach Tunis.
=◇=
Bei der Antschi, der Branntweinerin vom Herdermarkt, saßen einige Trankler am späteren Vormittag bei ihrem zweiten Frühstück, welches sie wie das erste in flüssiger Form mit vielen Prozenten zu sich nahmen. Sie bemerkten als erste die von der Gottschalkgasse in den Geiselberg einbiegenden beiden Dampfbusse des Einsatzkommandos und den Gefangenentransporter der österreichischen Polizei. Diese Busse verfügten über keine Türen, sondern nur Sicherheitsketten, sodass die Beamten jederzeit seitwärts von ihren Bänken springen konnten und sofort einsatzbereit waren. An diesem Tag hatte es der April nicht gut mit den Polizisten gemeint. Als sie in Mistelbach in ihre Fahrzeuge stiegen, hatte es geregnet, ein kühler Wind hatte das Wasser in die seitwärts offenen Busse geweht. Dann war die Sonne durchgebrochen und es war schlagartig warm geworden. Zuerst eine Wohltat, war es dann in den dicken Regenmäntel rasch zu warm geworden. Auf der Simmeringer Hauptstraße hatte dann der Kommandant einen Stopp befohlen, und dankbar hatten sich die Polizisten von ihren Mänteln befreit und diese in den Bänken verstaut. Dann war die Fahrt weiter gegangen.
„Geh leck mi am Oasch! De Mistelbacher!“ Der schwere Zungenschlag verriet, dass der Raunzer Koarl schon einiges intus hatte.
„Und heit homs a no in Nachtscherm auf“, pflichtete der Rübenseppl bei. „Da mochens irgendwo Aktion schoaf!“
„Schau‘n ja auch scharf damit aus“, bekannte die aufgedonnerte, aber stark überwuzelte ehemalige Schauspielerin Hannelore Border. Sie hatte die jungen naiven und dummen Frauen gespielt, doch für Charakterrollen hatte ihr Talent eben nie gereicht. Und als dann der Busen nicht mehr so prall war und die Falten im Gesicht beim besten Willen nicht mehr überschminkt werden konnten, da war es mit der Bühnenkarriere vorbei. Das hatte die Hanni schwer getroffen. Nicht des Geldes wegen, einer ihrer früheren Verehrer hatte ihr eine recht gute Rente hinterlassen. Aber ihr Selbstverständnis einer schönen, begehrenswerten Frau war zerstört. Seitdem soff sie sich eben die Welt schön, und manchmal fand sie bei der Antschi auch noch einen Mann für bestimmte Stunden, der nicht all zu heikel war. Oder der eine warme Bleibe brauchte. „Da könnt‘ man doch schon schwach wird‘n!“
„Wånns deine Hax’n und Dutteln sechen, bestimmt“, frotzelte Borstl-Horstl, der Schlächter und krümmte den vorher gestreckten Zeigefinger.
„Geh scheißen, Oaschloch“, schimpfte die Hanni jetzt in breitestem simmeringer Dialekt. „I war a Sensation auf da Bühne! Von weit her sans kumman, de Månner, nur dass mi sechn kennan. Oba, wos was ana wie du schon vom Theater?“ Hanni schloss die Augen, summte eine Melodie und wiegte sich tanzähnlich. „Die Gnädige Frau hab‘ ich g’spielt in Schillers ‚Kabale und Liebe‘. Und die Madame Pompadur. Die heilige…“
„Passt! Am Kreiz lieg’n und di någeln låss’n kaunst eh am besten“, spottete Horst.
„Wappler, deppata“, gab Hanni noch von sich, bevor sie das nächste Glas des billigen Obstlers kippte.
„De Mistelbåcher san bei da Pepi“, rief Willi, als er an die Schank kam. „An Rum, Antschi!“
Der 1872 geborene Karl Kaniak hatte eine begehrte Lehrstelle als Lithograph, als Steindrucker gefunden. Aufgewachsen war er in Simmering, in ärmlichsten Verhältnissen. In der Geiselbergstraße Nummero 5. Fleißig war er, der Bub, mit 17 schon knapp vor der Gesellenprüfung. An seinen freien Tagen zog es ihn hierher, wo er sich schon als Kind herum getrieben hatte. Er genoss das Flair, den Geruch, das Schwatzen der Standler und Greißler mit ihren Kunden. Eben hatte er sich eine Burenwurst und ein Seiterl Bier bestellt, mit einem scharfen Senf und einem Scherzerl, da kamen die Dampfbusse der Mistelbacher mit etwa fünfzig Sundenkilometern über die Geiselbergstraße gedonnert und blieben fauchend vor dem Vorstadtschlösschen der Baronesse Klederwald alias Pepi Hintwitz stehen. Die acht Männer des ersten Busses liefen mit ihrem Unteroffizier sofort nach hinten, um die Hintertür zu sichern, während der Offizier mit dem federgeschmückten Hut an der Vordertür klopfte. Karl hörte, wie er es drei mal machte und sich dabei als Polizei zu erkennen gab und auf eine richterliche Entscheidung hinwies. Dann ein viertes mal, mit der Warnung vor Gewaltanwendung. Zwei Uniformierte nahmen eben den Dampfspreizer vom Bus, da öffnete sich die Pforte doch einen kleinen Spalt breit. Der Leutnant fackelte nicht lange und stieß die Tür gewaltsam auf.
„Im Namen des Kaisers und der Regentin, wir haben einen Haftbefehl für Josephine Hintwitz!“
Besagte Josephine Hintwitz kam aus dem Hauseingang, in ein modisches, elegantes Kostüm gekleidet. Trotzdem strahlte die Frau eine geballte Erotik aus, welche noch bis zu Karl Kaniak drang. Ein überhebliches Grinsen zeigte sich auf der Miene der Frau.
„Ich muss ja eine ganz gefährlicher Person sein“, spottete sie. „Gleich zwanzig Kieberer vom Einsatzkommando, um eine Frau zu verhaften. Also bitte!“ Sie streckte ihre Arme vor, und der Offizier legte ihr Handschellen an.
„Meine Damen“, wandte er sich an die beiden Beamtinnen der Justizwache. „Bitte bringen sie die Angeklagte ins Landesgericht.“
„Nå, dånn kumm mit, Pupperl!“ Die Aufseherin mit den drei Sternen auf dem Kragen ihrer Bluse nahm Josephine und bugsierte sie zum Gefangenentransporter. „Eine da!“ Als der Transportwagen weg war, wandte sich der Leutnant an seine Beamten.
„Ich möchte jeden Fuzzel Papier für die Kriminäser eingsackelt haben. Und wenn’s das Billett von einer Bim ist. Also los, gemma, gemma!“ An diesem Abend schrieb Karl Kaniak seinen ersten Artikel für die sozialistische Arbeiterzeitung. Es sollte nicht sein letzter bleiben.
Aufgeregt sah der Fleischhacker Mathias Leiserer von seinem Dauerstand aus zu, wie Josephine Hintwitz in den Häfenwagen bugsiert wurde und dieser dann die Geiselbergstraße zur Simmeringer Hauptstraße hin verschwand.
„Was ist, Budelhupfer! Hast jetzt a schön’s Schweinsschnitzerl oder net. I brauchert drei Scheiben, aber net z’kla.“
„Aber selbstverständlich, gnä Frau“, konzentrierte er sich wieder auf seine Kundin, die er seit Jahren kannte. „Schaun’s ihnen des Gustostückerl an, also des wird als Breselteppich, der reinste Genuss. Leicht durchzogen, dass net so trocken is, ganz so, wie’s der Herr Gemahl wünscht. Darf’s sonst noch was sein?“ Nein, es war genug, dieser Einkauf war beendet, und Leiserer warf die Einnahme in die Schublade seiner Verkaufstheke, die ihm als Kasse diente.
„Ein kleines Momenterl, der Herr“, entschuldigte er sich dann bei seinem nächsten Kunden. „Geh, Steffel, kum amal her!“ Rasch wog der Fleischer ein Stück Bauchfleisch für Kümmelbraten ab und legte ein Stanitzel Grammeln dazu. „Tragst das zum Amtsrat Bürger in der Pfaffengasse, dort in dem Haus an der Eck’n von der Hackelgassen, 4 Stock, Tür 3. Tummel di!“
„Is recht, Herr Schef, bin scho a Wolkerl!“ Der Lehrbub rannte mit dem Paket davon und Mathias wandte sich wieder dem Kunden vor der Theke zu.
„Allsdann, was darf’s sein, Herr Inspektor. A Leberkässemmerl?“
„Können’s net zähl’n. Zwanz’g brauch i scho! Mit Senf!“
„Alles klar, Herr Kommissar. Kummt sofurt. Was haben’s eigentlich dort drüben g’macht?“
„Warum?“ Die Augen des Polizisten wurden stechend. „Wissen’s was über des Puff?“
„Was, Puff?“ Der Fleischer riss die Augen auf. „I hab glaubt, des san solche Spinner mit Tischerlrucken und so!“
„Na, des war a richtigs Puff. War wahrscheinlich, wann sie scho weg waren. Auf jeden Fall hat die Finanz a Wörterl mit der Koberin zum reden. Steuerhinterziehung!“
„Ah so“, nickte Leiserer. Zwei Stunden später wusste nicht nur der Simmeringer Markt, warum die Hintwitz verhaftet wurde. Und außer den Frauen und Männern bei der Antschi glaubte es auch jeder.
=◇=
1877 wurde in Wien auf dem Gelände des ehemaligen Exerzierplatzes der Armee am alten Glacis an der Alser Straße ein neues Justizgebäude eröffnet, das Landesgericht Wien mit angegliederter Untersuchungshaftanstalt. Aufgrund der grauen Drillichkleidung, welche an die Häftlinge ausgegeben wurde, bekam das Haus in der Landesgerichtstraße im Volksmund den Namen ‚Das graue Haus‘. Von außen war das Gebäude für einen reinen Zweckbau nicht einmal hässlich zu nennen, wenn man einmal von den massiven eingemauerten Gittern vor den Fenstern absah. Es bekam eine rote Backsteinfassade und erinnerte an eine mittelalterliche Wehranlage. Nun, der Zweck war gar nicht so unähnlich. Nur sollte in diesem Fall niemand am betreten der Festung gehindert werden, sondern am verlassen. Ansonst war das Untersuchungsgefängnis mit der modernsten Technik ausgestattet und mit den damals neuesten Sicherheitskonzepten gebaut. Mit elektrischem Licht und Zentralheizung. Aber ohne Privatsphäre.
Dort angekommen durchlief die Gefangene Hintwitz den routinemäßigen Ablauf. Fotos en face und en profil, Fingerabdrücke, die soeben Einzug in die Kriminalistik fanden. Dann vor zwei Wärterinnen ausziehen, eine Kontrolle aller Körperöffnungen durch die Beamtinnen auf verbotene Gegenstände und eine oberflächliche medizinische Untersuchung. Die Ausgabe des grauen Anstaltskittels und der Hausschuhe aus einer Holzsohle und einem Lederband, der Bettwäsche und Hygieneartikel. Alles genau nach Vorschrift, und wie jedes Mal nach dem gleichen festgelegten Prozedere. Auch hier hatte Franz Karl eine Reform eingeführt, um Vergewaltigungsvorwürfen den Beamten gegenüber entgegen zu treten. Und solche sexuellen Übergriffe hatte es sicher manchmal gegeben. Aber nun wurden die verhafteten Frauen von weiblichem Personal bewacht und untersucht. Im Frauentrakt hatte kein Mann etwas verloren, außer er wurde gerufen. Oder es lag ein Notfall vor.
Nach der Ausgabe der Effekten führte die Anstaltsleiterin Caroline Euler mit zwei stämmigen Schließerinnen Josephine zu ihrer Zelle. Caroline war eine zierliche Frau, etwa einen Meter sechzig, fünfundsechzig groß. Mit Schuhen. Sie trug zur flaschengrünen Uniformjacke, welche alle Justizwachen und die Mistelbacher trugen, einen schwarzen Rock mit dünnen, roten Seitenstreifen und schwarze Halbschuhe.
„Also, ab 22 Uhr ist absolute Ruhe im Trakt“, erklärte sie Josephine die Regeln. „Vormittag hast eine Viertelstunde zum duschen und jeden Tag eine Stunde Hofgang. Jeweils allein. Du darfst dir vom Bibliothekswagen was ausborgen. Frische Unterhosen gibt es jeden, Handtücher jeden dritten Tag. Es stehen dir Gespräche ohne Zeugen mit einem Anwalt zu. Unser Bote wird ihn benachrichtigen, sag es der diensthabenden Oberschließerin. Wenn du keinen hast oder kennst, wird dir Österreich einen zu Seite stellen. Musst es nur sagen.“
Die Zelle von Josephine Hintwitz im Frauentrakt war, wie alle Räume für Untersuchungsgefangene der Anstalt, etwas mehr als vier mal drei Meter groß, trocken und warm. Sie war mit einem nicht allzu unbequemen Bett, einem Spind und einem kleinen Tisch mit Sessel eingerichtet. In einer Ecke gab es ein Waschbecken mit Warm- und Kaltwasser und einen Abort ohne Tür. Das Fenster mit den massiven Stahlgittern ging in den großräumigen Hof und spendete zumindest ein paar Stunden echtes Sonnenlicht. In der Gittertür gab es eine Klappe für das Tablett mit Essen, drei Mahlzeiten täglich standen den Gefangenen zu. Selbstverständlich keine große Küche mit exotischen Zutaten, aber ausgewogene und relativ schmackhaft zubereitete Kost. Immerhin war die Schuld der hier Inhaftierten noch nicht vor Gericht bewiesen, trotzdem war die Aufsicht nicht nachlässig. Die Aufseherin Sibille Hartner war eine beinahe zwei Meter große, bullige Frau mit breiten Schultern, voluminöser Oberweite und Bärenkräften. Ihr auffälligstes Markenzeichen war jedoch ein Schnurrbart, dass beinahe ein Pandur vor Neid erblassen müsste. Diese Beamtin konnte jederzeit vorbeikommen, um nach den arretierten Frauen zu sehen. Und sie tat es auch in unregelmäßigen Abständen, zumeist mit großem Lärm verbunden.
Es war schon nach Mitternacht, als Josephine vom Rasseln der Schlüssel an der Tür geweckt wurde und drei Männer ihre Zelle betraten. Sie blickte von einem Gesicht zum anderen, verstand sofort und nickte nur.

„Nun, wie soll’s denn passieren?“
Der Kleinste und offenbar der Anführer zuckte mit den Schultern. „Du hast die Wahl! Gift, die Pulsadern mit einem zerbrochenen Spiegel aufschneiden oder aufhängen“, zählte er an den Fingern seiner Hand ab. „Mit dem in Streifen gerissenen Bettzeug!“
„Na dann, her mit dem Schierlingsbecher“, seufzte die Prostituierte in ihr Schicksal ergeben. „Man möcht‘ ja eine halbwegs schöne Leich‘ abgeben. Hoffentlich habt’s mir zumindest ein schnelles Mittel ohne viele Schmerzen mitbracht.“ Josephine streckte die Hand aus, der Mann ließ eine Kapsel hineinfallen, während einer seiner Leute den Blechbecher mit Wasser füllte.
„Etwas aus deinem eigenen Vorrat von dir zu Hause. Mathibrahm. Zumindest so viel hast du dir ja verdient.“
„Und ist unauffällig. Hat die blade Blunz’n halt bei der Einlieferung pfuscht und was überseh’n. Net deppert. Aber zumindest geht‘s halbwegs schnell und ohne große Schmerzen, wenn’s genug ist!“ Die Frau biss die Kapsel auf, spülte mit dem Wasser nach und öffnete weit den Mund, damit der Kleine nachsehen konnte, ob sie das Gift tatsächlich genommen hatte.
„Genug für einen Ochsen“, bemerkte er, während er ihren Mundraum untersuchte. „Hochkonzentrierter, reiner Stoff!“
„Na dann!“ Josephine legte sich auf ihr Bett und schloss die Augen. „Und jetzt haut’s euch wieder über die Häuser, beim Krepieren wär ich zumindest‘ schon ganz gern‘ allein!“
„Wie Baronesse befehlen!“ Der Kleine deutete eine devote Bewegung an. Das Gehirn der Josephine nahm den Spott nur noch begrenzt wahr, sie driftete bereits ihre eigene Traumwelt, zumindest für eine kurze Zeit, ehe der Puls und die Atmung aussetzten.
„Schad‘ d’rum, die hätt‘ noch viel zu geben g’habt, Herr Amtsrat!“ sagte einer der großen Männer vor der Tür. „Die schaut ja sogar in dem Häfenzeug’s noch total steil aus.“
„Halt’s Maul, depperter Buckel“, fuhr ihn der Kleine an. „Sie hätt‘ vor allem noch eine ganze Menge zu erzähl’n g’habt. Geh’n wir.“
Eine Stunde später wälzte sich Sibille Harter schnaufend und prustend von ihrer Pritsche im Aufenthaltsraum der Wachposten der Frauenabteilung des Untersuchungsgefängnisses. Kurz wusch sie sich mit kaltem Wasser das Gesicht, ehe sie mit ihrer Runde begann. Teufel, zwei Stunden hatte sie tief und fest geschlafen. Das sah ihr doch gar nicht ähnlich, irgendwie war sie heute auf den Kaffee extrem müde geworden. Sonst machte er sie ja eher munter, aber dieses mal war sie einfach weggemützelt. Sie schüttelte sich den Kopf wieder frei und schlug mit dem Schlüssel an das Gitter der ersten Tür.
„Hallo, Hilde, wie geht’s dir denn so?“ Unter der Decke kam eine Hand mit ausgestrecktem Mittelfinger hervor.
„Na gut, lebst also noch!“ Von der nächsten Tür schallte ihr ein
„I leb‘ eh a no, marschier scho weiter“ entgegen, noch ehe sie sich bemerkbar machen konnte. Alles wie immer, bis sie die Zelle der Josephine Hintwitz erreichte. Ein Blick reichte der Beamtin.
„Scheiße!“ brüllte Sibille aus tiefstem Herzen und schlug auf den modernen, elektrischen Alarmknopf. Nicht lange danach verriet das Trampeln einiger Polizeistiefel das Eintreffen von bewaffneten Wachposten, und die Gefangenen nahmen rasch ganz hinten an ihren Zellen Aufstellung, aus Erfahrung darauf bedacht, die Uniformierten jetzt ja nur nicht zu reizen! Die Schlüssel klirrten, als Sibille mit zitternden Fingern das Schloss öffnete und in die Zelle ging, wo sie die Gefangene Hintwitz auf Vitalfunktionen untersuchte.
„Exitus“, stellte sie fest. „Ich versteh’s nicht, aber sie ist wirklich tot! Verdammt! Hilft aber nichts, da müss‘n wir jetzt halt die Prosektur in der Sensengass‘n verständigen.“ Sie erhob sich aus ihrer knienden Stellung und sah der Josephine lange ins Gesicht. „Von wem hast du denn zuviel g’wusst, Pupperl? Hast glaubt, dass du bei den Groß‘n mitspiel’n kannst? So was geht immer schlecht aus! Die finden immer einen Weg und kommen davon. Komm‘ gut drüben an, und der Herrgott soll’s dort gut mit dir meinen!“
=◇=
„Das glaub ich jetzt aber nicht“, tobte der sonst so ruhige Kommissär Brunner im Gemeinschaftsbureau der Kriminalkommission im dritten Wiener Bezirk. „Jetzt packt einer die Hintwitz in einen Holzpyjama, die Leithfurt ist verschwunden und dem Wölbling hat einer den Hals umdraht. Wir haben nichts mehr, null, nada, nix! Hat man denn die Hintwitz nicht perlustriert?“
„Doch, Herr Kommissär!“ Joschi Pospischil legte Walter Brunner einen Akt vor. „Nach dem Bericht von den Wachtern haben’s eine gründliche Untersuchung vorg’nommen. Oral, vaginal und auch rektal. Man hat ihr alles wegg’nommen. Die Wab’n kann nichts mit die Zell’n g’schmuggelt haben. Unmöglich!“
„Trotzdem liegt’s in der Sensengass’n auf dem Blechtisch“, schimpfte Brunner. „Ist vielleicht einer bei der Nacht einfach ins graue Haus marschiert, an den Post’n vorbei, in den Käfig von der Hintwitz und hat ihr – ja was denn eigentlich? Irgendwas halt geb’n?“
„Na ja, also, es muss so g’wesen sein“, überlegte Heinrich Navratil laut. „Immerhin – die Harter, also die Schlüsselmamsell, die Nachtdienst g’habt hat, auf jeden Fall, die hat ausg’sagt, dass sie sich in der Nacht komisch g’fühlt hat. Sie gibt sogar zu, dass eing’schlafen ist.“
„Hat man die Frau ärztlich untersucht?“ Langsam beruhigte sich Brunner und blätterte in dem Akt.
„Hat man“, rapportierte Joschi. „Gefunden hat man aber nichts!“
„Was aber nicht wirklich was zu bedeuten hat“, bemerkte Heinzi. „Die Hintwitz hat ein paar Trank’ln im Kast’l g’habt, also ich weiß nicht, ob unsere Laborratzen da was g’funden hätt’n.“
„Verdammter Mist“, schimpfte Brunner wieder. „Na gut. Wenn das stimmt, dann haben wir ein größeres Problem, als wir glaubt haben. Unser Gegner ist jetzt eine Organisation, die kein Schild’l mehr an der Haustür haben. Das wird vielleicht ein Tschoch. Aber gut, an die Arbeit, Kinder. Zuerst einmal werden alle Puffs und alle okkultistischen Zirkel überprüft. Gemma, gemma, kalt is net!“
=◇=
London, 221 Baker Street
„Die Aufführung gestern war eine halbe Katastrophe, mein lieber Watson! Was nützt es denn, wenn dieser Mister Wilde durchaus geniale Stücke schreibt, aber die Schauspieler dann noch nicht einmal im kleinsten Rahmen den Mut oder das Können haben, es auch umzusetzen. Zum Teufel, die Salome hatte die erotische Ausstrahlung einer unbemalten Marmorstatue, und sie war auch etwa ebenso beweglich. Herodes wirkte, als hätte er während des Tanzes der sieben Schleier geschlafen, was bei dieser Darstellung der Salome auf kein Wunder war. Auch ich hätte mich ganz gerne damit gerettet, aber ihr spitzer Ellenbogen, Watson, hat mich ständig wieder aufgeweckt. Die einzige gute Schauspielerin war Lady Hopsteed als Herodia. Sie hat die stolze und standesbewusste, aber völlig der Hurerei ergebene und dabei eigentlich völlig machtlose Königin hervorragend gespielt.“
„Die Kritiken sind anderer Meinung, Holmes. Sie loben besonders die zurückhaltende und unaufdringliche Darstellung der Salome, welche bei aller Zurschaustellung ihrer Reize nie ins reißerisch-obszöne abdriftet.“ Der kleinere, ein wenig beleibte Doktor Watson raschelte mit der Zeitung.
„Das glaube ich sofort! Der Rezensist schätzt wahrscheinlich auch zu Hause eine Ehefrau, die sich beim Sex nur bewegt, wenn er ihr einmal Schmerzen bereitet. Ach, hier ist ja die Orangenmarmelade. Darf ich ihnen noch Tee anbieten, mein lieber Doktor?“ Rasch bestrich der Detektiv eine Scheibe Toast und biss herzhaft hinein.
„Sie kennen mich doch zu gut, um zu fragen, alter Freund. Natürlich, gerne. Haben sie eigentlich das Desaster der Landung italienischer Truppen in Eritrea mitverfolgt?“ Sherlock Holmes goss noch zwei Tassen Tee ein und reichte eine davon seinem Freund. „Das habe ich am Rande, Doktor. Und ich gestehe, absolut fasziniert zu sein. Eine Trommel, welche eine solche Auswirkungen hat. Ich bin sicher, mein Bruder Mycroft lässt bereits eine Copie bauen, um die Funktionsweise zu erforschen.“
„Sie denken, er wird Erfolg damit haben. Es reicht, eine riesige Trommel zu bauen, um den Effekt zu replizieren?“
„Aber natürlich, Watson, das ist doch elementar. Wenn es mit dieser Trommel funktioniert hat, muss es auch mit einer anderen gehen. In der Trommel sehe ich nicht das Problem. Eher in den Trommlern. Erinnern sie sich noch an den Fall des schwebenden Druiden? Der Junge war derart überzeugt, die Schuhe der Gwnoddlaght gefunden zu haben, dass er tatsächlich einen Kilometer weit fünf Zentimeter über dem Boden schweben konnte. Und als er erfuhr, dass die Texte um diese Göttin von einem Betrüger frei erfunden waren, schwebte er nie wieder. Obwohl er es vorher ganz zweifelsfrei konnte. Nein, kein Trick, Doktor. Der elementare Grund für Wunder ist sicher nicht im göttlichen Ursprung eines Artefakts zu suchen, sondern hier oben!“ Er tippte mit dem Zeigefinger mehrmals auf Watsons Stirn. „Wenn man alles Unmögliche ausschließt, ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit. Und das Hirn, Doktor, das Hirn ist es, das nach Ausschluss aller anderen Möglichkeiten übrig bleibt. Ein Freund hat einmal zu mir gesagt, Magie sei der beabsichtigte unterbewusste Einsatz noch unbekannter Naturgesetze. Und ich bin durchaus gewillt, ihm darin zuzustimmen, auch wenn der Begriff Magie für mich etwas zu sehr nach Taschenspielerei klingt. Und denken sie auch an Merlins Stab!“
„Wenn an diesem Stab nichts besonderes ist, warum schützen sie ihn dann, Holmes?“
„Weil diese Artefakte das Denken der Menschen stimulieren, Watson. Wenn etwas in ihrem Denken überzeugt ist, dann funktioniert es auch. Zumindest bei manchen Menschen.“ Auf der Straße erklang das Poltern einer rasanten Fahrt mit harten Vollgummireifen auf dem Katzenkopfpflaster der Bakerstreet, gefolgt von einem kurzen, aber lauten Zischen. „Ah, ich denke, ich sollte mich besser ankleiden. So bringt nur der Helfer meines Bruders eine Dampfdroschke zum stehen. Bieten sie Captain Hunting doch bitte in der Zwischenzeit eine Tasse Tee an, Watson.“
Watson öffnete die Tür, als der Captain die Faust eben erhoben hatte, um gegen die Tür zu hämmern. „Sie müssen unsere Tür nicht schon wieder einschlagen, Captain Hunting. Bitte kommen sie herein, Mister Holmes wird in wenigen Minuten ausgehfertig sein. Eine Tasse Tee?“
„Nope, ich soll sie und ihren arroganten Freund zu Mister Mycroft bringen. Sofort!“ Captain Hunting war ein typischer John Bull, eine britische Bulldogge, mit rotem Gesicht und jenem Haar, wie man es sonst eher mit Iren oder Walisern in Verbindung brachte. Ein Umstand, der den Captain völlig kalt ließ. Ire, Schotte, Waliser, immerhin waren alle mehr oder weniger loyale Untertanen derselben Krone. Er war nicht dumm, hielt aber höfliche Floskeln ebenso wie sein Chef Mycroft Holmes für blanke Zeitverschwendung, vielleicht war gerade das ein Zeichen seiner Intelligenz. Andererseits waren Umgangsformen nun einmal so etwas wie das Öl im Getriebe des menschlichen Miteinanders, und Hunting schien Spaß daran zu haben, ein wenig zu provozieren und Sand zwischen die Räder zu werfen. Gerade so viel, dass es knirschte und juckte.
„Dann wollen wir dem umgehend Nachkommen!“ Sherlock kam aus der Garderobe, mit offenem Hemd, offener Jacke und das Halstuch in die Tasche gesteckt, den hohen Hut in der Hand.
„So wollen sie auf die Straße, Holmes?“ Watson nahm rasch seinen Hut und seinen Stock, während er den Freund erstaunt musterte.
„Nun, sie haben es gehört, unser junger Captain soll uns zu Mycroft bringen. Sofort!“
„Nun kommen sie schon, Doc. Mister Mycroft hat nicht den ganzen Tag Zeit!“ Der grinsende Captain Hunting schob Watson zur Türe hinaus, die Art, wie der Detektiv auf seine rüde Art reagierte, gefiel ihm durchaus. Er selbst hätte auch nicht viel anders gehandelt.
In London gab es eine Unzahl von Clubs, beinahe zu jedem Thema zumindest einen. Den Travellers–Club, eine angesehene Gesellschaft reisefreudiger Briten, welche bereits einmal im Ausland und dabei zumindest 500 Meilen von London entfernt gewesen sein mussten. Oder den Reform–Club, in welchem auch der exzentrisch auf absolute Pünktlichkeit und Genauigkeit versessene Phileas Fogg seiner legendären Spieleleidenschaft nachkam und jeden Abend Whist spielte. Im Athenaeum–Club trafen sich Literaten und Wissenschaftler, im Garrick-Club die Schauspieler und im Caledonian die Schotten. Selbst einen Beefsteak–Club gab es, dessen Statuten jedoch wie die vieler anderer Gentlemens-Clubs absoluter Geheimhaltung unterlagen. Der Diogenes-Club, von Sherlocks Bruder Mycroft mitgegründet, war mit der Adresse 21. Greencoat Row im prestigeträchtigen Londoner Stadtteil Westminster angesiedelt und, zumindest nach außen hin, ein Club der Menschenfeinde. Eine Versammlung von Misanthropen, welche der menschlichen Gesellschaft entfliehen wollten, um in aller Ruhe dem guten Sherry und mehreren Zeitungen zusprechen zu können. Warum diese Männer allerdings unbedingt einen Club benötigen sollten, um ihrer Sehnsucht nach Abgeschiedenheit und Einsamkeit nachzugehen, also eine Gesellschaft der Ungeselligen, das konnte wohl nur ein britischer Gentleman nachvollziehen. Der Geschäftsführer und Sekretär des Clubs war ein pensionierter Colonel der königlichen Artillerie, dem die Explosion eines Mörsers den linken Arm und das Bein auf derselben Seite abgerissen hatte, und der nur mit sehr viel Glück überhaupt überlebt hatte. Die Medizintechniker hatten ihm Prothesen angepasst, sodass er mobil und auch sonst nicht all zu sehr behindert war. Allerdings verbarg er die verbrannte und zerstörte Gesichtshälfte hinter einer Maske, welche er nur zum Essen abnahm. Er kommandierte das benötigte Personal und war auch sonst für alle Belange des Clubs zuständig. Mister Peabody, der Chefbutler öffnete persönlich die Tür für Mister Holmes und Doktor Watson, nachdem Captain Hunting sie abgesetzt hatte. Schweigend, nur mit einem Handzeichen auf das Schweigegebot aufmerksam machend, führte er die beiden Gentlemen durch die stillen Hallen des Clubs zu einer unauffälligen Tür und machte eine einladende Geste. Sherlock nickte seinem alten Freund und Chronisten zu, dann öffnete er die Tür. Ein kräftiges Klatschen und schweres Schnaufen war zu hören, dann die Stimme Mycrofts. „Endlich findet mein Bruder den Weg zu mir. Sherlock, das Empire braucht dich!“
„Tatsächlich?“ Sherlock Holmes nickte der Frau in Korsett, Maske und einem Rohrstock in der Hand zu, die hinter seinem Bruder Aufstellung genommen hatte und eben mit dem Stock wieder auf das voluminöse Hinterteil Mycrofts schlug. Sowohl das Klatschen als auch das Schnaufen ließ sich nun wieder vernehmen. „Ma’am, bitte lassen sie nicht durch uns stören! Einen guten Tag wünsche ich.“
„Guten Tag, Sir. Mister Sherlock Holmes und Doktor Watson, möchte ich beinahe annehmen?“
„Absolut korrekt Ma’am!“ Sherlock lüftete den Hut, und der Stock pfiff wieder durch die Luft. „Welch eine wunderschöne Deduktion!“
„Sonst würde er wohl niemand in dieser Situation empfangen, Sir. Es freut mich, ihre Bekanntschaft machen zu dürfen! Ich bin einer ihrer größten Fans. Mein Name Molly. Molly Redbot.“ Es klatschte einmal mehr, als der Stock auf das breite Hinterteil Mycrofts traf.
„Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, Miss Redbot“, versicherte Sherlock. Wieder traf das Rohr treffsicher sein Ziel und entlockte Mycroft Holmes ein Stöhnen. „Ein Künstlername, nehme ich an?“ Klatsch, wieder gesellte sich eine Strieme zu den bereits vorhandenen.
„Aber selbstverständlich, Sir. Man muss doch auf seine speziellen Fähigkeiten aufmerksam machen!“ Noch einmal kollidierten Stock und Hinterteil.
„Sie haben als Kind in Wessex gelebt?“ Sherlock Holmes legte den Zeigefinger an die Oberlippe, und es klatschte wieder!
„Das habe ich, Sir! Woher wissen sie denn das!“
„Nun, Miss Molly Redbot, üblicherweise werden Kinder am linken Oberarm mit Kuhpocken infiziert, durch zwei senkrechte winzige Einschnitte. Stimmen sie mir hier zu, Watson?“
„Selbstverständlich, Holmes, so ist das im gesamten Commonwealth üblich“, bestätigte der Arzt, Miss Molly ging mittlerweile weiter ihrer Arbeit nach und schlug wieder gezielt zu.
„Beinahe überall, mein lieber Doktor. In Wessex gab es einen Arzt namens Woolming, Thomas J. Woolming. Er pflegte seine Patienten am rechten Arm mit einem senkrechten und einem diesen kreuzenden waagerechten Schnitt zu impfen. Wenn sie die Güte hätten, genau hin zu sehen, sollten sie die Schnittführung erkennen!“
„Das ist faszinierend, Sir!“ Molly schlug noch einmal zu. „Es stimmt also, was Doc Watson über sie schreibt. Es ist absolut erstaunlich!“ Wiederholt klatschte das Rohr auf den feisten Hintern Mycrofts. „Ich habe auch noch eine Narbe auf meiner Pobacke, wenn sie die nachher sehen wollen, Mister Holmes, Doktor?“
„Äh, danke, Miss Redbot, aber ich gestehe, dass ihr Angebot nicht ganz meinem Geschmack entspricht!“ Watson hatte sich einen Stuhl genommen und schlug die Beine übereinander. Sein Gesicht verzog sich, als träfe der Stock sein eigenes Sitzfleisch. „Ich habe es gerne etwas weniger – schmerzhaft.“
„Ach, da könnten wir dann gerne darüber sprechen, Doktor. Ich habe auch ein ganz weiches neunschwänziges Kätzchen, aus echter Seide.“ Und noch einmal schlug Molly mit dem Rohrstock zu. „Die macht noch nicht einmal wirkliche Striemen, nur ein wenig Durchblutung. So, Mister Mycroft! Das war es dann. Fünfzig leichte Schläge auf die Backen! Genau abgezählt.“ Molly Redbot legte den Rohrstock beiseite, presste ihren Unterleib an Mycrofts Po und griff um ihn herum. „Sei ein guter Junge und lass es los“, gurrte sie dabei ihn sein Ohr, dann richtete sie sich auf und wischte ihre Hand an einem bereitliegenden feuchten Tuch ab. „Kann ich noch etwas für sie tun, haben sie dieses Mal irgend welche anderen Wünsche?“
„Nein, danke, Molly. Es war mir wie stets ein Vergnügen!“ Mycroft zog seine Hose hoch und ging zu seinem Tisch, wo er den Button für die elektrische Signalanlage auslöste. „Mister Peabody wird ihnen wie gewöhnlich ihr Honorar ausbezahlen und sie hinaus geleiten. Auf Wiedersehen.“
„Mister Mycroft, Mister Sherlock, Doktor Watson, jederzeit zu ihren Diensten! Es war mir eine große Ehre, die Gentlemen kennen lernen zu dürfen!“ Damit verließ die Dame das Zimmer und ließ die Herren allein zurück.
Draußen wurde Miss Molly ‚Redbott‘ Miller von dem Butler höflich, aber schweigend zu einem kleinen Raum begleitet, wo ihre Straßengarderobe und sonstigen Habseligkeiten warteten. Molly wusste, dass auf den Fluren des Clubs Schweigen angebracht war. Als Peabody dann die Tür öffnete, nickte sie ihm nur zu. Der Sekretär des Clubs, Colonel Sanders, wartete bereits auf Molly.
„Miss Molly, ich bin entzückt, sie wieder zu sehen!“ Zeremonielle Worte, ebenso die unausweichliche Antwort.
„Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, Colonel. Und die Ehre!“

Sanders nickte und zückte einen Briefumschlag. „Wie stets, Miss Molly. Ihr Honorar.“ Sie nahm den Umschlag und legte ihn ungeöffnet in ihre Tasche. Sie wusste, die Summe war auf den Pence genau. Hier würde sie niemand betrügen, dazu waren die Geschäftsbeziehungen schon zu lange aufrecht.
„Wenn sie morgen Nachmittags Zeit hätten, Miss Molly? Vielleicht um drei Uhr?“ Miss Miller überlegte nicht lange.
„Selbstverständlich, Colonel“, sagte sie verbindlich zu.
„Dann werde ich Sir John Littleford, den Earl of Surrendy, von ihrem Erscheinen unterrichten.“
Molly schlüpfte aus ihren Stiefeln und dem engen Korsett. „Die harte Gangart?“
„Sir John würde morgen einen Jagdgalopp vorziehen!“ Sanders verzog keine Miene, ließ aber Molly nicht aus den Augen.
„Die Gerte also! Danke, Colonel Sanders.“
„Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Miss Molly. Leider habe ich heute nicht mehr die Zeit, ihre exquisite Gesellschaft und ihren Anblick zu genießen. Vielleicht morgen wieder!“ Der Sekretär des Clubs verbeugte sich kurz.
„Es wird mir ein Vergnügen sein, Colonel.“ Molly deutete einen Knicks an. Dann ging Colonel Sanders und Miss Redbott kleidete sich an. Trotz aller Förmlichkeit waren die beiden relativ gut befreundet. So gut, dass Colonel Sanders der einzige Mann war, von dem Molly kein Geld für ihre Dienstleistungen nahm.
„Ich wusste ja gar nicht, dass du immer noch Schläge auf dein Hinterteil magst!“ Der großgewachsene, hagere Sherlock hatte seine Meerschaumpfeife aus der Tasche genommen und stopfte sie gemütlich.
„Es hilft mir beim Denken, Sherlock. Es wird Blut aus dem Gehirn in die tieferen Regionen des Körpers gezogen, und ich denke geordneter.“ Mycroft ließ sich vorsichtig auf seinem gepolsterten Stuhl sinken. „Sonst jagt ein Gedanken den anderen, bis ich selber den Überblick verliere. Ich denke manchmal für mich selber zu schnell“, bemerkte Mycroft noch selbstironisch.
„Gibt es denn dafür nicht angenehmere Methoden, Mister Mycroft“, wollte Doktor Watson wissen, der ältere Bruder seines Freundes winkte mit der fleischigen Hand ab.
„Unzweifelhaft gibt es diese, mein lieber Doktor. Aber das lenkt dann auch wieder eher vom Denken. Manchmal zu sehr. Also, Sherlock, wie gesagt, das Empire braucht dich!“
„Armes Empire, auf meine Fähigkeiten angewiesen zu sein.“ Sherlock Holmes paffte an seiner Pfeife. „Warum löst du nicht die Probleme mit dieser Trommel selber? Wo hast du sie denn eigentlich nachbauen lassen?“
„In Wales, im königlichen Artillerie- und Pionierstützpunkt Fort Francis Drake bei Marcross natürlich.“ Mycroft holte eine Zigarre aus der Tasche. „Gegenüber den Klippen von Minehead und dem Stützpunkt Fort John Hawkins. Soweit ich informiert bin, arbeitest du gerade an keinem Fall, also hättest du Zeit dafür.“
„Ich soll also nach Wales fahren.“ Der berühmte beratende Detektiv schloss die Augen. „Nun, auf eine solche Distanz von London weg hat mich bisher noch kein Fall geführt, aber soweit ich weiß, fährt die Great Western Railroad Company morgen um Punkt neun Uhr von Paddington aus nach Westen. Wenn ich diesen Eilzug nehme, bin ich um ein Uhr Mittags in Gloucester am Severn, es sind ja nur knappe 113 Meilen. In Gloucester habe ich zwei Stunden Aufenthalt, die 67 Meilen bis Cardiff schafft der Zug in anderthalb Stunden – trotz der vielen Aufenthalte. Für die letzten 25 Meilen werde ich eine Droschke benötigen.“
„Um vier Uhr wird ein Fahrzeug des Royal Artillerie- und Engineercorps auf dich am Bahnhof Cardiff warten“, versprach der Gründer des Diogenes-Clubs. „Aber glaubst du wirklich, der Zug benötigt vier Stunden von London nach Gloucester?“
„Zwei Stunden und achtundvierzig Minuten nach Fahrplan, aber wenn in Britannien je ein Zug auch nur halbwegs pünktlich abführe – bitte beachte den Konjunktiv – die Schlagzeilen der Presse berichteten – ein zweites Mal der Konjunktiv – wahrscheinlich tagelang über dieses Wunder, welches noch nie eingetreten ist. Dagegen wäre deine Trommel beinahe schon normal!“ Sherlock legte seine Hände zu einem Dach zusammen. „Trotzdem solltest du eigentlich wissen, dass ich ein lausiger Techniker bin!“
„Du bist ein hervorragender Beobachter und beinahe so klug wie ich. Also, gib dein Bestes, kleiner Bruder, Britannien benötigt das Wissen um die Funktionsweise dieser Waffe zum weiteren Überleben!“
„Dann steht es sehr schlecht um unser Empire, großer Bruder. Wenn sein Überleben von einer einzigen Waffe abhängt!“
„Wir, also das Empire benötigen nicht unbedingt diese Waffe, mein lieber Bruder. Aber wir benötigen eine Abwehr gegen sie! Sonst jagen uns vielleicht bald die Inder, die Ägypter und die Amerikaner aus ihren Ländern. Das Empire könnte aufhören, in der jetzigen Form zu bestehen! Also, gib dein Bestes, Sherlock. Möchtest du vielleicht einen Sherry?“
=◇=
Der seit 1854 im Betrieb stehende Kopfbahnhof der Great Western Railroad an der Eastbourne Terrace hatte im Jahr 1889 bereits insgesamt 14 Gleise, je zwei und die dazu gehörenden Bahnsteige wurden von hohen, auf Stahlsäulen ruhenden Gewölben aus Metall und Glas überdacht. Der ursprüngliche Entwurf von Isambard Kingdom Brunel mit vier Gleisanlagen wurde im Laufe der Jahre erweitert, ohne die zugrunde liegende Architektur und geniale Statik zu zerstören. 1860 stieg die Great Western auf thermiumbeheizte endothermische Kessel für ihre Lokomotiven um und reinigte die von den Kohlefeuern der exothermischen Maschinen verrußten Scheiben und Träger des Daches. 1872 wurde der Bahnhof elektrifiziert und mit elektrischem Licht durch Göbelbirnen ausgestattet. An der Prael-Street errichtete die Bahngesellschaft das Great Western Hotel, in dessen Speisesaal nicht nur Übernachtungsgäste, sondern alle Reisenden beinahe rund um die Uhr mit Speisen und Getränken versorgt wurden. Selbstverständlich gingen Conduktore mit schweren Messingglocken durch den Speisesaal und verkündeten Ankunft, Bereitstellung und Abfahrt der Züge, sobald diese eintrafen.
Am 16. April 1889, einem Dienstag, standen der weltbeste beratende Detektiv Sherlock Holmes und Doktor John Hamish Watson um drei Minuten vor 9 Uhr am Bahnsteig Nummer 10 der Great Western Railroad Station, von welchem ihr Zug nach Gloucester um Punkt 9 abfahren sollte. Doch es war weit und breit keinerlei Verkehrsmittel zu sehen.
„Wie sie sehen, mein lieber Watson, sehen wir wieder einmal nichts“, konstatierte Holmes in aller Ruhe. „Vor allem keinen Zug nach Wales! Und sie hatten schon befürchtet, zu spät zu kommen.“
Watson kontrollierte seine Taschenuhr und verglich sie mit der großen Bahnhofsuhr. „Zum Teufel, es ist praktisch neun Uhr, und unser Zug steht noch nicht einmal bereit! In Indien wären wir sträflich spät auf dem Bahnsteig eingetroffen, aber hier?“
„Ich nehme an, in Indien wird die Eisenbahn von keiner britischen Gesellschaft geleitet, mein lieber Watson?“ Holmes zog seine Pfeife unter dem leichten Mantel hervor.
„Natürlich sind die Eisenbahnen Indiens im Besitz einer britischen Gesellschaft, Holmes!“ Doktor Watson steckte seine Uhr wieder in die Westentasche. „Auch wenn es sich bei den Angestellten um Sepoys handelt. Man kann doch solche Sachen nicht ausschließlich den Indern anvertrauen! Wer weiß schon, wann dann die Züge abführen!“
„Vielleicht pünktlich, alter Freund! Denn Unpünktlichkeit ist die Spezialität der englischen Railroads.“ Holmes holte eine seiner Pfeife aus der Manteltasche. „Wenn Mister Fogg seine Wette auf eine Reise nach Schottland mit der Eisenbahn abgeschlossen hätte, wäre er seines Einsatzes sehr wahrscheinlich verlustig gegangen. Aber wohlweislich wettete er auf eine Strecke, welche nur zu einem sehr geringen Teil von unserem Eisenbahnnetz abhängig ist.“
„Hallo sie, Conductor“, rief Doktor Watson einem uniformierten Bahnbediensteten an. „Wo ist der Zug nach Wales?“
Der Mann sah sich aufmerksam um, blickte auf die Bahnhofsuhr und zog dann eine riesige Taschenuhr hervor, welche er mit aller nötiger Sorgfalt konsultierte. „Hm, er sollte genau hier stehen, Sir. Aber da er das nicht tut, fürchte ich, dass er Verspätung hat! Keine Sorge, Sir, ihr Ticket ist zwei Tage gültig.“
„Und wie groß wird die Verspätung wohl sein?“ Wieder blickte der Angestellte auf die Bahnhofsuhr und dann auf die eigene. „Es werden wohl mindestens zehn Minuten sein, Sir!“
„Kommen sie, Doktor. Wir werden uns einen Tee und Sandwiches besorgen, der Speisesaal des Hotels hat bereits geöffnet. Wir werden sicher zur Zeit informiert, sobald unser Zug eintrifft!“
„Es ist erstaunlich“, hielt Doktor Watson immer noch am Thema fest. „Eine Nation, welcher es gelingt, Ozeane pünktlich zu durchkreuzen, schafft es nicht, halbwegs pünktliche Eisenbahnen zu unterhalten. Es ist – erstaunlich. Unverständlich.“
=◇=
„Anderthalb Stunden!“ Doktor Watson ritt immer noch auf der Verspätung herum, als draußen bereits die Landschaft von Wessex vorbeizog. Holmes sah aus dem Fenster.
„Doktor, sie sollten sich beruhigen. Immerhin sind wir unterwegs und werden bald in Gloucester ankommen.“ Holmes legte eine Broschüre, in welcher gelesen hatte, ruhig zur Seite. „Sie müssten doch am besten wissen, dass dieser ständige Ärger schlecht für die Gesundheit ist!“
„Ach was, Holmes, es ist der Gesundheit wesentlich abträglicher, seinem Ärger nicht Luft zu machen. Anderthalb Stunden! In dieser Zeit kann ein Land verloren oder gewonnen werden!“
„Deswegen hat die Armee eigene Züge mitsamt den Lokomotiven, Watson. Sie teilt der Railroad Company ihre Fahrt mit, und diese hat für eine freie Strecke zu sorgen. Aber sehen sie nur, hier ist bereits der Severn, und es ist drei Minuten vor ein Uhr. Wir werden also knapp nach dem von mir berechneten Zeitpunkt eintreffen und noch genug Zeit für ein gepflegtes Mittagessen haben.“
Der Bahnhof von Gloucester erwies sich als alter Backsteinbau, welcher für die Bedürfnisse der Great Western Railroad adaptiert wurde. Ursprünglich hatten die Steine in jenem ansprechenden Rot der Ziegelbauten geleuchtet, doch Jahrzehnte der Ablagerung von Kohlerauchpartikel und russigem Regen hatten daraus ein schmutziges Graurot werden lassen. Die Gleiskörper lagen im Freien, und die Perrone wurden nur von einer schmucklosen, billigen Blechkonstruktion überdacht. Diese hielt zwar den Regen von den Bahnsteigen fern, nicht aber den kühlen Wind, der an diesem Tag aus Südwesten wehte und vom Bristol Channel eine Ahnung vom Duft des Meerwassers mit sich trug.
Watson und Holmes überwachten in ihre dicken Mäntel gehüllt das Ausladen ihres Gepäcks und das Verstauen desselben auf einen Wagen, der dann in einen bewachten Lagerraum verbracht wurde. Von diesem Karren sollten später die Koffer in den Zug nach Cardiff verladen werden. Auf diesem Wagen warteten bereits einige Koffer, Taschen und eine voluminöse Hutschachtel. Holmes las müßig die Namensschilder, während sie warteten.
„Miss Diana Hawk.“ Der Detektiv bekam einen abwesenden Gesichtsausdruck. „Das erinnert mich doch ein wenig an die gute Miss Irene Adler“, flüsterte er. „Ach Irene…“
„Sie denken, diese Dame befindet sich hier, Holmes?“ Watson rückte seine Mütze zurück, welche ihm der Wind rauben wollte.
„Bedauerlicherweise nicht, Watson.“ Sherlock Holmes fand in die Gegenwart zurück. „Ein Wiedersehen wäre zwar – erfreulich. Aber ich fürchte, dieses Vergnügen wird uns heute nicht zuteil werden. Lassen sie uns jetzt doch endlich essen gehen.“
Die Bahnhofsrestauration war, der Uhrzeit geschuldet, bereits gut besucht. Die Bedienung sah sich gezwungen, eine Dame um die Erlaubnis zu bitten, die beiden Herren zu ihr an ihren Tisch setzen zu dürfen. Eine Formsache, der Bitte wurde selbstverständlich entsprochen.
„Wir sind ihnen äußerst dankbar, Madame!“ Der Detektiv übergab seinen Hut und Mantel ebenso wie Doktor Watson dem Waiter und verbeugte sich vollendet. „Wir werden uns bemühen, sie nicht zu stören.“
„Aber ich bitte sie, meine Herren, nehmen sie doch Platz!“ Die etwa vierzigjähre Frau mochte einen leicht herben Gesichtsschnitt mit prominenten Vorderzähnen aufweisen, doch ihre Augen blickten intelligent und wach in die Welt. Das strohblonde Haar war zu einem strengen Knoten gebunden, auf die modischen Schläfenlocken hatte die Damen verzichtet. Ihre Bewegungen waren kraftvoll und verrieten eine wohltrainierte Muskulatur unter dem schlichten, aber hervorragend gearbeiteten Reisekostüm aus qualitativ hochwertigen Materialien. Die Lady legte ein flaches Lederband zwischen die Seiten des Buches, in welchem sie gelesen hatte und dieses dann beiseite.
„Vielen Dank. Ich darf Madame Doktor Watson vorstellen, und ich bin…“
„Lassen sie mich doch einmal raten. Sie sind Mister Sherlock Holmes. Offenbar sind also die Berichte über ihr Ableben wohl etwas übertrieben!“
„Sie haben mich durchschaut, Madame.“ Holmes verneigte sich noch einmal, dieses Mal lächelnd.
„Miss reicht, Mister Holmes. Mein Name ist Diana Hawk.“ Sie reichte den Herren die Hand zum Kuss.
„Dann fahren sie also nach Cardiff, Miss Hawk. Wir bemerkten ihr Gepäck draußen auf dem Wagen.“ Holmes behielt die Hand nach dem Kuss noch Sekundenbruchteile länger als nötig in der Hand, und Miss Hawk quittierte es mit einem Lächeln, das ihre Augen und Zähne blitzen ließ.
„Aber ja! Mein Bruder, Major August Hawk, hat ein Anwesen in der Nähe der Bay, und ich möchte ihn für einige Zeit besuchen. Ein wenig reiten, die eine oder andere Jagd, vielleicht auch einen Trip mit seiner Yacht, wenn er die Zeit findet.“
„Sie haben nie geheiratet, Miss Hawk?“ Watson war erstaunt. Eine Dame aus gutem Haus, in diesem Alter, und immer noch ledig?
„Ich habe in meinem Leben bisher nur einen Mann getroffen, der es mir erlaubt hätte, mein Leben so zu führen, wie ich es möchte, Doktor. Nur diesen einen, und der vor unserer Hochzeit leider verstorben. Alle anderen wollten mich mit der Hochzeit wie ein Püppchen aus Porzellan im Haus einsperren, wo ich dann mit anderen geistig kastrierten Damen Tee trinken und die Mode der nächsten Saison diskutieren müsste. Ich habe zwar nichts gegen Tee, aber ich möchte meinen Geist mit mehr als nur seichtem Geschwätz stimuliert sehen. Und ich möchte mir meine Reisen nicht verbieten lassen!“ Diana lächelte John Hamish Watson an.
„Vielleicht nach Indien oder in den Iran“, fragte Holmes nach.
„Aber ja, Mister Holmes. Warum denn nicht? Vor allem aber nach Sindh, in den Punjab und nach Afghanistan“, wandte sich Miss Hawk wieder Sherlock zu. „Es sind so wunderschöne Länder und man trifft wirklich viele interessante Menschen unter den Einheimischen dort.“
„Dann ist es mir eine besondere Ehre, die erste Frau kennen zu lernen, welche Knight Commander of the Bath Order wurde und die zweite, welche das Victoria Cross erhielt, Dame Diana!“
„Ich sagte doch schon, Miss reicht, Mister Holmes! Ich verzichte bewusst darauf, überall meine Orden und Titel anzuführen. Ich habe doch nichts besonderes geleistet. Ich war einfach eine Frau mit dem Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein, um die ersten Anzeichen für einen weiteren Aufstand der afghanischen Warlords erkennen und nach Bombay melden zu können. Meine kleine Affäre mit Shandar Khan war dabei allerdings auch eine kleine Hilfe, denn er und seine Freunde blieben dem Empire treu, so dass der Aufstand nur ein kleines, örtlich und zeitlich stark begrenztes Strohfeuer blieb.“
„Nun gut, Miss Hawk. Ich erlaube mir dennoch, geehrt zu sein.“
„Das, mein lieber Mister Holmes, kann ich ihnen nicht verb… Ja bitte?“
Der Kellner war hinzugetreten. „Die Dame hat das Stout bestellt?“
„Das habe ich, junger Mann. Danke!“
„Und die Herren zwei Mal Ale?“
„Auch das ist korrekt“, befand Watson.
„Darf ich der Dame und den Herren das Tagesgericht empfehlen? Es gibt Roastbeef in Orangensauce mit gestampften Kartoffeln und Prinzessbohnen. Alternativ gegrillte Seezunge, die Beilagen wären die gleichen“, erkundigte sich der Ober, während er seinen Block und einen Graphitstift aus seiner Schürze holte.
„Nun, Doktor, wollen wir das britischste aller britischen Essen zu uns nehmen oder lieber den Fisch“, schmunzelte Holmes.
„Ich denke, ich bleibe Brite und wähle das Roastbeef, alter Freund“, versetzte der Doktor.
„Sie haben es gehört, und für mich bitte die Seezunge“, wandte sich Holmes an den Kellner.
Nach dem einigermaßen brauchbaren Essen entschuldige sich Holmes. „Ich werde mich für eine Pfeife in den Rauchsalon der Wirtschaft verfügen. Bitte entschuldigen sie mich, Miss Hawk.“
„Wenn es sie nicht stört, werde ich sie begleiten, Mister Holmes. Eine gute Zigarre und ein kleiner Gin nach einem schmackhaften Essen erhöhen den Genuss ungemein.“ Auch Miss Hawk erhob sich und ergriff ihre Tasche. Ihr Rock erwies sich mit Ausnahme der gedeckten Farbe von einfachem österreichisch – deutschem Schnitt, also für victorianische Verhältnisse gewagt kurz und ohne Tournüre, dafür war das Jäckchen sehr taillenbetonend geschnitten.
„Ich wäre sehr erfreut, Miss Hawk“, bot Holmes der Dame seinen Arm. Die Gesellschaft nahm an einem kleinen Tisch Platz und orderte noch drei Gläser Gin. Diana Hawk entnahm ihrer Tasche eine blonde Zigarre, eine Julietta Nummer zwei mit beinahe zwei Zentimetern Durchmesser, bohrte mit einem Stachel ein Loch in die Spitze, und leckte kurz daran. Dann nahm sie die Zigarre zwischen die gespitzten Lippen und hielt das stumpfe Ende an die Flamme des Zündholzes, das Sherlock Holmes bereit hielt und sog genussvoll daran, auf eine Art und Weise, dass der große Detektiv den Blick nicht mehr abwenden konnte.
„Sieh an!“ Schmunzelnd blies Diana den Rauch von sich. „Der große Sherlock Holmes ist auch ein Mann, nicht nur ein Gehirn!“
„Ich habe nie etwas anderes von mir behauptet, Miss Hawk!“ Holmes blies das Zündholz aus. „Nur mein Freund Watson hält diesen speziellen Aspekt aus den Schilderungen meiner Abenteuer heraus!“
„Der Verlag würde es doch ohnehin zensieren“, brummte Watson. „Wozu also sich die Mühe machen und darüber schreiben. Außerdem schreibe ich nur jene Handlungen auf, bei denen ich selber anwesend war!“
„Oh!“ Diana sog wieder an der Zigarre und blies den Rauch behaglich von sich. „Und ich hatte den Eindruck, Mister Holmes und sein treuer Begleiter teilten alles!“
„Sollte das eine Einladung werden, Miss Hawk?“ Holmes hob eine Augenbraue, während John Hamish Watson in weite Fernen zu sehen schien.
„Wir haben immerhin anderthalb Stunden Fahrt vor uns“, schmunzelte Diana Hawk schelmisch.“ Und ich muss gestehen, ich könnte mir kaum angenehmere – Reisebegleiter nach Cardiff wünschen!“
„Nun, Miss Hawk, ich denke, der gute Doktor und ich werden sie gut zu unterhalten wissen!“ Holmes paffte rasch an seiner Pfeife, damit die Glut nicht ausging.
„Das hoffe ich.“ Dame Diana stützte das Kinn auf ihre freie Hand. „Immerhin erwähnt der gute Doktor in seinen Werken immer wieder ihre spitze Zunge!“
Eine Eigenart der britischen Eisenbahnwaggons war schon immer, dass die einzelnen Abteile der ersten Klasse – und selbstverständlich reisten sowohl Miss Hawk, KCBO und VC, als auch Holmes und Watson in derselben – nur von außen zugänglich waren, es gab keinen verbindenden Gang. Sobald also der Conductor die Tickets gesehen hatte, konnte man, sofern man es wollte, den Vorhang zuziehen und war so vor jeder Störung bis zum Zielbahnhof sicher. Im Falle von Miss Hawk, Holmes und Watson in Abteil Nummer sechs war das Cardiff in Wales. Eine Stadt, die als der größte Kohlenhafen von ganz Britannien galt. Überhaupt war Wales einer der Hauptlieferanten von Rohstoffen für die britische Industrie, Eisen, Kupfer, Kohle und Schiefer wurden sowohl im Tagebau als auch unter Tage in mächtigen Bergwerken abgebaut. Kein Wunder also, dass das Vaporid in Wales nicht für ungeteilte Begeisterung sorgte und die Great Western Railroad ab Gloucester noch immer alte, mit Kohle befeuerte Lokomotiven einsetzte.
Das Wetter hier im Süden von Wales an der breiten Mündung des Flusses Severn lud ohnehin nicht zum Öffnen der Fenster in den Eisenbahnen ein, zumindest nicht jetzt im April, der zumeist kühl, feucht und regnerisch war. So war es nicht auffällig, dass auch die Fenster von Abteil sechs während der gesamten Fahrt fest verschlossen blieben. Nur einmal bewegte eine schmale Frauenhand den Vorhang etwas zur Seite, und Miss Hawk sah hinaus.

„Wir sind in Newport, meine Herren. Noch etwa sechzehn Minuten Fahrt bis Cardiff. Es war eine sehr – kurzweilige und interessante Fahrt mit ihnen.“
„Dieses Kompliment kann ich für meinen Teil voll und ganz zurückgeben, Miss Hawk.“ Holmes band sein Halstuch zu einem adretten Knoten. „Nie ist für mich eine Fahrt mit der Eisenbahn angenehmer verlaufen.“
„Vielleicht verschlägt es sie ja in der nächsten Zeit einmal nach Barry bei Gibbons Down. Fragen sie nach dem Gut von August Hawk, der Major a.D. würde sich sicher freuen, einen Mann wie sie kennen zu lernen, Mister Holmes. Und mit Doktor Watson über seine Zeit in Indien zu plaudern.“ Diana knöpfte das Jäckchen zu.
„Das könnte tatsächlich geschehen, Miss Hawk“, versicherte Doktor Watson mit einem verträumten Lächeln im Gesicht.
„Sie werden willkommen sein, Doktor“, versprach Dame Diana. „Nicht nur meinem Bruder.“
In Cardiff angekommen wartete schon ein Pionierleutnant der Basis Fort Francis Drake nahe dem Nashpoint – Leuchtturmes bei Macross mit zwei Korporälen auf dem Bahnsteig. Holmes und Watson verließen ihr Abteil und traten zu den Soldaten.
„Dies ist Doktor Watson, mein Name ist Sherlock Holmes. Sie sollen mich abholen, Lieutenant?“
„Sir! Ja Sir!“ Der Leutnant und seine Männer stampften einmal mit den Füßen auf, standen stramm und salutierten.
„Stehen sie bequem, Lieutenant, und ihre Männer auch“, beschied Holmes. „Der Doktor und ich sind nicht mehr im aktiven Militärdienst.“
„Sie haben gedient, Holmes?“ Erstaunen malte sich auf Watsons Gesicht. „Davon haben sie mir nie erzählt!“
„Da gibt es auch nichts zu erzählen, Doktor. Ich war jung und meldete mich, Mycroft kaufte mir ein Patent zum Captain, und nach etwa einem Jahr verließ ich `58 die Army wieder.“
„Welches Regiment denn, Holmes“, rief Watson, Holmes Gesicht wurde ausdruckslos.
„Das 95th Rifles Brigade Prince Consort’s Own, Doktor.“
„58? Die Blockade des Hei He?“
„Reden wir nicht mehr davon, mein guter Doktor.“ Holmes wandte sich wieder an den Pionieroffizier. „Danke, dass sie uns abholen, Lieutenant. Der Gepäckwagen ist vorne!“ Holmes wies an das vordere Ende des Zuges.
„Jawohl, Sir! Jackson, Brown, kehrt machen und zum Gepäckwagen! Ausführung!“ Zwei Kehlen brüllten ihr ‚Yes Sir‘ über den Bahnsteig, die Korporäle machten auf dem Stand kehrt und marschierten davon.
„Dann wollen wir einmal gehen, Lieutenant“, schlug Holmes vor. „Warten sie schon lange?“
„Nein Sir! Im Telegramm aus London hat man uns mitgeteilt, dass wir erst um vier Uhr hier antreten müssten. Trotz der Ankunft laut Fahrplan um drei Uhr.“ Der Lieutenant zuckte mit den Schultern. „British Railways eben!“
Gemütlich schlenderten die Herren mit dem Offizier den Zug entlang und wurden bald von einer schlanken Frau überholt, welche auf einen der müßig am Gleis herumstehenden Herren zueilte.
„August! Wie geht es meinem Lieblingsbruder?“
Der Mann nahm den Hut ab, ehe er die Frau umarmte. „Danke, Diana, ich hoffe, dass es dir so gut wie mir ergeht?“
„Das tut es. August, ich darf dir Captain Doktor John Hamish Watson vorstellen, und dieser Gentleman ist Mister Holmes. Der Mister Sherlock Holmes. Gentlemen, das ist mein Bruder, Major August Hawk, VC, RCC. Diese Herren waren so freundlich, mich ab Gloucester unter ihre Fittiche zu nehmen und mir ein wenig die Zeit zu vertreiben. Ich habe sie eingeladen, uns zu besuchen – falls ihre Zeit es zulässt.“
„Wenn Diana sie eingeladen hat, Gentlemen, ist das so gut, als hätte ich sie eingeladen.“ Major Hawk musterte John Hamish Watson. „Sie haben gedient, Doktor?“
„Im pakistanischen Indien, in Islamabad und Peschawar, dazu einige Zeit in Dschalabad in Afghanistan, Sir.“
„Nun, meine Herren, ich hoffe, sie bald wieder zu sehen. Würden sie uns jetzt bitte entschuldigen?“ Höflich zog man noch die Hüte voreinander, und die Herren küssten Dame Diana zum Abschied die Hand.
=◇=
Auf der Höhe der Klippen von Minehead am Südufer des dort 18 Kilometer breiten Stromes Severn, bei dem sich hier bei Flut bereits viel Salzwasser mit dem Flusswasser mischte und man sich uneins war, ob es noch der Fluss oder doch bereits die Bristol Bay war, hatte man zu beiden Seiten starke Artilleriestellungen mit einander überlappenden Feuerbereichen gebaut, um die wichtigen Hafenstädte Cardiff oder Gloucester weiter östlich zu schützen. Die großkalibrigen 13,5 Zoll Hinterlader-Kanonen erreichten bei einer Kadenz von 1,5 Schuss in der Minute bereits eine effektive Reichweite von beinahe 14 Kilometern. Ebenso hatte die Admiralität verlangt, eine Insel vor Weston-super-Mare, die Felseninsel Split Rock, zu einer wahrhaft waffenstarrenden Festung mit Bunkern aus bis zu 50 Zoll starken Mauern aus Stahl und Beton auszubauen. Alle drei Festungen unterstanden dem Kommando der British Royal Army und waren mit Angehörigen der Royal Artillery bemannt. Sie wurden aber noch durch eine Flottille schneller Torpedoboote mit Dampfturbinen und einigen leichten Kreuzern verstärkt. Außerdem wurde Split Rock vom Royal Navy Auxilliary Service mit dem nötigen Nachschub versorgt. Die Verteidigungsstellungen der Inselfestung waren von den Royal Marines besetzt, während die Forts an Land von den Infanteristen der Armee verteidigt wurden. Der Tidenhub im Bristol Kanal betrug im Durchschnitt gute 15 Meter, das Wasser bildete zu bestimmten Zeiten eine zwei Meter hohe Gezeitenwelle, welche manchmal bis Gloucester den Fluss hinaufströmte. Der Severn selbst war an seiner Mündung breit und tief genug, damit selbst große Panzerschiffe ihn ohne Probleme befahren konnten. Man konnte also mit Fug und Recht sagen, dass der Bristol Kanal und die walisischen Küstenstriche zu den am besten geschützten Gewässern des Empires gehörte. Natürlich der Rohstoffe wegen.
Hier in Wales wurden auch neue Kanonen beziehungsweise deren Lafetten sowohl für die mobile als auch die Festungsartillerie und die Navy entwickelt. Größere Kadenz, mehr Durchschlagskraft, verbesserte Treffergenauigkeit und höhere Reichweiten bei weniger Übertragung des Rückstoßes auf den Untergrund war immer das erklärte Ziel dieser Armeeingenieure. Einige Meilen Nordwärts von Fort Drake lag Fort Cromwell. Hier versuchte man, die im Fort Drake erreichten Fortschritte in der Zerstörungskraft der Granaten wieder zunichte zu machen. Hier tüftelte man an neuen Schutzsystemen für Mobilien und Immobilien. Jedes Offizierspatent der Einheiten der Royal Artillery war durch Fleiß und Intelligenz erworben, diese Patente wurden nicht verkauft. Es fanden sich daher auch kaum Adelige in diesem Offizierscorps. Allerdings gab es durchaus die Möglichkeit, als Artillerie- oder Pionieroffizier für seine Verdienste geadelt zu werden – wie am Beispiel des Colonels und Sirdar Sir Horatio Herbert Kitchener, dem ersten Earl of Kitchener, GCB, RCC, gut zu erkennen war.
Das Fort Francis Drake war teilweise noch nach alten Festungsplänen erbaut und erinnerte im Aufbau stark an eine mittelalterliche, stark befestigte Stadt. Allerdings waren die alten Bastionen nur noch mit leichter Schnellfeuerartillerie und einigen von William Hale entwickelten und kontinuierlich verbesserten Raketenwerfern mit Reichweiten von bis zu 10 Kilometern bestückt. Für die großen Kaliber hatte man später gut geschützte Bunker aus stahlarmiertem 50 Zoll dickem Beton gegossen und die Kanonen mit drehbaren Kasematten aus hervorragendem Stahl aus Sheffield versehen. Die Armeeführung hatte bei Indienststellung der ROMA durch die italienischen Flotte zuerst Malta mit diesen Bunkern ausgestattet, um der enormen Feuerkraft dieses Giganten bei einem etwaigen Angriff auf diese Insel etwas entgegen setzen zu können. Zeitgleich war auch Gibraltar weiter ausgebaut worden und beherrschte nach wie vor den Weg vom Mittelmeer in den Atlantik. Alle Erfahrungen beim Bau dieser Abwehranlagen flossen dann letztendlich in die Küstenbatterien der britischen Inseln ein. Auch die Gefahr eines Luftangriffes durch Flugschiffe, von denen Britannien auch einige schwere und leichte Panzerkreuzer mit den Werner-Dampfturbinen sein eigen nannte, wurde bei den neuesten Umbauten berücksichtigt und die Hale-Raketenwerfer so umgebaut worden, dass sie gleich ganze Fächer der mit starken Sprengköpfen bestückten Waffen verfeuern konnten. Diese Raketenwerfer waren bereits in ganz Europa verbreitet, denn weder die Royal Army noch die Royal Navy hatten vorerst Interesse an den neumodischen Krempel gezeigt, 1840 setzten die hohen Herren in den Kommandostäben noch auf immer schwerere Vorderladergeschütze. Also verkaufte William Hale sein Patent gegen Lizenzgebühren an jeden, der genug für seine Erfindung bezahlte. Selbstverständlich auch an ausländische Mächte. Im deutschen Sprachraum wurden diese Geräte im dienstlichen Sprachgebrauch immer noch ‚Lufttorpedos‘ genannt.
Hier im Fort am Severn – beziehungsweise dem Bristol Kanal – war aber auch eine Forschungsanlage für ganz neue Artillerietechnologien. Zum Beispiel hatte man mit dampfbetriebenen Katapulten, welche multiple Sprengkörper über feindliche Stellungen abregnen lassen konnten, schon erhebliche Reichweiten erzielt. Oder einer hydraulischen Startvorrichtung für schwer beladene Ornithopter. Man versuchte, einen elektrischen Überschlagsblitz gezielt auf ein Schiff zu projizieren – hier war allerdings der Erfolg eher marginal. Als Nebenprodukt hatte man aber immerhin einen neuen Schutzzaun erzeugt, der mit regelbarer Hochspannung geladen werden konnte. Kommerziell war die Erfindung ein voller Erfolg und löste in vielen Bereichen den Stacheldraht ab. Der Kommandant der Festung, Colonel Jake Masterson, sah diese Entwicklung ambivalent. Ein Blitzwerfer wäre ihm lieber gewesen, aber die Pfund Sterling in Gold und Silber, welche die Erfindung dem Empire brachten, waren auch nicht zu verachten.
Es war also kein Wunder, dass die Trommel ausgerechnet hier nachgebaut und ausprobiert werden sollte.
„Das ist unser Schmuckstück, Mister Holmes.“ Colonel Jake Masterson führte seine Gäste persönlich an den Teststand. „9 Fuß im Durchmesser und der Ring ist 6 Fuß breit!“
„Beeindruckend!“ Holmes schritt um die Riesentrommel herum. „Womit habt ihr sie denn bespannt?“
„Mit dem besten gespaltenen, vernähten und danach verklebtem Schweineleder natürlich“, erklärte der Colonel.
„Aha.“ Der Detektiv strich über den geölten und polierten schön gemaserten Reif. „Und das Holz?“
„Nun, beste englische Eiche natürlich“, betonte Masterson. Holmes nickte versonnen und blickte dann auf das Meer hinaus. „Natürlich. Und wie sieht es mit dem Erfolg aus, Colonel?“
Der Kommandant der Festung nahm die Kappe ab und strich mit seinem Taschentuch über das Schweißband. „Nicht besonders gut, Mister Holmes. Gar nicht gut. Sehen sie doch selbst. Sergeant!“
„AYE, SIR!“ Sergeant Stonewall stampfte salutierend mit beiden Beinen auf und machte auf der Stelle kehrt. „ACHTUNG!“ Zwei Soldaten nahmen Haltung an und machten sich dann bereit. „FEUER“, brüllte der Sergeant, seine Lautstärke schien einer mittleren Haubitze Konkurrenz machen zu wollen. Die beiden Soldaten schlugen abwechselnd mit langen Stöcken auf das Fell der Trommel ein, die dumpfen Schläge hallten über den Kanal.
„Wie sie sehen, Mister Holmes, es gibt durchaus einen Effekt. Aber diese kaum acht Zoll hohe Dünung, die wir gerade so hinbekommen, bringt nicht einmal ein billiges Fischerboot in Gefahr.“ Der Colonel hob die Schultern. „Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin Ingenieur, von solchen magischen Dingen verstehe ich nicht viel!“
„Nun, Colonel, zwei Fehler sind mir für das erste schon einmal aufgefallen.“ Holmes zog seine gebogene Meerschaumpfeife aus der Manteltasche. „In Palästina zur Zeit der ersten hebräischen Besiedelung gab es sicher keine Eichen, egal ob britisch oder nicht. Und die Hebräer werden bestimmt kein heiliges Instrument mit dem Leder eines Tieres bespannt haben, welches sie als unrein angesehen haben. Sie werden sicher koscheres Material genommen haben.“ Er entzündete die Pfeife und wandte sich nach einigen Zügen an Watson. „Wir wollen doch einmal Cardiff aufsuchen und sehen, ob wir dort einen Rabbiner finden, mein lieber Doktor!“
„In Wales“, fragte Watson ungläubig nach.
„Oh! Ja! Ja natürlich. Es wäre schon ein Glück, in Gloucester einen zu finden, oder? Nun, mein lieber Watson, dann bleibt nur noch eines übrig. Ich werde nach London fahren müssen, um dort den Oberrabbiner von England zu fragen. Sie könnten doch in der Zwischenzeit Miss Hawk besuchen, ich komme sie dann von dort abholen!“
„Nun, Holmes, ich weiß ihre Fürsorge durchaus zu schätzen, aber…“
„Nein, nein, lieber Doktor. Ich komme in London schon allein zurecht. Oder wäre ihnen ein Besuch bei Miss Redbot lieber als bei Dame Diana?“
„Wenn sie so fragen, Holmes, dann werde ich sie auf dem Gut des Majors erwarten!“
—●○⊙○●—