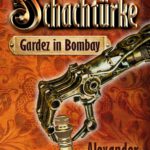Heyne 3158
160 Seiten, TB (1978)
Aus dem Amerikanischen von Gisela Stege
Naturkatastrophen sind etwas Entsetzliches, da sind wir uns vermutlich alle einig. Gegen vieles kann man sich schützen – gegen Kriege, gegen Terroranschläge, menschliche Infamie, selbst gegen Epidemien… aber gegen Erdbeben, Vulkanausbrüche, Tsunamis oder Stürme? Da hilft nur noch die Flucht.
Was aber, wenn das gar nicht möglich ist? Was, wenn es keinen Ort auf der ganzen Welt gibt, wo man dem Sturm entgehen könnte?
Um dieses Thema geht es in James Graham Ballards apokalyptischem Klassiker „Der Sturm aus dem Nichts“, dessen dramatisierter deutscher Titel dem Inhalt deutlich besser gerecht wird als der doch gewissermaßen britisch-unterkühlte Originaltitel. Wer nicht weiß, worum es geht und den Roman noch nicht kennen sollte, der lasse sich von mir auf den aktuellen Stand bringen. Das geht etwa folgendermaßen:
In der nahen Zukunft (der Roman erschien erstmals im Jahre 1962, und er spielt vor dem ersten Mondflug, d. h. irgendwann Ende der 60er Jahre) fällt dem jungen Arzt Donald Maitland der Staub auf. Zusammen mit einem ungewöhnlich hartnäckigen, ständig zunehmenden Wind, der langsam das normale Leben beeinträchtigt, lagert er sich in London ab. Ein seltsamer, pulvrig-kristalliner Staub von eigentümlicher Konsistenz, der dank des Windes sogar in Taxis hineinsickert und sich überall festsetzt. Später soll er herausfinden, dass dieser Staub aus den Lössebenen Tibets stammt, und allein das lässt dem Leser schon einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Aber das ist ja alles erst der zarte Beginn einer unvorstellbaren Katastrophe.
Einerlei – Maitland hat zu diesem Zeitpunkt ganz andere Sorgen. Er lebt getrennt von seiner Frau Susan, die ihn lange aufgrund ihres Reichtums ausgehalten hat. Jetzt möchte er eigentlich vor ihr flüchten und in die USA entkommen, um sein Medizinstipendium fortzuführen. Er soll dort aber nie ankommen.
Der stärker werdende Wind bringt den Flugverkehr zum Erliegen. Tanker kentern, Kreuzfahrtschiffe geraten in Seenot, Küstenstädte werden überschwemmt. Und der Wind wird stärker.
Und stärker.
Siebzig Stundenkilometer.
Achtzig Stundenkilometer.
Hundert Stundenkilometer.
Es gibt kein Nachlassen, keine Ruhepause… und unheimlicherweise gibt es auch rund um den Globus keinen Ort, wo der Wind, wie das für Hochdrucksysteme üblich ist, antagonistisch Pause machen würde.
Der Sturm aus dem Nichts weht überall auf der Erde. Die Unterschiede in der Stärke sind offensichtlich den Breitengraden geschuldet. Die Äquatorregion erwischt es am schlimmsten und am frühesten. Dort werden ganze Dörfer vom Boden fortgerissen und zerschmettert.
Doch die gemäßigten Breiten haben nur eine Gnadenfrist.
Mit einer gespenstischen Regelmäßigkeit nimmt der Sturm pro Tag um weitere fünf Stundenkilometer zu. Überall auf der Welt. Stetig. Unaufhaltsam. Eine Ursache ist nicht erkennbar. Ein Abflauen ist nicht in Sicht.
Luftverkehr wird unmöglich.
Schiffsverkehr wird unmöglich.
U-Boote drohen beim Auftauchen zu kentern oder von Wrackteilen, die auf der Meeresoberfläche treiben, zerschmettert zu werden.
Die Menschheit kämpft schnell ums Überleben.
Ganze Metropolen werden vom Antlitz der Welt ausradiert. Manhattan? Ins Meer gespült. Berlin? Vom Staub- und Trümmersturm eingeebnet. London? Moskau? Washington? Peking? Trümmerwüsten, allesamt. Die Bevölkerung aufs Land geflüchtet oder in Keller, Tunnel und Bunker verdrängt. Eine Katastrophenmeldung jagt die nächste.
Hundertdreißig Stundenkilometer.
Hundertfünfzig Stundenkilometer.
Hundertsiebzig Stundenkilometer…
Es ist kein Ende abzusehen. Selbst massive Gebäude beginnen einzustürzen. U-Bahn-Schächte werden geflutet. Straßen lösen sich auf. Städte werden ins Meer gewaschen. Menschen, die ins Freie flüchten, packt der gnadenlose Wind und reißt sie hinauf in den Sturm und in den Tod, als wären sie gewichtslos gleich losgerissenen Luftballons.
Und doch gibt es einen Funken Hoffnung in der schwarzen Finsternis des ewig scheinenden Sturmes – da existiert etwas, das Eingeweihte den „Hardoon-Turm“ nennen. Scheinbar eine Zuflucht, aber vielleicht auch etwas völlig anderes. Aber wenn man nichts anderes mehr hat, woran man sich klammern kann, dann ist dies vielleicht der rettende Strohhalm…
Mit „Der Sturm aus dem Nichts“, einem Buch, das ich schon 1991 das erste Mal mit tiefer Erschütterung las und das ich nun erneut hervorzog, um es endlich mit einer Rezension ins Bewusstsein neugieriger Phantastik-Fans zu rücken, liegt in der Tat ein Werk vor, das das Label „apokalyptisch“ in vollem Umfang verdient. Das Buch, das der 1930 geborene Ballard im Alter von nicht einmal 32 Jahren veröffentlichte und das seinen ersten Roman darstellt, packt den Leser selbst nach einer Zeit von mehr als fünfzig Jahren nach Ersterscheinen. Es gehört, das sollte vielleicht erwähnt werden, in die thematische Nähe einer Reihe weiterer Bücher, nämlich „Welt in Flammen“, „Kristallwelt“ und „Karneval der Alligatoren“. Er hat hier, könnte man sagen, nacheinander die verschiedenen Elemente „Amok laufen“ lassen: im vorliegenden Roman das Element Luft, in dem zweiten Feuer, in „Karneval“ ist es Wasser, das die Welt ertränkt (im Zuge der globalen Klimaerwärmung nahezu prophetisch, möchte ich behaupten).
Die Einzelschicksale wie etwa das von Donald Maitland, es ließen sich noch einige andere anbringen, die durch das Chaos einer zunehmend völlig unkontrollierbar werdenden, verwüsteten Welt irren und zum Teil versuchen, abstruse Befehle auszuführen, illustrieren schlaglichtartig die immer surrealer werdenden Geschehnisse. Insbesondere der verbissene Überlebenskampf der weltweit dem Chaos ausgesetzten Protagonisten, die Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten suchen, bringt Lebendigkeit in die unerbittliche Schilderung der Zerstörungskulisse, die sich vor dem Leser zunehmend ausbreitet, je länger die Apokalypse des weltweiten Sturmes gleich einem kosmischen Sandstrahlgebläse den Globus von der Menschheit zu säubern sucht.
Die Vorstellung, dass ein quasi kosmisches Phänomen – es wird an einer Stelle angedeutet, dass dies der Grund für den „Sturm“ sein könnte, aber ob das stimmt oder nur eine Hypothese darstellt, kommt nirgends heraus – die irdischen Hochdrucksysteme der Thermik so konstant überdreht und beschleunigt, gleich „einem kosmischen Karussell“, sie ist von beklemmender Intensität. Bedrückend wirkt die Hilflosigkeit und Ohnmacht der Betroffenen, bewundernswert der verzweifelte Überlebensdrang derjenigen, die sich nicht unterkriegen lassen wollen, zugleich allumfassend die Verwüstung auf der Erdoberfläche und die Zerstörungsszenarien, die Ballard mit unglaublicher Wortgewalt entwirft und die Gisela Stege solide in deutsche Formulierungen presst. Zwar ist an manchen Stellen Argwohn angebracht, da dort die Vermutung genährt wird, der Verlag habe das originale Skript deutlich gekürzt und an die damalige Heyne-Standardlänge von 160 Druckseiten angepasst… aber selbst das kann den überwältigenden Eindruck dieser Geschichte nur bedingt schmälern.
Dennoch ist das kein Buch für übermäßig optimistische Gemüter. Wem Bilder von Zerstörung und Hoffnungslosigkeit aufs Gemüt schlagen, wer sich strahlende Happy Ends ersehnt, ist bei Ballard generell am falschen Platz. Wer jedoch umgekehrt wissen möchte, wie man mit Hilfe eines so flüchtigen Elements wie der Luft und des Sturmes ein gesamtes Buch füllen kann, und dann noch durchaus plausibel… der ist hier genau richtig.
Ballards Klassiker lohnt unbedingt eine Neuentdeckung. Selbst wenn man ihn wahrscheinlich (mal wieder) nur antiquarisch bekommen kann, ist er die Investition auf alle Fälle wert.
Eindeutiges Urteil: Eine klare Leseempfehlung.
© 2017 by Uwe Lammers
Braunschweig, den 22. März 2017